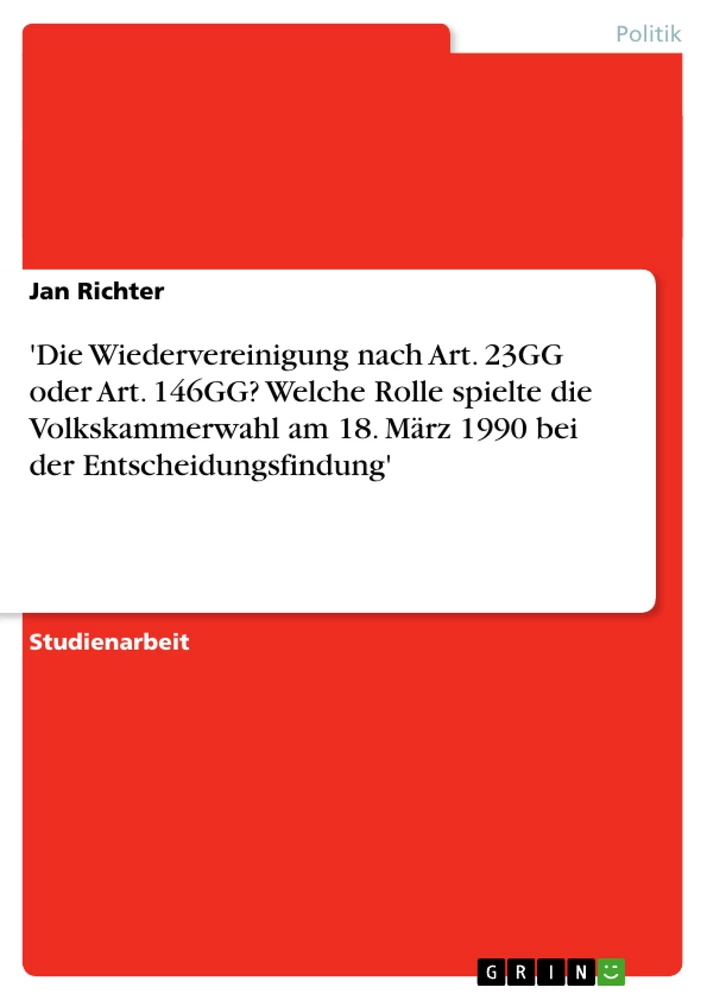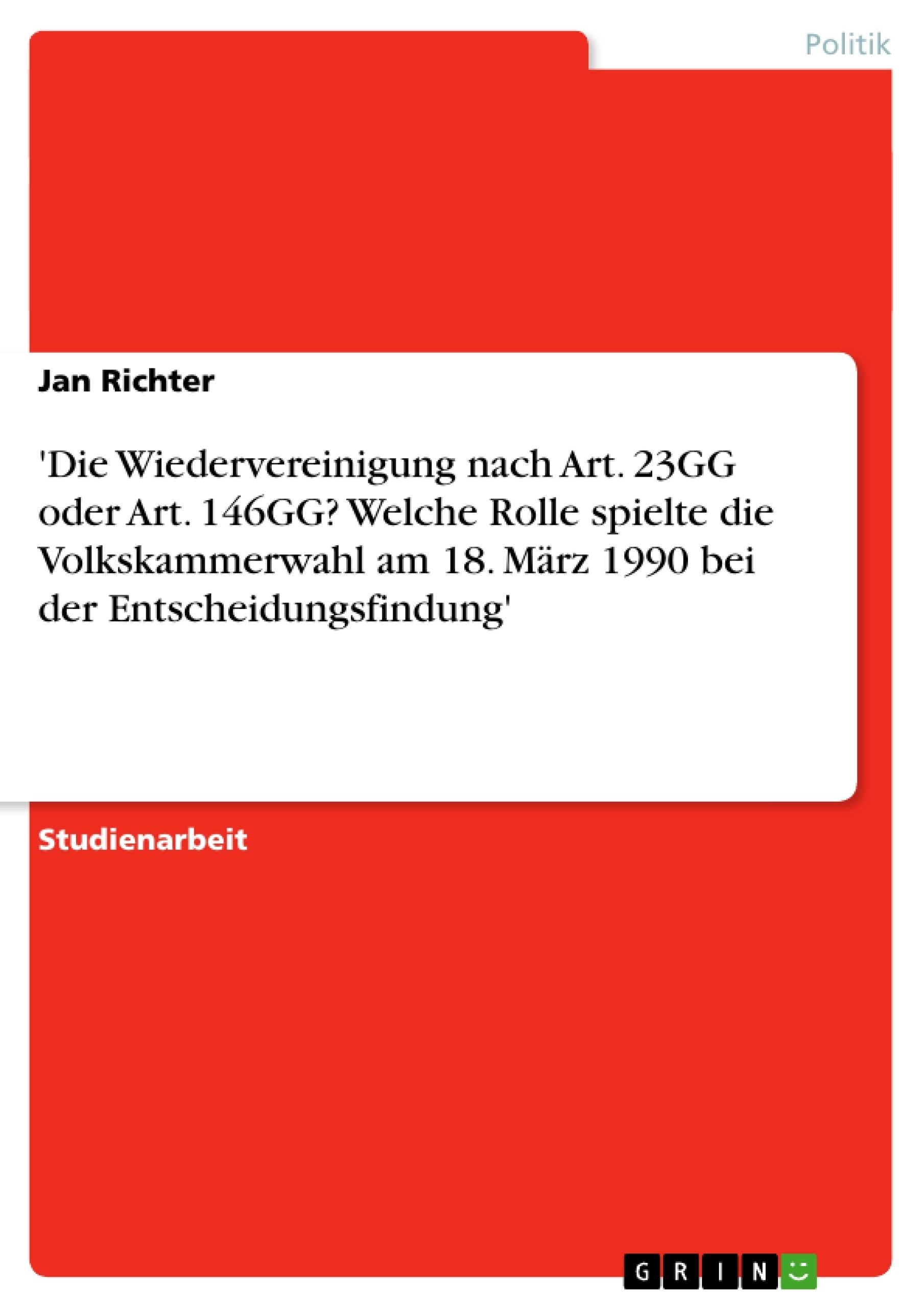Als Ungarn am 2. Mai 1989 die Grenze zu Österreich öffnete und für DDR-Bürger erstmals eine Fluchtmöglichkeit über ein anderes sozialistisches Land besteht, ist die Krise in der DDR nicht mehr aufzuhalten. Die Angespanntheit und Unzufriedenheit der Bürger in der DDR ist 1989 nicht mehr zu beschönigen. Unter dem Eindruck von Massenflucht und Großdemonstrationen kam es im Oktober 1989 innerhalb des SED-Politbüros zum Aufbegehren gegen Honecker. Die Neue Führung unter Egon Krenz und später Hans Modrow versprach Reformen. Am 9. November 1989 fiel dann überraschend die Mauer und die Stimmung im Volk wandelte sich immer mehr von „Wir sind das Volk“ zu „Wir sind ein Volk“. Anfang 1990 war schon abzusehen, dass es nach dem Willen der Mehrheit des Volkes keine reformierte DDR mehr geben würde, sondern den Weg zur Wiedervereinigung. Die Vorliegende Arbeit beschäftigt sich nun vorwiegend mit der Frage nach der Verfassungsrechtlichen Seite einer Wiedervereinigung. Einheit nach Art. 23GG oder Art. 146GG war in der Wendezeit eine vieldiskutierte Debatte. Vor- und Nachteile beider Wege sollen hier beleuchtet werden. Und die Frage die sich daran anschließt: War die Volkskammerwahl am 18. März 1990 ein Votum der Bevölkerung für eine Vereinigung über Art. 23GG, also eine schnelle und unkomplizierte Variante der Wiedervereinigung? Um diese Fragestellung bearbeiten zu können, wird im ersten Teil ein Abriss der Entwicklungen im Jahr 1989 dargestellt. Im Hauptteil werden dann die verschiedenen Verfassungsrechtlichen Optionen einer Wiedervereinigung erläutert. Anschließend rücken die Volkskammerwahl 1990 und die Ergebnisse der Wahl in den Fokus. Im abschließenden Teil versucht diese Arbeit eine Antwort auf die Fragestellung zu geben, ob das Volk mit seiner Wahl den Beitritt der DDR, zum Geltungsbereich der BRD, nach Art. 23GG wünschte. Der Erforschung der Frage, inwiefern die Ostdeutschen eine Vereinigung wünschen, widmete sich eine Untersuchung der Forschungsgruppe Wahlen aus der Zeit direkt vor den Volkskammerwahlen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in einem Beitrag von Wolfgang Gibowski im Heft 1/1990 der Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl) nachzulesen und werden auch für diese Arbeit verwandt. Weiterhin primär waren die Publikationen von Annette Icks (Der Transformationsprozess in der ehemaligen DDR 1989-1991), die Informationen zur Politischen Bildung (Heft 250/2005) und von Hermann Weber (Geschichte der DDR). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Entwicklungen in der DDR im Jahr 1989
- 1.1 Der Beginn des Einigungsprozesses
- 2. Verfassungsrechtliche Grundlagen für die deutsche Einheit
- 2.1 Die Optionen in der Diskussion
- 3. Die Volkskammerwahl vom 18. März 1990
- 3.1 Die Ergebnisse der Volkskammerwahl
- 4. Die Volkskammerwahl: Eine Abwahl der DDR und die Entscheidung für Art. 23 GG?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verfassungsrechtlichen Aspekte der deutschen Wiedervereinigung, insbesondere die Frage, ob die Wiedervereinigung nach Artikel 23 oder Artikel 146 des Grundgesetzes erfolgen sollte. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 bei der Entscheidungsfindung. Die Arbeit analysiert die Entwicklungen in der DDR im Jahr 1989, die verfassungsrechtlichen Optionen und die Ergebnisse der Volkskammerwahl, um zu beurteilen, ob diese Wahl ein Votum für den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 GG darstellte.
- Entwicklungen in der DDR im Jahr 1989
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Wiedervereinigung (Art. 23 GG vs. Art. 146 GG)
- Analyse der Volkskammerwahl vom 18. März 1990
- Die Rolle der öffentlichen Meinung bei der Entscheidungsfindung
- Bewertung der Wahl als Votum für Art. 23 GG
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Wiedervereinigung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der verfassungsrechtlichen Grundlage und der Rolle der Volkskammerwahl 1990 dar. Sie skizziert den Ablauf der Arbeit und benennt die verwendeten Quellen, die vorwiegend auf zeitgenössischen Analysen und historischen Darstellungen der Ereignisse von 1989/90 basieren. Der Fokus liegt auf der verfassungsrechtlichen Debatte um Art. 23 und Art. 146 GG und der Frage, ob die Volkskammerwahl ein eindeutiges Votum für eine schnelle Vereinigung nach Art. 23 GG darstellte. Die Einleitung legt den Grundstein für die detaillierte Untersuchung der nachfolgenden Kapitel.
1. Die Entwicklungen in der DDR im Jahr 1989: Dieses Kapitel beschreibt den politischen und gesellschaftlichen Kontext der DDR im Jahr 1989. Es beleuchtet den zunehmenden Druck auf das SED-Regime durch Massenflucht, Demonstrationen und interne Konflikte innerhalb der Partei. Der Fall der Mauer am 9. November 1989 wird als Höhepunkt der Ereignisse dargestellt, der den Weg zur Wiedervereinigung ebnete. Die Analyse stützt sich auf statistische Daten zur Unzufriedenheit der Bevölkerung und beschreibt die wachsende Sehnsucht nach Veränderung und Einheit mit der Bundesrepublik Deutschland. Die Kapitel analysiert die Ursachen der Krise und den wachsenden Unmut in der Bevölkerung, welcher durch die Fluchtbewegung, ökonomische Probleme und den Mangel an Reformen verstärkt wurde. Die Öffnung der ungarischen Grenze im Mai 1989 wird als wichtiger Katalysator für die Ereignisse des Jahres 1989 hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Deutsche Wiedervereinigung, Artikel 23 GG, Artikel 146 GG, Volkskammerwahl 1990, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Transformationsprozess, Wende, öffentliche Meinung, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Verfassungsrechtliche Aspekte der Deutschen Wiedervereinigung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit den verfassungsrechtlichen Aspekten der deutschen Wiedervereinigung. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Wiedervereinigung auf Basis von Artikel 23 oder Artikel 146 des Grundgesetzes erfolgte und welche Rolle die Volkskammerwahl vom 18. März 1990 dabei spielte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklungen in der DDR im Jahr 1989, die verfassungsrechtlichen Optionen (Art. 23 GG vs. Art. 146 GG), die Ergebnisse der Volkskammerwahl vom 18. März 1990 und die öffentliche Meinung. Ein zentrales Thema ist die Bewertung der Volkskammerwahl als Votum für einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gemäß Artikel 23 GG.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zu den Entwicklungen in der DDR 1989, ein Kapitel zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen der Wiedervereinigung, ein Kapitel zur Volkskammerwahl 1990 und ein Schlusskapitel (implizit). Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Forschungsfrage.
Wie wird die Volkskammerwahl vom 18. März 1990 bewertet?
Die Arbeit untersucht, ob die Volkskammerwahl als ein eindeutiges Votum für die Vereinigung nach Artikel 23 GG interpretiert werden kann. Dies erfolgt durch die Analyse der Wahlergebnisse und des politischen Kontextes.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf zeitgenössischen Analysen und historischen Darstellungen der Ereignisse von 1989/90. Der Fokus liegt auf der verfassungsrechtlichen Debatte um Art. 23 und Art. 146 GG.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Wiedervereinigung, Artikel 23 GG, Artikel 146 GG, Volkskammerwahl 1990, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Transformationsprozess, Wende, öffentliche Meinung, Verfassungsrecht.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche verfassungsrechtliche Grundlage hatte die Wiedervereinigung, und welche Rolle spielte die Volkskammerwahl 1990 bei der Entscheidungsfindung?
Welche Rolle spielte die öffentliche Meinung?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Entscheidungsfindung im Prozess der Wiedervereinigung.
Wie wird der Fall der Berliner Mauer dargestellt?
Der Fall der Mauer am 9. November 1989 wird als ein entscheidender Wendepunkt dargestellt, der den Weg zur Wiedervereinigung ebnete.
Welche Aspekte der Entwicklungen in der DDR im Jahr 1989 werden hervorgehoben?
Die Arbeit hebt den zunehmenden Druck auf das SED-Regime durch Massenflucht, Demonstrationen und interne Konflikte hervor. Die Öffnung der ungarischen Grenze wird als wichtiger Katalysator genannt.
- Arbeit zitieren
- Jan Richter (Autor:in), 2006, 'Die Wiedervereinigung nach Art. 23GG oder Art. 146GG? Welche Rolle spielte die Volkskammerwahl am 18. März 1990 bei der Entscheidungsfindung' , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68422