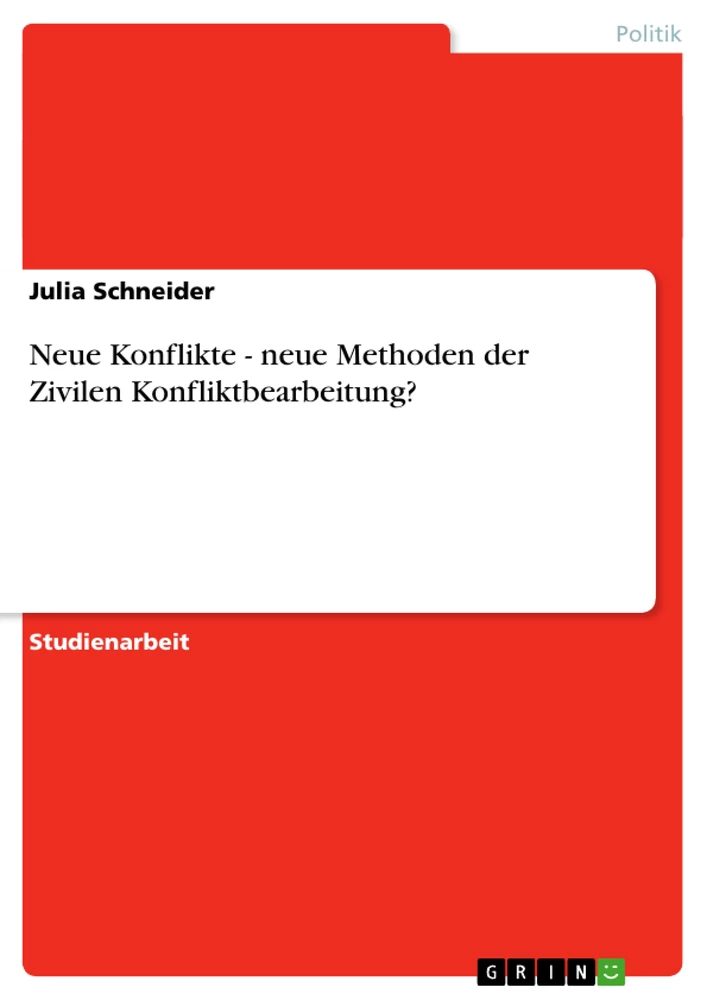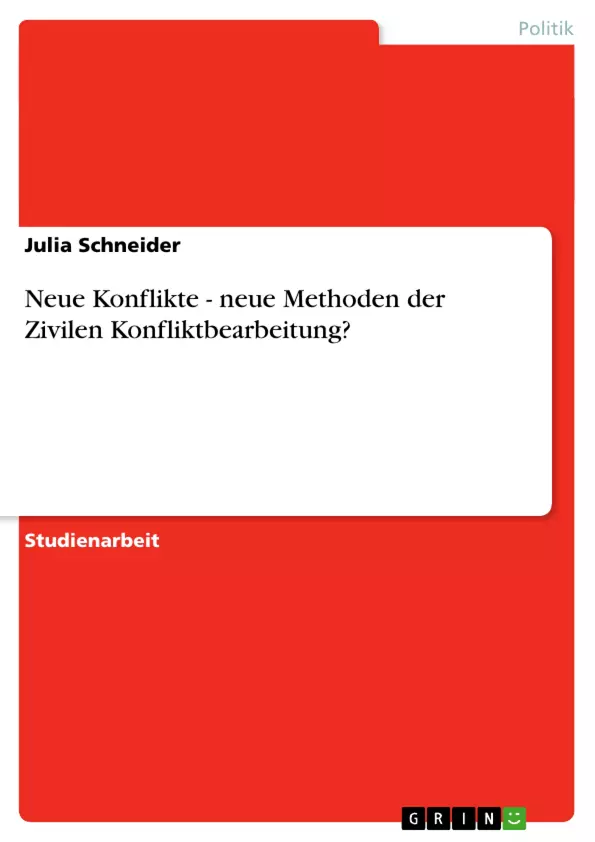Mit Ende des Ost-West-Konfliktes, der über Jahre das prägende Element der internationalen Beziehungen war, entstand die Hoffnung auf eine zukünftige friedliche Welt. Bald schon stellte sich aber heraus, dass es keine friedliche Entwicklung geben werde. Stattdessen sind seit dem Auseinanderbrechen der relativ großen Stabilität durch die „Pattsituation“ der beiden Großmächte, verschärft Konflikte aufgetreten. Auffällig ist dabei, dass sich die Art der Konflikte geändert zu haben scheint. Oft handelt es sich nicht mehr um Auseinandersetzungen zwischen Staaten, sondern um Konflikte innerhalb einer Gesellschaft. 1 Die Zunahme neuer Kriege und ihre lange Dauer führte dazu, dass es immer mehr „Konfliktherde“ auf der Welt gibt. 2 Einher damit ging die Notwendigkeit neuer Überlegungen zur Konfliktbearbeitung. Darunter versteht man Methoden, mit denen versucht wird, die Beziehungen von gegensätzlichen Gruppen zu verändern, die Gesellschaft umzustrukturieren und die Beilegung des Konfliktes möglich zu machen. Heute wird dafür oft der Begriff „Konflikttransformation“ benutzt. 3 Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entstanden, schienen die traditionellen Methoden für die Neuartigkeit der aktuellen Konflikte nicht mehr ausreichend geeignet zu sein. Darum wurden seit Anfang der 90er Jahre immer mehr neue Theorien entwickelt. Unumstritten ist dabei nicht einmal der grundsätzliche Sinn der Zivilen Konfliktbearbeitung. So sagen beispielsweise radikale Stimmen, die Konfliktbearbeitung versöhne Interessen, die nicht versöhnt werden sollen. Auch der Vorwurf, Zivile Konfliktbearbeitung sei zu weich und unwirksam, wird immer wieder laut. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wesen neuer Konflikte
- Partikularistische Politik der Identität
- Kriegsführung und Wirtschaft
- Schwierigkeiten bei der Lösung Neuer Konflikte
- Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung
- Methoden auf der staatlichen Ebene
- Klassische Vermittlungsdiplomatie
- Staaten und Internationale Organisationen als Vermittler
- Bedingungen für den Erfolg der Mediation
- Nutzen der klassischen Vermittlungsdiplomatie für die Lösung neuer Konflikte
- Zivile Konfliktbearbeitung auf gesellschaftlicher Ebene
- Track-Two-Diplomacy
- Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und ihr Beitrag zur Konfliktbearbeitung
- Problemlösungs-Workshops
- Nutzen für die Lösung neuer Konflikte
- Methoden auf der staatlichen Ebene
- Integrative Ansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, welche Formen der Konfliktbearbeitung es gibt und inwiefern diese für die Lösung neuer Konflikte geeignet sind. Sie analysiert die Merkmale neuer Konflikte, untersucht die klassischen Methoden der Konfliktbearbeitung auf staatlicher Ebene und betrachtet anschließend die gesellschaftlichen Formen der Konfliktbearbeitung. Abschließend werden neuere, umfassende Ansätze vorgestellt, die für die Lösung von neuen Konflikten besonders relevant erscheinen.
- Die Charakteristika neuer Konflikte
- Klassische Methoden der Konfliktbearbeitung auf staatlicher Ebene
- Gesellschaftliche Formen der Konfliktbearbeitung
- Neuere, integrative Ansätze zur Konfliktlösung
- Die Eignung verschiedener Methoden für die Bewältigung neuer Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Wandel in der internationalen Politik nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und die Entstehung neuer Konflikte. Sie definiert den Begriff der „Konflikttransformation“ und stellt die Notwendigkeit neuer Überlegungen zur Konfliktbearbeitung heraus.
Das Kapitel „Das Wesen neuer Konflikte“ analysiert die Merkmale neuer Konflikte, insbesondere den Aspekt der asymmetrischen Konflikte, in denen eine Seite weitaus schwächer ist als die andere. Hier werden auch Konzepte wie die „Partikularistische Politik der Identität“ und die Frage der Kriegsführung und Wirtschaft im Kontext neuer Konflikte beleuchtet.
Im Kapitel „Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung“ werden sowohl klassische Methoden auf staatlicher Ebene, wie z.B. die Vermittlungsdiplomatie, als auch gesellschaftliche Formen der Konfliktbearbeitung, wie z.B. Track-Two-Diplomacy und die Rolle von NGOs, behandelt.
Das Kapitel „Integrative Ansätze“ widmet sich umfassenden Ansätzen zur Konfliktlösung, die besonders relevant für die Bewältigung neuer Konflikte erscheinen.
Schlüsselwörter
Zivile Konfliktbearbeitung, neue Konflikte, Konflikttransformation, asymmetrische Konflikte, Partikularistische Politik der Identität, klassische Vermittlungsdiplomatie, Track-Two-Diplomacy, NGOs, integrative Ansätze
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Neue Konflikte"?
Nach dem Kalten Krieg sind Konflikte oft nicht mehr zwischen Staaten, sondern innerhalb von Gesellschaften (innerstaatlich) und asymmetrisch geprägt.
Was bedeutet Zivile Konfliktbearbeitung?
Es sind Methoden, die versuchen, Beziehungen zwischen gegensätzlichen Gruppen zu verändern und eine gesellschaftliche Umstrukturierung ohne Gewalt zu ermöglichen.
Was ist "Track-Two-Diplomacy"?
Dies bezeichnet inoffizielle, gesellschaftliche Dialoge und Vermittlungen, oft durch NGOs oder Experten, parallel zur staatlichen Diplomatie.
Welche Rolle spielen NGOs bei der Konfliktlösung?
Nichtregierungsorganisationen leisten Beiträge auf gesellschaftlicher Ebene, z.B. durch Problemlösungs-Workshops und Friedensförderung vor Ort.
Sind klassische Vermittlungsmethoden noch zeitgemäß?
Die Arbeit untersucht, ob klassische Diplomatie für die Neuartigkeit aktueller Konflikte ausreicht oder durch integrative Ansätze ergänzt werden muss.
- Quote paper
- Magister Artium Julia Schneider (Author), 2002, Neue Konflikte - neue Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68459