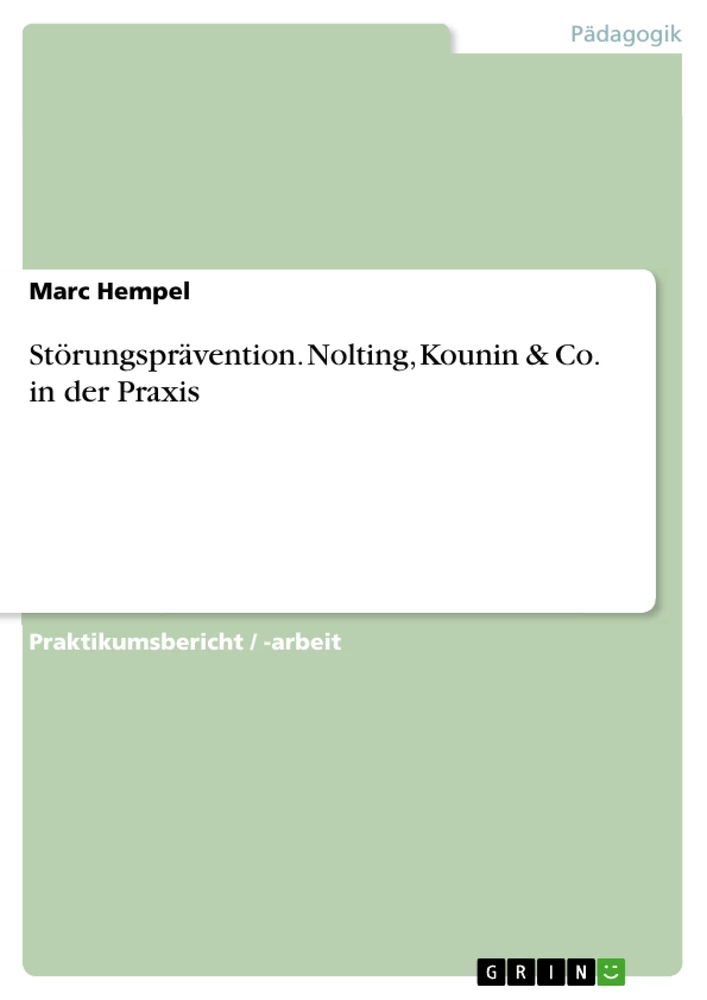Die schlechten Resultate deutscher Schüler in den Pisa-Studien haben zu einer verstärkten öffentlichen Diskussion über Qualität und Effizienz des Unterrichts geführt. Fragt man Lehrer, was eine Qualitätssteigerung behindere, so werden als Ursache häufig inadäquates, destruktives Schülerverhalten, mangelnde Lernmotivation und Desinteresse am Unterrichtsstoff als Ursachen genannt. Erstaunlicherweise machen aber auch die Schüler selbst Unterrichtsstörungen für mangelnde Konzentration und geringen Lernerfolg verantwortlich.
Aus dieser Unzufriedenheit aller am Unterrichtsgeschehen Beteiligten resultieren Frustration und Motivationsverlust bei Lehrkräften, die sich ihrerseits wieder negativ auf Unterrichtsplanung und -durchführung niederschlagen – letztendlich ein Teufelskreis.
Während meines Vorbereitungsseminars zum orientierenden Schulpraktikum gestaltete ich eine Unterrichtsstunde über Noltings Theorien zur Störungsprävention. Aufgrund seiner Thesen fasste ich während meines Praktikums den Entschluss, zunächst einmal eine bei den Lehrern „berüchtigte“ 10. Klasse einen Tag lang in unterschiedlichen Fächern zu begleiten und stellte schlussfolgernd fest, dass der von Nolting beschriebene Kausalzusammenhang zwischen Lehrerverhalten und Schülerverhalten klar auszumachen ist. Dieselbe Lerngruppe reagierte stark unterschiedlich auf die verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten und ihre Unterrichtsmethoden. Während Lehrer A gezielt und in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre unterrichtete, gelang es Lehrer B weder die Schüler zu disziplinieren, noch einen nachvollziehbaren allgemeinen Lernfortschritt zu erreichen. Auch in den anderen von mir beobachteten Unterrichtsstunden fiel auf, dass Lehrerverhalten und Schülerverhalten korrelierten.
Interessanterweise blockten einige auf diese Feststellung angesprochene Lehrer den Gedankenaustausch ab, wohingegen andere, vornehmlich diejenigen mit geringen Disziplinproblemen, sich auf eine engagierte Diskussion einließen.
Aufgrund der Unterrichtshospitationen und der geführten Gespräche mit Schülern und Lehrern gelangte ich insgesamt zu der Erkenntnis, dass Störungsprävention ein zentrales Mittel zur Sicherung von Qualität und Effizienz des Unterrichtes ist.
Ziel dieser Arbeit ist es nunmehr, konkrete Methoden und Strategien, die Störungen entgegenwirken, herauszustellen, wobei ich mich insbesondere auf die vier von Hans-Peter Nolting in seinem Buch „Störungen in der Schulklasse“ vorgestellten Aspekte beziehen werde.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Stundenübersicht des orientierenden Schulpraktikums
- Einleitung
- Störungen im Schulalltag
- Störungsreaktion
- Die Alternative - Störungsprävention
- Breite Aktivierung
- Unterrichtsfluss
- Klare Regeln
- Präsenz- und Stoppsignale
- Weitere wirksame Methoden
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Störungsprävention im Unterricht und analysiert die Ursachen und Folgen von Störungen im Schulalltag. Ziel ist es, konkrete Methoden und Strategien zu identifizieren, die Störungen entgegenwirken und die Qualität und Effizienz des Unterrichts verbessern können.
- Analyse von Störungen im Schulalltag
- Die Bedeutung von Störungsprävention für den Lernerfolg
- Methoden und Strategien zur effektiven Störungsprävention
- Der Einfluss von Lehrerverhalten auf das Schülerverhalten
- Zusammenhang zwischen Störungsprävention und Unterrichtsqualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Stundenübersicht des orientierenden Schulpraktikums: Dieser Abschnitt bietet einen detaillierten Einblick in die Stundenplanungen des Praktikums, die die verschiedenen Fächer und Klassenstufen umfasst.
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Störungen im Schulalltag dar und beleuchtet die Folgen für Lehrer, Schüler und den Lernerfolg. Sie führt die Diskussion über die Bedeutung von Störungsprävention und die Motivation für die vorliegende Arbeit ein.
- Störungen im Schulalltag: Dieser Abschnitt betrachtet verschiedene Aspekte von Störungen, einschließlich der Reaktionen von Lehrkräften auf störendes Schülerverhalten. Er analysiert die Herausforderungen und die Notwendigkeit von Präventionsstrategien.
- Die Alternative - Störungsprävention: Dieser Abschnitt stellt die Theorie der Störungsprävention von Hans-Peter Nolting vor und beschreibt wichtige Aspekte wie die Breite Aktivierung, den Unterrichtsfluss, klare Regeln und die Verwendung von Präsenz- und Stoppsignalen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Störungsprävention, Unterrichtsstörungen, Schülerverhalten, Lehrerverhalten, Qualität des Unterrichts, Effizienz des Unterrichts, Breite Aktivierung, Unterrichtsfluss, Klare Regeln, Präsenz- und Stoppsignale, Hans-Peter Nolting. Diese Begriffe bilden die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit, die sich mit der Verbesserung des Unterrichtsgeschehens durch die Vermeidung und Prävention von Störungen auseinandersetzt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Störungsprävention im Unterricht?
Störungsprävention umfasst alle Maßnahmen einer Lehrkraft, die darauf abzielen, Unterrichtsstörungen bereits im Vorfeld zu vermeiden, anstatt nur darauf zu reagieren.
Welche Rolle spielt Hans-Peter Nolting in diesem Kontext?
Nolting liefert mit seinem Werk „Störungen in der Schulklasse“ zentrale theoretische Ansätze zur Prävention, wie z. B. den Unterrichtsfluss und die breite Aktivierung.
Wie beeinflusst das Lehrerverhalten das Schülerverhalten?
Es besteht ein klarer Kausalzusammenhang: Eine strukturierte, präsente Lehrkraft fördert eine angenehme Arbeitsatmosphäre und reduziert Disziplinprobleme der Schüler.
Was sind wirksame Methoden zur Vermeidung von Störungen?
Dazu gehören ein reibungsloser Unterrichtsfluss, klare Regeln, die breite Aktivierung aller Schüler sowie der Einsatz von Präsenz- und Stoppsignalen.
Warum ist Störungsprävention wichtig für die Unterrichtsqualität?
Weniger Störungen bedeuten eine höhere Konzentration und einen besseren Lernerfolg für die Schüler, was die allgemeine Effizienz des Unterrichts steigert.
- Arbeit zitieren
- Marc Hempel (Autor:in), 2006, Störungsprävention. Nolting, Kounin & Co. in der Praxis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68470