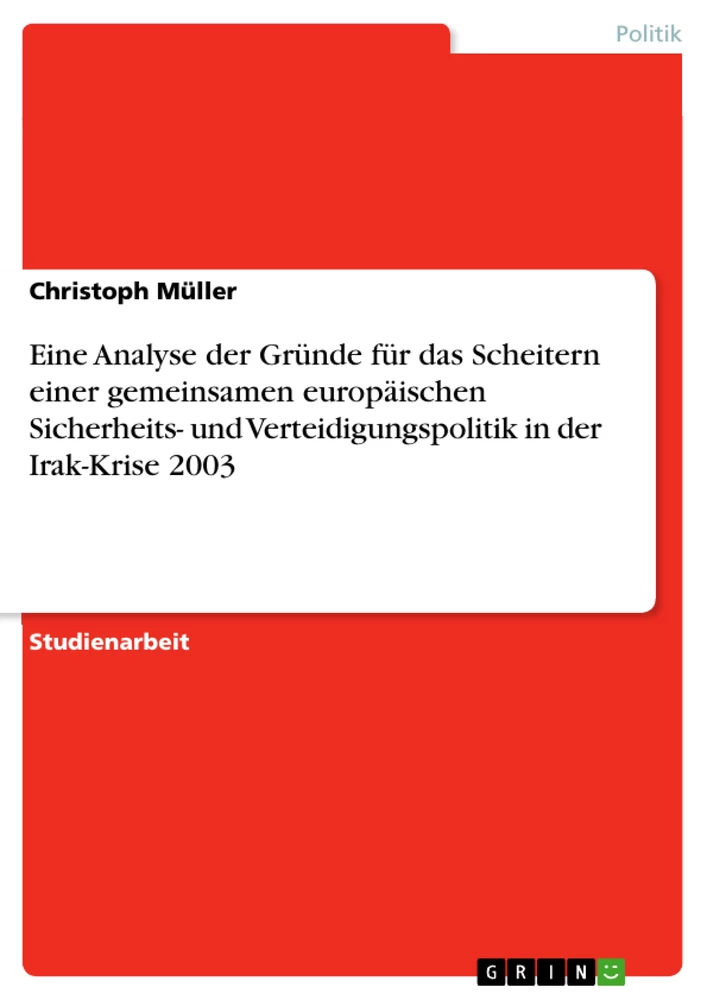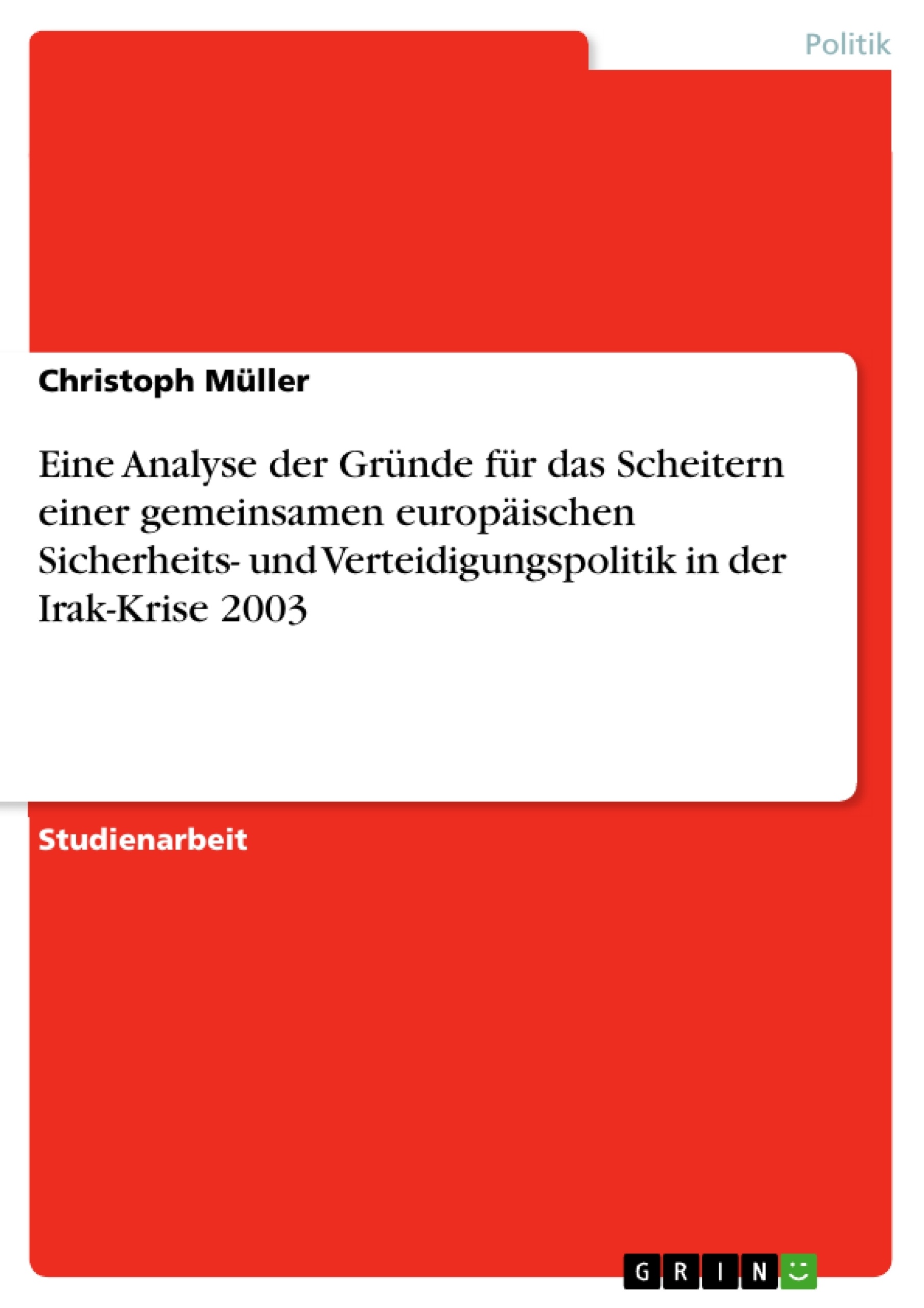Der Krieg im Irak 2003 hat gezeigt, dass die EU noch weit von einer tatsächlichen Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik entfernt ist. Anstatt sich auf eine gemeinsame Position in der Frage der Unterstützung der Strategie der Vereinigten Staaten zu einigen, führten eigenmächtige Reaktionen einzelner europäischer Staaten zur Bildung von Interessenkoalitionen innerhalb der EU und damit zur Spaltung derselben, die rhetorisch in der Benennung eines „neuen“ und eines „alten“ Europas durch den US-amerikanischen Außenminister, Donald Rumsfeld, kulminierte.
Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Faktoren dazu geführt haben, dass die Mitgliedsstaaten der EU sowie die Beitrittskandidaten Mittel- und Osteuropas sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten. Hierzu wird zunächst die These, dass es nicht zu einer Zusammenarbeit der europäischen Staaten kam, hinterfragt und präzisiert. Ein Rückblick auf das traditionelle außenpolitische Verhalten einiger europäischer Staaten (im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei Großbritannien und Deutschland) soll zeigen, welcher Logik Außenpolitik in diesen Staaten bislang gefolgt ist. Der bisherigen, nationalstaatlichen Außenpolitik wird das visionäre und ehrgeizige Ziel einer Vertiefung im Bereich der GASP und der ESVP des EU-Verfassungsvertrags gegenüber gestellt.
Ein besonderes Interesse dieser Arbeit gilt dem Verhalten der Bundesrepublik Deutschland in der Irak-Frage. Es wird die These aufgestellt, dass sich mit dem doppelten Nein zu einem Krieg im Irak ein Wandel in der deutschen Außenpolitik vollzogen hat, dessen Ursachen genauer zu untersuchen sind. Drei Faktoren werden dabei schwerpunktmäßig behandelt: 1. die Vergrößerung der politisch-ideologischen Differenzen zwischen den Regierungen Bush und Schröder, 2. ein Wandel des deutschen Selbstbewusstseins nach der Wiedervereinigung, der dazu geführt hat, dass Deutschland wieder als eigenständiger außepolitischer Akteur wahrgenommen werden will und 3. die seit dem Ende des Kalten Krieges und mit den Anschlägen vom 11. September weltweit veränderte sicherheitspolitische Lage.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Zwischen Tradition und Aufbruch
- 2.1 Der Irak-Krieg 2003 - Eine „Stunde Null“ der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik?
- 2.2 Traditionelle außenpolitische Tendenzen europäischer Staaten
- 3. Die Außenpolitik des wiedervereinigten Deutschlands
- 3.1 Das doppelte Nein als „deutscher Weg“
- 3.2 Neue außenpolitische Ambitionen der „Berliner Republik“?
- 4. Feindbild islamistischer Terrorismus
- 4.1 Die neue internationale Bedrohungslage nach dem 11. September 2001
- 4.2 Unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung der Bedrohungslage in den west- und osteuropäischen Staaten
- 5. Das „neue“ und das „alte Europa“
- 5.1 Die besonderen Sicherheitsbedürfnisse der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten
- 5.2 Die Problematik des deutsch-französischen Führungsanspruchs in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Gründe für das Scheitern einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Irak-Krise 2003. Sie untersucht, welche Faktoren dazu führten, dass sich die Mitgliedsstaaten der EU sowie die Beitrittskandidaten Mittel- und Osteuropas nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnten. Die Arbeit beleuchtet insbesondere das Verhalten Deutschlands in der Irak-Frage und analysiert die Rolle des deutschen Selbstbewusstseins nach der Wiedervereinigung sowie die Auswirkungen der neuen internationalen Bedrohungslage nach dem 11. September 2001.
- Die Rolle traditioneller außenpolitischer Tendenzen europäischer Staaten
- Die Entwicklung der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung
- Die Auswirkungen des islamistischen Terrorismus auf die europäische Sicherheitslage
- Die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten
- Die Herausforderungen der deutsch-französischen Führungsrolle in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den Hintergrund der Irak-Krise 2003 sowie die Bedeutung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das zweite Kapitel untersucht die traditionellen außenpolitischen Tendenzen europäischer Staaten und analysiert die Rolle des „neuen“ und „alten“ Europa. Das dritte Kapitel fokussiert auf die deutsche Außenpolitik nach der Wiedervereinigung und beleuchtet die Auswirkungen des „doppelten Nein“ auf die deutsche Rolle in der Irak-Krise. Das vierte Kapitel behandelt die Auswirkungen des islamistischen Terrorismus auf die internationale Sicherheitslage und analysiert die unterschiedliche Wahrnehmung der Bedrohungslage in den west- und osteuropäischen Staaten. Das fünfte Kapitel untersucht die besonderen Sicherheitsbedürfnisse der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten und beleuchtet die Problematik des deutsch-französischen Führungsanspruchs in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Irak-Krise, europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, deutsche Außenpolitik, Islamistischer Terrorismus, „neues“ und „altes“ Europa, Sicherheitsbedürfnisse der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten, deutsch-französischer Führungsanspruch.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte eine gemeinsame EU-Position in der Irak-Krise 2003?
Eigenmächtige Reaktionen einzelner Staaten und unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse führten zur Spaltung in ein „neues“ und ein „altes“ Europa, was eine einheitliche GASP verhinderte.
Was bedeutete das „doppelte Nein“ für die deutsche Außenpolitik?
Es markierte einen Wandel hin zu einem selbstbewussteren, eigenständigen „deutschen Weg“ unter Kanzler Schröder, der sich gegen die Kriegspläne der USA stellte.
Was ist der Unterschied zwischen dem „neuen“ und dem „alten Europa“?
Der Begriff (geprägt von Donald Rumsfeld) trennte die kriegskritischen Staaten wie Deutschland und Frankreich („alt“) von den USA-unterstützenden osteuropäischen Beitrittskandidaten („neu“).
Welche Rolle spielte der 11. September für die europäische Sicherheitspolitik?
Die Anschläge veränderten die weltweite Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus, führten jedoch innerhalb der EU zu unterschiedlichen Bewertungen der notwendigen militärischen Konsequenzen.
Warum war der deutsch-französische Führungsanspruch problematisch?
Viele kleinere und osteuropäische Staaten fühlten sich durch die dominante Haltung Deutschlands und Frankreichs übergangen, was das Vertrauen in eine gemeinsame ESVP schwächte.
- Citar trabajo
- M.A. Christoph Müller (Autor), 2004, Eine Analyse der Gründe für das Scheitern einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Irak-Krise 2003, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68581