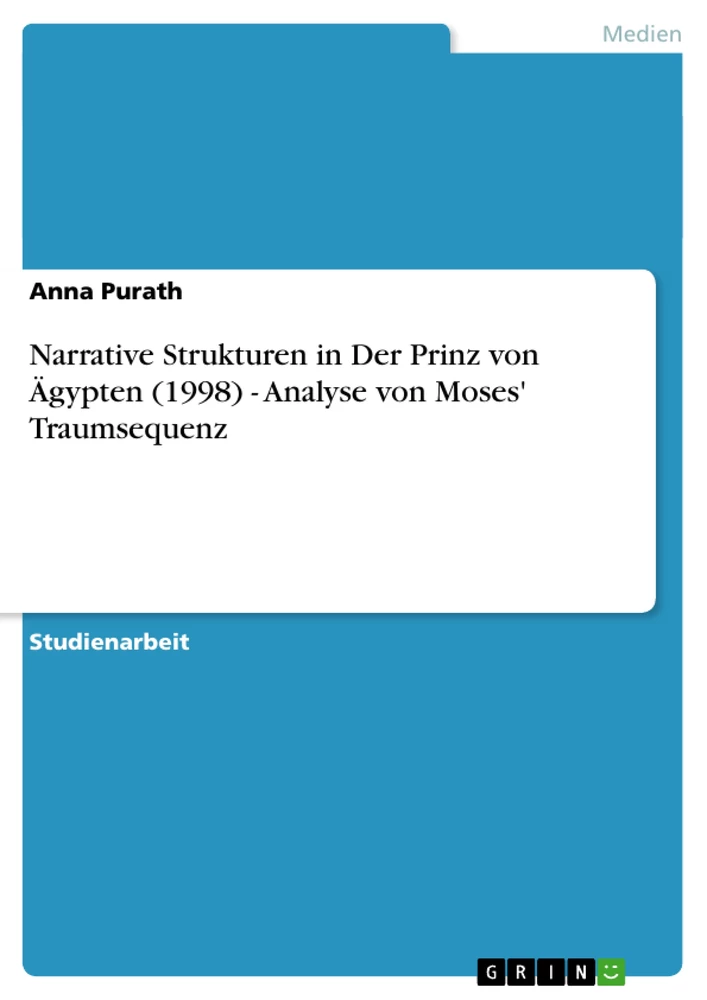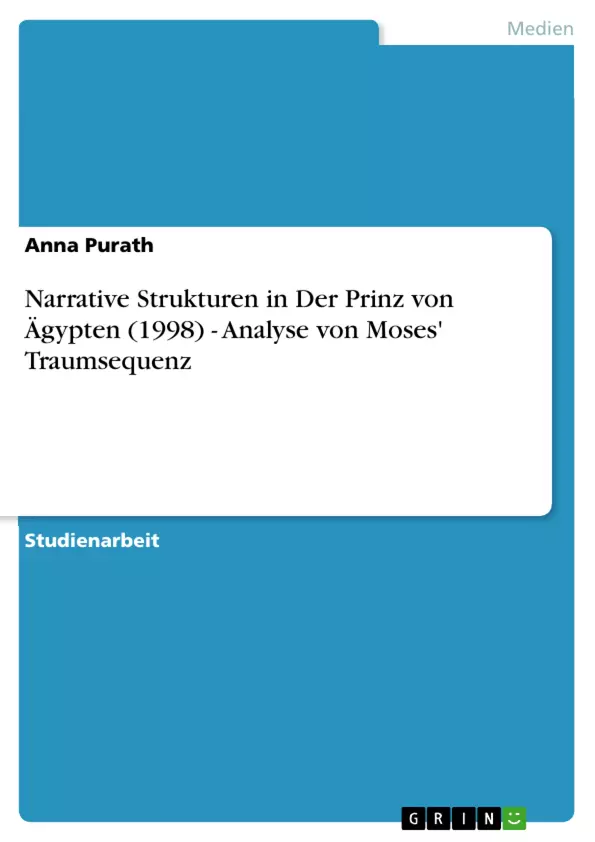In dem Film "Der Prinz von Ägypten" wird die biblische Geschichte
von Moses erzählt, der die Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft
befreit und ins Gelobte Land ihrer Vorfahren zurückführt.
Während in der Sklavenstadt auf Befehl des Pharao alle
neugeborenen Jungen der Hebräer von ägyptischen Soldaten getötet
werden, versucht eine Mutter ihrem Sohn das Leben zu retten, indem sie
ihn in einem Weidenkorb im Fluß aussetzt. Die Gemahlin des Pharao findet
den Kleinen am Ufer, adoptiert ihn und nennt ihn Moses. So wächst er im
Königspalast als Prinz von Ägypten und Bruder des Thronfolgers Ramses
auf, ohne je von seiner Adoption zu erfahren. Als erwachsener Mann trifft
er auf seine Schwester Miriam, die ihm von seiner wahren Herkunft erzählt,
aber er glaubt ihr nicht. Allein das Lied, welches sie anstimmt, weckt in
ihm eine leise Erinnerung - es ist das Lied seiner Mutter, das sie zum
Abschied sang, als sie ihn in den Korb legte. Verwirrt von diesem
Zusammentreffen kehrt er nach Hause zurück, in seinen Palast, schläft ein
und träumt von dem Kindermord und von seiner Rettung.
Diese etwa 2-minütige Traumsequenz soll Gegenstand
nachfolgender Analyse sein. Untersucht wird die narrative Methode und
insbesondere, wie die Traumsequenz Vergangenes aufgreift, um auf
Zukünftiges vorauszuweisen. Bestimmte formale Lösungen spielen für die
Narration eine tragende Rolle, so z. B., daß der Traum in Form einer
animierten ägyptischen Wandmalerei erzählt wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand
- Die Narration in Moses' Traumsequenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Traumsequenz in "Der Prinz von Ägypten" (1998), um die narrative Methode zu untersuchen, insbesondere wie die Sequenz Vergangenes aufgreift und auf Zukünftiges vorausweist. Die Analyse konzentriert sich auf die formalen Elemente der Sequenz, die die Narration tragen, wie z. B. die Darstellung des Traums in Form einer animierten ägyptischen Wandmalerei.
- Analyse der narrativen Methode in der Traumsequenz
- Die Verwendung von formalen Elementen, um die Geschichte zu erzählen
- Die Rolle des Traums bei der Enthüllung von Moses' wahrer Herkunft
- Die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Narration
- Die symbolische Bedeutung der Wandmalerei
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Film "Der Prinz von Ägypten" und die biblische Geschichte von Moses vor. Sie führt die Traumsequenz als den Gegenstand der Analyse ein.
- Die Kapitelüberschrift "Die Narration in Moses' Traumsequenz" beschreibt die Traumsequenz als eine rasante, schnittintensive Sequenz, die den Kindermord an den Sklaven und Moses' Rettung darstellt. Die Kapitel analysiert die narrative Methode der Sequenz, wobei die Verwendung formaler Elemente wie Musik, Bildsprache und Schnitte hervorgehoben werden. Es beschreibt auch, wie die Sequenz auf die zukünftige Entwicklung von Moses anspielt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Analyse sind: Narration, Traumsequenz, Wandmalerei, Vergangenes, Zukünftiges, Formale Elemente, Moses, Kindermord, Rettung, ägyptische Geschichte, Symbolismus, biblische Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Moses' Traumsequenz?
Die Arbeit untersucht die narrative Methode der etwa zweiminütigen Traumsequenz im Film "Der Prinz von Ägypten".
Warum wird der Traum als ägyptische Wandmalerei dargestellt?
Dies ist eine formale Lösung, um die Geschichte Moses' Herkunft und den Kindermord stilistisch und narrativ wirkungsvoll zu vermitteln.
Welche Rolle spielt die Musik in der Sequenz?
Das Lied der Mutter weckt Moses' Erinnerung und dient als emotionaler Auslöser für den Traum und die Erkenntnis seiner wahren Herkunft.
Wie verbindet der Traum Vergangenheit und Zukunft?
Der Traum greift den vergangenen Kindermord auf, um auf Moses' zukünftige Rolle als Befreier der Israeliten vorauszuweisen.
Was sind die zentralen formalen Elemente der Analyse?
Die Bildsprache der Wandmalerei, die Schnittintensität, die Musik und der Einsatz von Symbolismus.
Wann wurde der Film "Der Prinz von Ägypten" veröffentlicht?
Der Zeichentrickfilm von DreamWorks kam im Jahr 1998 in die Kinos.
- Quote paper
- Anna Purath (Author), 2000, Narrative Strukturen in Der Prinz von Ägypten (1998) - Analyse von Moses' Traumsequenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6860