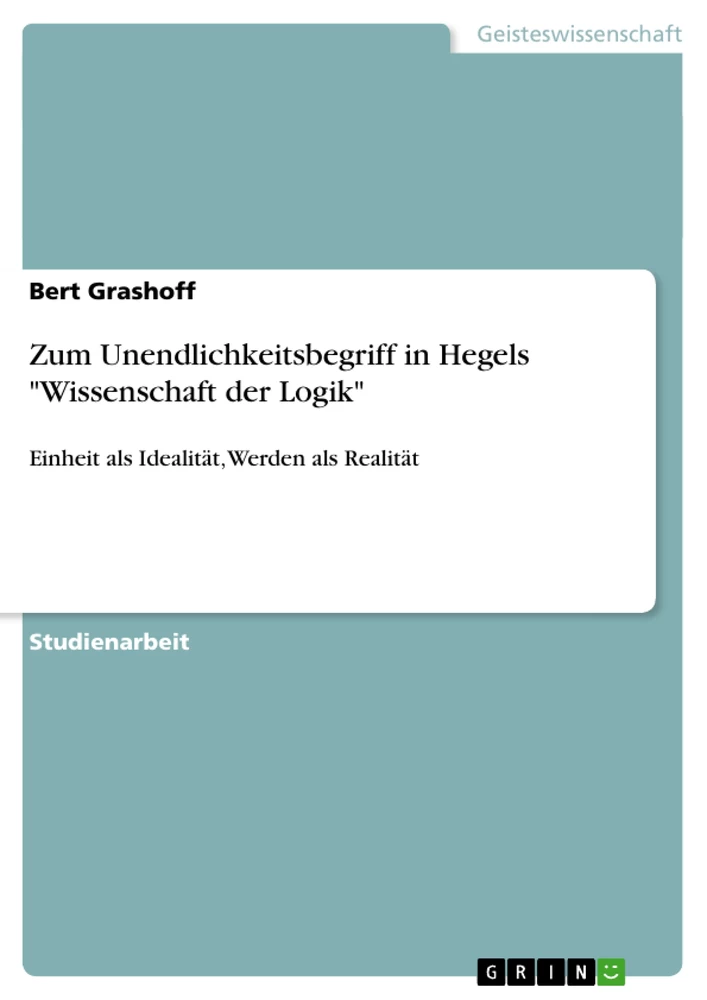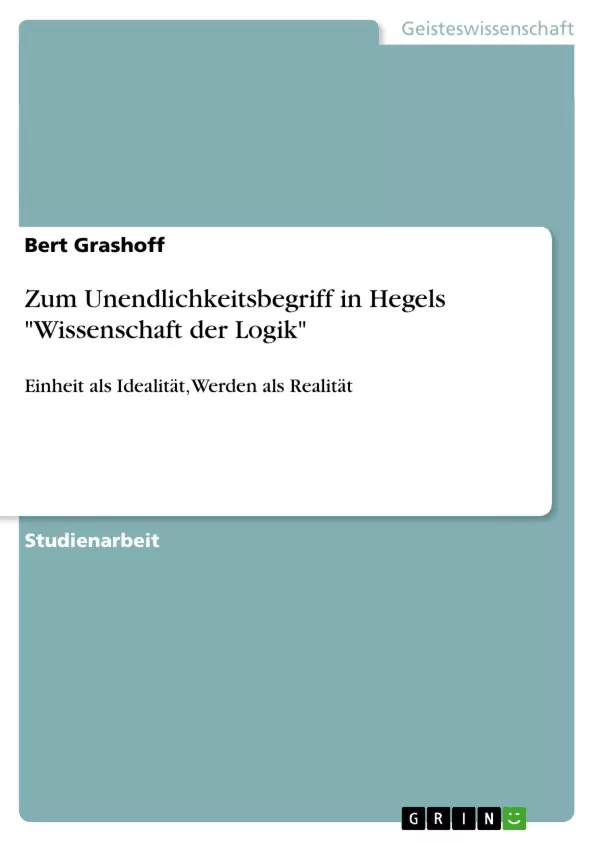Georg Wilhelm Friedrich Hegel überarbeitete seine Logik immer wieder. Der erste Teil des dreiteiligen Werks der Wissenschaft der Logik, die objektive Logik oder Seinslogik erfuhr 1832 seine letzte Form. Hegel kam nicht mehr dazu, auch die 1807 zuletzt veröffentlichte subjektive Logik, bestehend aus der Wesenslogik und der Begriffslogik, erneut zu bearbeiten.
Der dunkle Monolog der Wissenschaft der Logik stellt Hegels Hauptwerk und eines der wichtigsten Werke des deutschen Idealismus dar. Noch heute ist die Interpretation des Textes mühsam und umstritten. Kennzeichnend für den tief in die sprachliche Konstitution unseres Weltwissens eindringenden Textes ist die dialektische Auffassung jedes Gedankens und jeder Stilllegung eines Gedankens in einem Begriff. Alle Begriffe sind bei Hegel schillernd, dynamisch im Spannungsfeld ihrer Bedeutungen. Diese innere Dynamik der Begriffe lässt sie aus sich heraus und in andere Begriffe übergehen, wobei diese Übergänge im Hegelschen Verständnis strikt logisch sind. Hegel entwickelt so ein präzises und dichtes Netzwerk der philosophischen Begriffe. Doch seine Definitionen und inhaltlichen Verknüpfungen prägen noch heute weitgehend unbewusst auch die Alltagssprache.
Die 2003 von Bert Grashoff verfasste Hausarbeit stellt eine detaillierte Interpretation eines begrifflichen Übergangs innerhalb der Seinslogik dar, nämlich der vom Sein zum Fürsichsein. Sie setzt bei dem vielfältig schillernden Begriff der Grenze an und folgt der Entwicklung des Begriffspaars der Endlichkeit und Unendlichkeit. Hegel diskutiert dabei eingehend den Begriff der schlechten Unendlichkeit, den er überwindet. Inhaltlich kann diese schlechte Unendlichkeit vielfältig gedeutet werden, vom Zenon von Elea zugeschriebenen Paradoxons des Wettrennens zwischen Achill und der Schildkröte, das erst mit den modernen Grenzwerttheorien eine Auflösung fand, bis zu der aus Hegels Perspektive scheinbaren Unlösbarkeit der Theodizeefrage. Die letzte Station, die von der Hausarbeit verfolgt wird, ist die Entwicklung der Begriffe von Realität und Idealität. Das unendliche Dasein ist in seiner Unendlichkeit konkret geworden und damit zur Realität. Die schon im Begriff der Grenze angelegte Einheit von Etwas und Anderem im Denken erscheint nun als Einheit von Endlichem und Unendlichem wieder. Diese Einheit ist Idealität.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung.
- Selbstbewegung des Begriffs
- Reflexivität der Logik
- Einheit von Subjekt und Objekt
- Anfang und Resultat
- Kritik an Totalität
- I. Zum Begriff des Absoluten und seinem Verhältnis zur Unendlichkeit
- a) Die Eine Substanz bei Spinoza
- b) Konkrete Individualität muss mit dem Absoluten vermittelt sein
- c) Einheit stellt sich überhaupt erst durch die Reflexion auf Differenz her.
- d) Substanz ist Subjekt
- II. Die Argumentation im Unendlichkeitskapitel der „,Wissenschaft der Logik\".
- a) Endliches treibt zum Unendlichen
- b) Widersprüche in der Trennung des Endlichen vom Unendlichen: das Schlecht-Unendliche
- c) Die wahrhafte Unendlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Unendlichkeitsbegriff in Hegels „Wissenschaft der Logik“ und analysiert seine Bedeutung für die gesamte Hegelsche Philosophie. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Unendlichkeitsbegriffs in Hegels System, die Dialektik des Endlichen und Unendlichen sowie die Bedeutung der Einheit und Selbstbewegung des Begriffs.
- Der Unendlichkeitsbegriff in Hegels Philosophie
- Die Selbstbewegung des Begriffs
- Die Reflexivität der Logik
- Die Einheit von Subjekt und Objekt
- Die Dialektik des Endlichen und Unendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einführung stellt den Unendlichkeitsbegriff als einen wichtigen Faden im komplexen Gefüge der Hegelschen Philosophie vor. Es wird betont, dass die Untersuchung dieses Begriffs nur im Kontext des gesamten Systems Hegels sinnvoll ist.
I. Zum Begriff des Absoluten und seinem Verhältnis zur Unendlichkeit
Dieses Kapitel untersucht den Begriff des Absoluten und sein Verhältnis zur Unendlichkeit. Es werden verschiedene Positionen zum Absoluten und seiner Beziehung zur Unendlichkeit diskutiert, darunter die Ansichten von Spinoza. Ein wichtiges Thema ist die Rolle der Reflexion und Differenz für die Herausbildung von Einheit.
II. Die Argumentation im Unendlichkeitskapitel der „Wissenschaft der Logik“
Dieses Kapitel behandelt die Argumentationslinie des Unendlichkeitskapitels in der „Wissenschaft der Logik“. Es analysiert die Dialektik des Endlichen und Unendlichen, die Herausforderungen der Trennung von beiden Begriffen und die Konzeption der „wahrhaften Unendlichkeit“.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit zentralen Begriffen wie Unendlichkeit, Selbstbewegung, Reflexivität, Einheit, Subjekt, Objekt, Absolute, Spinoza, Endlichkeit, „Wissenschaft der Logik“ und Dialektik. Die Arbeit untersucht den Unendlichkeitsbegriff in Hegels Philosophie und seinen Zusammenhang mit der „wahrhaften Unendlichkeit“.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hegel unter der „schlechten Unendlichkeit“?
Ein unendlicher Progress, der nie zum Ziel kommt (wie eine endlose Zahlenreihe), den Hegel als bloßes Sollen ohne wirkliche Erfüllung kritisiert.
Was ist die „wahrhafte Unendlichkeit“?
Die Einheit von Endlichem und Unendlichem, die in sich selbst zurückkehrt und als in sich geschlossener Prozess (Kreis) gedacht wird.
Welche Rolle spielt die Dialektik in der „Wissenschaft der Logik“?
Die Dialektik beschreibt die Selbstbewegung des Begriffs, bei der ein Gedanke in sein Gegenteil umschlägt und in einer höheren Einheit aufgehoben wird.
Was bedeutet Hegels Satz „Substanz ist Subjekt“?
Dass das Absolute nicht starr ist, sondern als lebendiger, sich selbst erkennender Prozess (Geist) verstanden werden muss.
Wie hängen Grenze und Unendlichkeit zusammen?
Das Endliche ist durch seine Grenze definiert; indem es diese Grenze überschreitet, weist es über sich hinaus auf das Unendliche.
- Citation du texte
- Bert Grashoff (Auteur), 2003, Zum Unendlichkeitsbegriff in Hegels "Wissenschaft der Logik", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68661