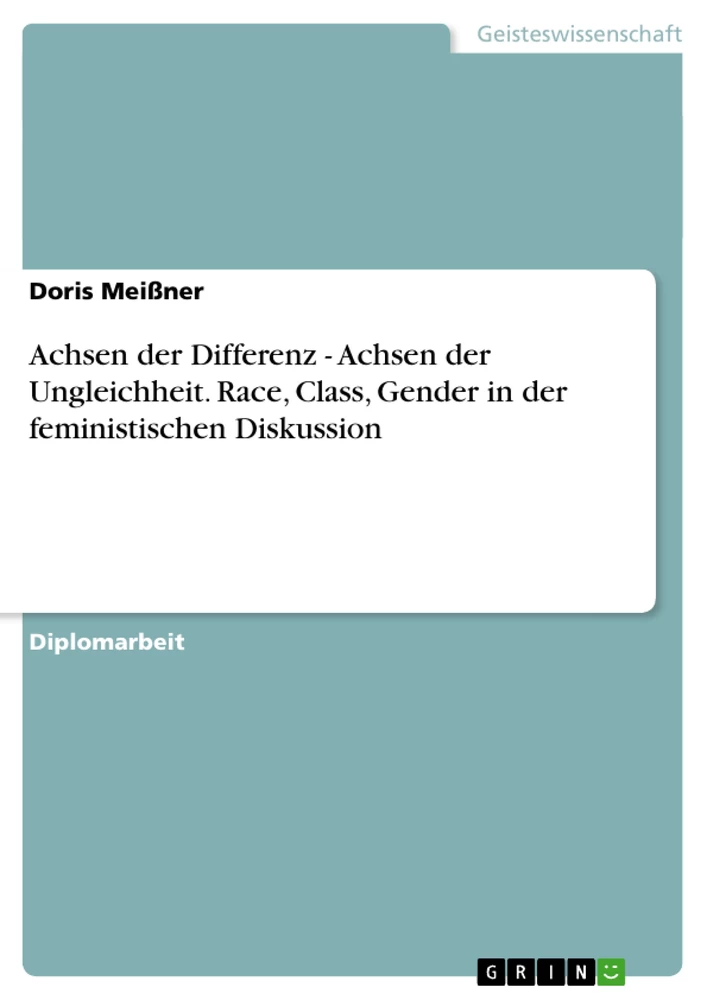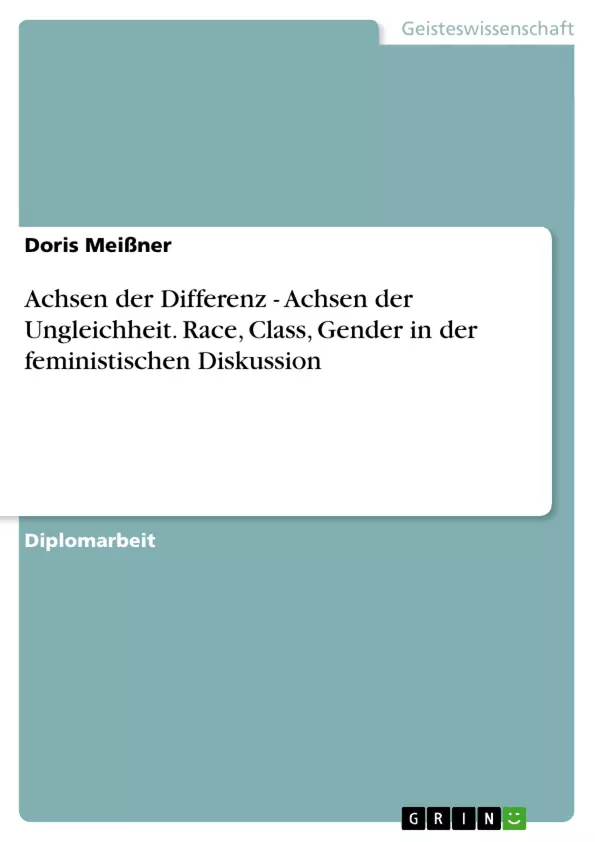Während meines Aufenthalts in Mexiko machte ich die Beobachtung, dass Arbeitgeber der exportorientierten Maquila-Industrie Personal v.a. nach dem Geschlecht und nach der ethnischen Zugehörigkeit in prekäre Arbeitsverhältnisse rekrutieren. Der Lohn wird im Süden Mexikos noch weiter nach unten gedrückt, da hier überwiegend Menschen indigener Gruppen leben und im ganzen Land ist der Faktor Geschlecht gleich auch ein Lohnfaktor. Frauen verdienen weniger für vergleichbare Arbeit. Im Norden Mexikos gibt es dieses Phänomen prekärer Arbeitsverhältnisse v.a. für Frauen, denn qualifiziertere und technische Tätigkeiten sind den Männern in der Maquila-Industrie „vorbehalten“. Die ungleiche Behandlung von Menschen wiederfährt Mexikanerinnen in ihrem eigenen Land aber auch in dem reichen Nachbarstaat der USA. Ähnlich werden eingewanderte „Gastarbeiterinnen“ oder Osteuropäerinnen in Deutschland diskriminiert. Aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und ihres Geschlechts werden sie in prekären niedrig entlohnten Arbeitsverhältnissen beschäftigt.
Auch wenn die Ungleichheiten zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern in ihren Extremen schwanken, zeigen sich diese Formen als weltweites Muster in vielen Beispielen. In Deutschland arbeiten osteuropäische Frauen als saisonale Erntehelferinnen, türkische und osteuropäische Frauen als Reinigungspersonal oder osteuropäische Männer in Fleischereifabriken jeweils unter schwierigen und ungesicherten Arbeitsverhältnissen. Weitere Beispiele gäbe es unzählige. Ethnische und geschlechtliche Differenzen transformieren sich in Form der Lohnhöhe und Qualität des Arbeitsverhältnisses zur sozialen Ungleichheit.
Die Ungleichheit, die sich in materiellen ökonomischen Formen manifestiert, wird von ideologischen Diskursen begleitet und gestützt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziele und Fragen
- 1.2 Die Kapitel im Überblick
- 2. Annäherung an den Intersectionality-Ansatz
- 2.1 Intersectionality - Eine Theorieperspektive zu Race, Class, Gender?
- 2.1.1 Was bedeutet Intersectionality?
- 2.1.2 Unterschiedliche theoretische Herangehensweisen und soziologische Ebenen
- 2.1.3 Terminologische Diskussion zu Race, Class, Gender
- 2.1.3.1 Race Rassismus und Sexismus
- 2.1.3.2 Ethnizität – Ethnische Gruppe - Nationaler Bezugsrahmen
- 2.1.3.3 Gender zwischen Differenz und Ungleichheit
- 2.1.3.4 Class – Klassische Ungleichheitsforschung – Gender and Class Debate
- 3. Black Feminist und Women of Color zu den Ursprüngen in den USA
- 3.1 Geschichtliche Rückblicke - Zeitliche Kontextualisierung
- 3.2 Auswahl von Autorinnenbeiträgen zum Intersectionality-Ansatz
- 3.2.1 Das Combahee River Collective: „neither solely racial nor solely sexual”
- 3.2.2 Patricia Hill Collins - Wissenschaftskritik schwarzer Forscherinnen
- 3.2.3 Kimberlé Crenshaw: Politik u. Rechtsprechung im Zeichen v. Intersectionality
- 3.4 Zusammenfassungen der „Autorinnenschau“ in den USA
- 4. Diskurse über Intersektionalität von Geschlecht und Ethnie in Deutschland
- 4.1 Intersectionality oder Multiaxialität in der deutschen Diskussion?
- 4.2 Auswahl der Autorinnenbeiträge: Nationalkonstruktion und „Gastarbeit“
- 4.2.1 FeMigra: Soziale Differenzen unter Frauen
- 4.2.2 Sedef Gümen: Nationalstaatlichkeit – „Ausblendung“ und „Besonderlichung“
- 4.2.3 Encarnación Gutiérrez Rodríguez: Postkoloniale Kritik u. Kontextualisierung
- 4.3 Zusammenfassungen der „Autorinnenschau“ in Deutschland
- 5. Zusammenschau: Felder der Rezeption von Race, Class, Gender
- 5.1 Themenkreise - Standpunkte und Perspektiven
- 5.1.1 US-amerikansiche Diskussion
- 5.1.2 Deutsche Diskussion
- 5.2 Lücken in der Intersectionality- Forschung
- 5.3 Weiterführendes und Fazit zur intersektionellen Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, die Entstehung und Entwicklung von sozialen Ungleichheiten nach Ethnie, Geschlecht und Klasse zu untersuchen. Sie analysiert, wie Diskriminierungen gleichzeitig über die ethnische Herkunft und die Geschlechtszugehörigkeit entstehen und welche Rolle die „deutsche Mehrheitsgesellschaft“ im Verhältnis zum scheinbar ethnisch „Differenten“ spielt.
- Intersectionality als Theorieperspektive und ihr Potenzial für die Analyse sozialer Ungleichheiten
- Die historischen und gegenwärtigen Diskurse über Race, Class, Gender in den USA und Deutschland
- Die Rolle von Black Feminist und Women of Color in der Entwicklung des Intersectionality-Ansatzes
- Die Bedeutung von Nationalkonstruktion und „Gastarbeit“ für die Intersektionalität von Geschlecht und Ethnie in Deutschland
- Die Lücken und Potenziale der Intersectionality-Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung und Entwicklung sozialer Ungleichheiten in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht und Klasse. Sie beleuchtet die Diskriminierungserfahrungen von Migrantinnen in Mexiko und Deutschland und verweist auf die Notwendigkeit einer Gesellschaftstheorie, die die Verknüpfung von Diskriminierungserfahrungen über verschiedene Kategorien hinweg erfasst.
Kapitel 2 beleuchtet den Intersectionality-Ansatz als Theorieperspektive und diskutiert verschiedene theoretische Herangehensweisen sowie soziologische Ebenen. Es befasst sich mit den Begriffen Race, Class und Gender, die zentrale Bedeutung für die Intersektionalität von Diskriminierungserfahrungen haben.
Kapitel 3 analysiert die Beiträge von Black Feminist und Women of Color in den USA, die entscheidende Impulse für die Entwicklung des Intersectionality-Ansatzes gegeben haben. Es stellt die Werke von Autorinnen wie dem Combahee River Collective, Patricia Hill Collins und Kimberlé Crenshaw vor, die unterschiedliche Facetten der Intersektionalität von Race, Class und Gender beleuchten.
Kapitel 4 untersucht den Diskurs über Intersektionalität in Deutschland. Es betrachtet die Beiträge von Autorinnen wie FeMigra, Sedef Gümen und Encarnación Gutiérrez Rodríguez, die sich mit Nationalkonstruktion, „Gastarbeit“ und postkolonialen Perspektiven auf die Intersektionalität von Geschlecht und Ethnie in Deutschland auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Intersectionality, Race, Class, Gender, Diskriminierung, soziale Ungleichheit, Nationalkonstruktion, „Gastarbeit“, Black Feminist, Women of Color, USA, Deutschland, Wissenschaftskritik, postkoloniale Kritik.
- Citar trabajo
- Dipl.-Sozialwiss. Doris Meißner (Autor), 2006, Achsen der Differenz - Achsen der Ungleichheit. Race, Class, Gender in der feministischen Diskussion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68688