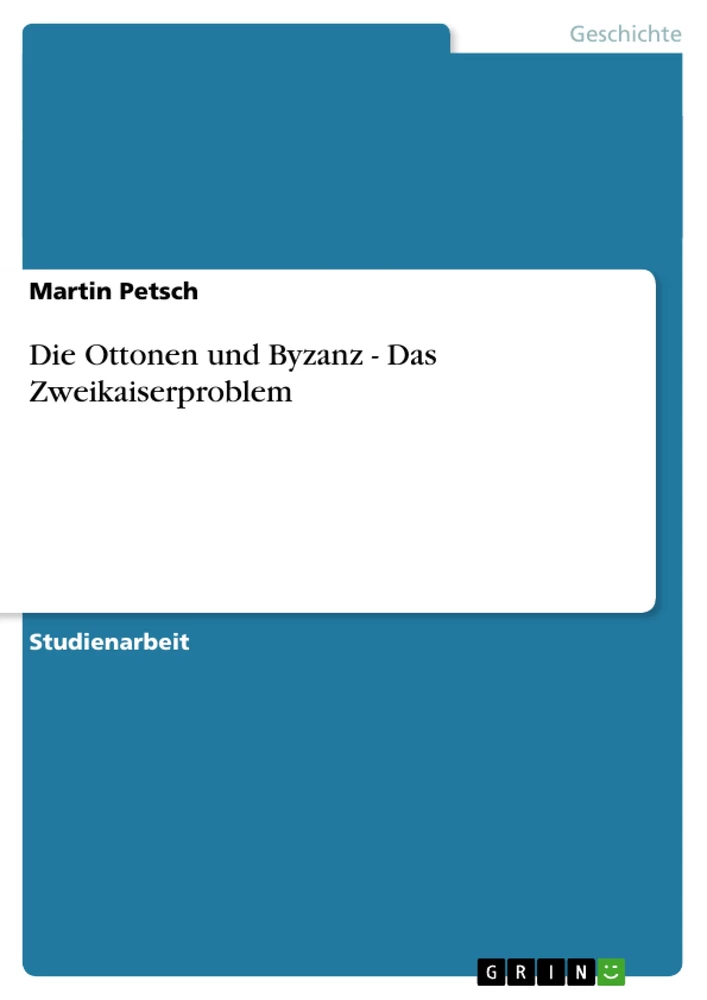Die Beschäftigung mit Byzanz und vor allem mit dessen Einfluss auf das westliche Kaisertum war im 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. Jh.s in der Geschichtswissenschaft ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Die westliche Kaiserpolitik wurde unter nationalistischen Gesichtspunkten, wie beispielsweise die Sybel-Fickersche Kontroverse zeigt, oder rein abendländischen Maßstäben bewertet, wie etwa der Dualismus von Papsttum und „deutschem“ Kaisertum. Der Aufschwung in der international betriebenen Byzantinistik nach dem Zweiten Weltkrieg bewirkte auch eine grundlegende Wandlung der Problemstellung in der deutschen Geschichtsschreibung. Nachdem man vertiefte Erkenntnisse von den Regierungsprinzipien des byzantinischen Reiches und von der oströmischen Kaiser- und Reichsidee sowie davon erlangt hatte, was Byzanz im Rahmen des weltgeschichtlichen Gesamtablaufs bedeutete, widmete sich die Forschung der Frage des politischen und kulturellen Einflusses des byzantinischen Reiches als universale Macht. Ein Durchbruch, vor allem hinsichtlich des zu bearbeitenden Themas, waren die Feststellungen von E. Stein von 1930 zum mittelalterlichen Titel „Kaiser der Römer“, aus denen hervorging, dass Byzanz Vorbild und Konkurrent des westlichen Kaisertums war. Dass sich der Westen seit dem Ende der Antike mit Byzanz auseinandersetzte, ist heute einheitliche Meinung der Mediävisten und Byzantinisten. In welchem Maße jedoch Byzanz für die Entwicklung des westlichen Kaisergedankens vorbildhaft war, ist bisher umstritten geblieben. Eine Betrachtung der Auseinandersetzung zwischen den Ottonen und den byzantinischen Kaisern im Rahmen des Zweikaiserproblems kann nur ein vollständiges Bild ergeben, wenn auch die byzantinische Staatsvorstellung als Voraussetzung des Konflikts sowie die Entwicklung des Zweikaiserproblems bis zu den Ottonen, also die Tradition, in der diese standen, geschildert wird. Daher sollen diese beiden Themenkomplexe vor einer Schilderung der ottonischen Byzanzpolitik dargestellt werden.
Die byzantinische Kaiseridee
Das byzantinische Staatsdenken gründete sich in der Überzeugung, dass das universale römische Reich die von Gott eingesetzte irdische staatliche Macht in der Welt war. Die göttliche Vorsehung hatte die diesseitige Welt, der orbis,durch den Kaiser Augustus zu diesem Weltreich zusammengefasst und so die Sicherung des höchsten irdischen Gutes, des Friedens und der Kultur, in die Hand eines einzigen gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die byzantinische Kaiseridee
- Wiederentstehung eines westlichen Kaisertums und Beginn des Zweikaiserproblems unter Karl dem Großen
- Das Ottonische Kaisertum in Auseinandersetzung mit Byzanz
- Otto I.
- Otto II. mit Exkurs Liudprand von Cremona
- Otto III.
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Zweikaiserproblem im Kontext der Beziehungen zwischen dem Ottonischen Reich und Byzanz. Sie beleuchtet die byzantinische Kaiseridee, die Wiederentstehung eines westlichen Kaisertums und die daraus resultierenden Konflikte. Die Analyse konzentriert sich auf die Regierungszeiten der Ottonen und deren politische Strategien gegenüber Byzanz.
- Die byzantinische Kaiseridee und ihr Universalitätsanspruch
- Die Wiederentstehung des westlichen Kaisertums und der Beginn des Zweikaiserproblems
- Die ottonische Kaiserpolitik gegenüber Byzanz
- Der Einfluss byzantinischer Traditionen auf das westliche Kaisertum
- Die Rolle von Persönlichkeiten wie Liudprand von Cremona
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert den Forschungsstand zum Thema Byzanz und dessen Einfluss auf das westliche Kaisertum, insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie hebt die Bedeutung der nach dem Zweiten Weltkrieg aufkommenden Byzantinistik hervor und betont die geänderte Perspektive auf die westliche Kaiserpolitik, weg von nationalistischen oder abendländischen Sichtweisen hin zu einer Betrachtung des politischen und kulturellen Einflusses des byzantinischen Reiches. Die Arbeit selbst zielt auf eine umfassende Darstellung der Auseinandersetzung zwischen den Ottonen und Byzanz im Kontext des Zweikaiserproblems ab, indem sie die byzantinische Staatsvorstellung und die Entwicklung des Zweikaiserproblems bis zu den Ottonen beleuchtet.
Die byzantinische Kaiseridee: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlage des byzantinischen Staatsdenkens: die Überzeugung von der Universalität des römischen Reiches als gottgewollte irdische Macht. Es erläutert die Kontinuität des römischen Imperiums, dessen Verlagerung nach Osten und die fortschreitende Gräzisierung ohne Verlust des römischen Staatsgedankens. Die Verknüpfung der römischen Tradition mit dem christlichen Glauben wird hervorgehoben, wobei der Kaiser als Stellvertreter Christi auf Erden und oberster Herr der Kirche, des Heeres und des Rechts dargestellt wird. Byzanz betrachtet weitere Kaiser als Usurpatoren, obwohl politische Kompromisse in der Praxis vorkamen.
Wiederentstehung eines westlichen Kaisertums und Beginn des Zweikaiserproblems unter Karl dem Großen: Dieses Kapitel behandelt das Ende des weströmischen Kaisertums und die Fortführung der römischen Tradition durch das oströmische Reich. Es beschreibt die Versuche von Byzanz, Einfluss auf die westlichen Königreiche auszuüben, und die geistige Orientierung der germanischen Reiche am römischen Reich in Byzanz. Die Errichtung eines westlichen Kaisertums wird als Herausforderung für den byzantinischen Universalitätsanspruch dargestellt, was den Beginn des Zweikaiserproblems markiert.
Schlüsselwörter
Byzanz, Ottonen, Zweikaiserproblem, Kaiseridee, westliches Kaisertum, Liudprand von Cremona, römisches Reich, Universalitätsanspruch, Staatsdenken, Christentum, Politik, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen: Das Zweikaiserproblem im Kontext der Beziehungen zwischen dem Ottonischen Reich und Byzanz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Zweikaiserproblem im Kontext der Beziehungen zwischen dem Ottonischen Reich und Byzanz. Sie beleuchtet die byzantinische Kaiseridee, die Wiederentstehung eines westlichen Kaisertums und die daraus resultierenden Konflikte, konzentriert sich auf die Regierungszeiten der Ottonen und deren politische Strategien gegenüber Byzanz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die byzantinische Kaiseridee und ihren Universalitätsanspruch, die Wiederentstehung des westlichen Kaisertums und den Beginn des Zweikaiserproblems, die ottonische Kaiserpolitik gegenüber Byzanz, den Einfluss byzantinischer Traditionen auf das westliche Kaisertum und die Rolle von Persönlichkeiten wie Liudprand von Cremona.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, der byzantinischen Kaiseridee, der Wiederentstehung eines westlichen Kaisertums und dem Beginn des Zweikaiserproblems unter Karl dem Großen, dem ottonischen Kaisertum in Auseinandersetzung mit Byzanz (unterteilt in Abschnitte zu Otto I., Otto II. mit einem Exkurs zu Liudprand von Cremona und Otto III.) und eine Schlussbemerkung.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung skizziert den Forschungsstand zum Thema Byzanz und dessen Einfluss auf das westliche Kaisertum, insbesondere im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie hebt die Bedeutung der nach dem Zweiten Weltkrieg aufkommenden Byzantinistik hervor und betont die geänderte Perspektive auf die westliche Kaiserpolitik, weg von nationalistischen oder abendländischen Sichtweisen hin zu einer Betrachtung des politischen und kulturellen Einflusses des byzantinischen Reiches. Die Arbeit selbst zielt auf eine umfassende Darstellung der Auseinandersetzung zwischen den Ottonen und Byzanz im Kontext des Zweikaiserproblems ab.
Wie wird die byzantinische Kaiseridee dargestellt?
Das Kapitel zur byzantinischen Kaiseridee beschreibt die Grundlage des byzantinischen Staatsdenkens: die Überzeugung von der Universalität des römischen Reiches als gottgewollte irdische Macht. Es erläutert die Kontinuität des römischen Imperiums, dessen Verlagerung nach Osten und die fortschreitende Gräzisierung ohne Verlust des römischen Staatsgedankens. Die Verknüpfung der römischen Tradition mit dem christlichen Glauben wird hervorgehoben, wobei der Kaiser als Stellvertreter Christi auf Erden und oberster Herr der Kirche, des Heeres und des Rechts dargestellt wird.
Wie wird die Wiederentstehung des westlichen Kaisertums behandelt?
Dieses Kapitel behandelt das Ende des weströmischen Kaisertums und die Fortführung der römischen Tradition durch das oströmische Reich. Es beschreibt die Versuche von Byzanz, Einfluss auf die westlichen Königreiche auszuüben, und die geistige Orientierung der germanischen Reiche am römischen Reich in Byzanz. Die Errichtung eines westlichen Kaisertums wird als Herausforderung für den byzantinischen Universalitätsanspruch dargestellt, was den Beginn des Zweikaiserproblems markiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind Byzanz, Ottonen, Zweikaiserproblem, Kaiseridee, westliches Kaisertum, Liudprand von Cremona, römisches Reich, Universalitätsanspruch, Staatsdenken, Christentum, Politik und Mittelalter.
- Quote paper
- Martin Petsch (Author), 2002, Die Ottonen und Byzanz - Das Zweikaiserproblem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68744