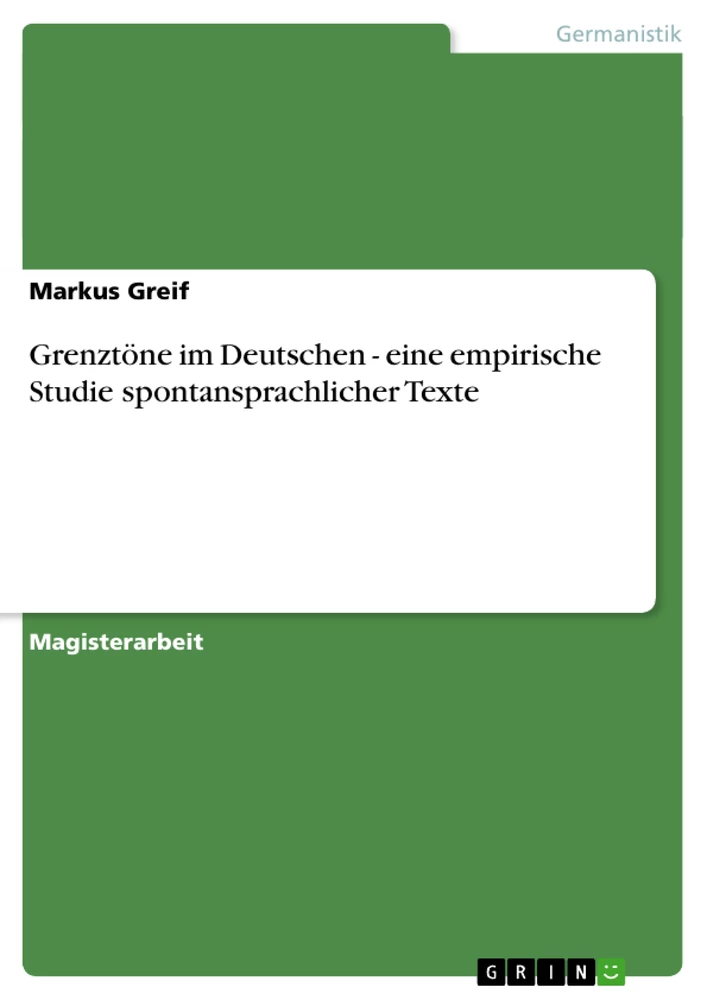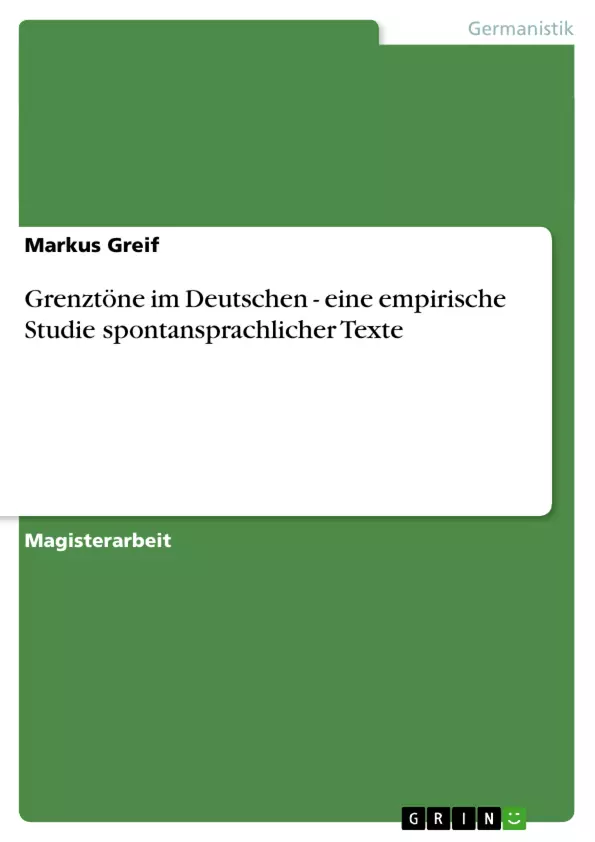Gesprochene Sprache wird vom Sprechenden in bestimmten Einheiten produziert. Diese Einheiten nimmt der Hörer aufgrund perzipierbarer prosodischer Signale als voneinander abgrenzbar und in sich kohärent wahr. Man bezeichnet diese Signale deshalb auch als Grenzsignale. Es sind in erster Linie intonatorische Phänomene wie Veränderungen im Tonhöhenverlauf und Variationen den Sprechrhythmus betreffend, die die Grenzsignale bilden. Aufgrund dieser Grenzsignale kann gesprochene Sprache in sogenannte Intonationsphrasen oder Intonationseinheiten segmentiert werden.
Eines der Grenzsignale, oder auch Segmentierungskriterien, ist die Veränderung der Tonhöhe auf einer unbetonten Silbe. Eine Tonhöhenbewegung auf einer unbetonten Silbe hat häufig zur Folge, dass man an dieser Stelle das Ende einer Äußerungseinheit empfindet. Eine daran angeschlossene Äußerung wird nicht mehr als zu dieser Einheit gehörig sondern als neuer, eigener Äußerungsabschnitt wahrgenommen. Der Tonhöhenanstieg auf einer solchen unbetonten Silbe kann als Grenzton – genauer, intonationsphrasenfinaler Grenzton – bezeichnet werden. Man nimmt dort die Grenze einer Intonationsphrase an. Intonationsphrasen können mit steigenden und absinkenden Grenztönen enden.
Die vorliegende Arbeit differenziert zwischen Intonationsphrasengrenzen mit jeweils unterschiedlichem finalen Tonhöhenverlauf und zeigt die Verteilung dieser Grenzen in einem spontansprachlichen Korpus narrativer Monologe des Deutschen. Es wird gezeigt, dass diese finalen Tonhöhenverläufe unterschiedlich erklärt werden können, wobei jedoch nur wenige dieser Erklärungsmodelle als endgültig empirisch nachgewiesen zu betrachten sind. Für einige tonale Konstellationen werden eigene Lösungsvorschläge gegeben, die auf den gängigen Modellen zur Beschreibung der Intonation im Deutschen - insbesondere das German ToBI - aufbauen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Konstitution von Intonationsphrasen in gesprochener Sprache
- Prosodie vs. Intonation
- Die Intonationsphrase
- Zu den Segmentierungskriterien
- Reset, Pause, Sprechtempo…...…….
- IP-finaler Grenzton...
- Weitere Segmentierungskriterien..
- Abbrüche und ambige IPen
- Autosegmental-Metrische Phonologie
- Die Grundannahmen der AM-Phonologie.....
- Zu den Unterschieden der AM-Modelle für das Deutsche.
- Intermediärphrase vs. IP.
- Einige AM-Modelle für das Deutsche im Vergleich
- Zur Verteilung der Grenztöne
- IPen mit spezifischen Grenztönen – H% vs. L%
- IPen mit unspezifischen Grenztönen.
- Gleichbleibende Grenztöne
- Grenzakzente...
- Zuordnungsprobleme bei den Grenztönen.
- Zur Verteilung von Abbrüchen und ambigen IPen …………………………………………
- IPen mit spezifischen Grenztönen – H% vs. L%
- Zusammenfassung..........\nLiteratur......\n...............\n..109\n.114\nAbbildungen und Tabellen.\n......\n.....\n116\nAbkürzungen und Symbole..\n-2-\n118
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verteilung von Grenztönen in spontansprachlichen narrativen Monologen des Deutschen. Sie analysiert die unterschiedlichen phonetischen Konstellationen von finalen Tonhöhenverläufen in Intonationsphrasen und diskutiert kritisch verschiedene Beschreibungsmodelle aus der Intonationsforschung. Ziel ist es, die empirische Verteilung von Grenztönen mit spezifischen und unspezifischen finalen Tonhöhenverläufen aufzuzeigen und zu analysieren, welche theoretischen Implikationen sich aus der empirischen Analyse ergeben.
- Die Segmentierung gesprochener Sprache in Intonationsphrasen und die Rolle von Grenztönen
- Die unterschiedlichen Ansätze zur Beschreibung von Intonationsphrasengrenzen
- Die Verteilung von spezifischen und unspezifischen Grenztönen in einem spontansprachlichen Korpus
- Die Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Grenztönen in bestimmten Fällen und die Entwicklung eines Lösungsvorschlags
- Die Charakterisierung von unterbrochenen Äußerungseinheiten und deren Abgrenzung von standardmäßig abgeschlossenen Intonationsphrasen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Grenztöne in gesprochener Sprache ein und erklärt die Bedeutung von Intonationsphrasen und deren Segmentierung anhand von Beispielen. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und die wichtigsten Punkte, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.
- Zur Konstitution von Intonationsphrasen in gesprochener Sprache: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Prosodie und Intonation und erklärt die Intonationsphrase als grundlegende prosodische Einheit. Es werden verschiedene Segmentierungskriterien für Intonationsphrasen vorgestellt, darunter Tonhöhenverläufe, Pausen und Sprechtempo. Außerdem werden Abbrüche und ambige Intonationsphrasen diskutiert.
- Autosegmental-Metrische Phonologie: Dieses Kapitel erläutert die Grundannahmen der Autosegmental-Metrischen Phonologie und stellt verschiedene Modelle für die Beschreibung der Intonation des Deutschen vor. Es beleuchtet die Unterschiede zwischen den Modellen und diskutiert ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
- Zur Verteilung der Grenztöne: In diesem Kapitel wird die empirische Verteilung von Grenztönen in einem spontansprachlichen Korpus analysiert. Es werden Intonationsphrasen mit spezifischen und unspezifischen finalen Tonhöhenverläufen unterschieden und ihre Verteilung im Korpus untersucht. Außerdem werden Probleme bei der Zuordnung von Grenztönen in bestimmten Fällen diskutiert und ein eigener Lösungsvorschlag präsentiert. Weiterhin werden unterbrochene Äußerungseinheiten von standardmäßig abgeschlossenen Intonationsphrasen abgegrenzt und in zwei Typen differenziert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die empirische Analyse von Grenztönen in gesprochener Sprache. Dabei werden wichtige Konzepte wie Intonationsphrasen, Segmentierungskriterien, spezifische und unspezifische Grenztöne, Abbrüche und ambige Intonationsphrasen sowie die Autosegmental-Metrische Phonologie untersucht. Die Untersuchung verwendet einen spontansprachlichen Korpus narrativer Monologe des Deutschen als Datengrundlage.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Grenztöne in der deutschen Sprache?
Grenztöne sind intonatorische Signale am Ende einer Äußerungseinheit (Intonationsphrase), die durch eine Veränderung der Tonhöhe auf einer unbetonten Silbe markiert werden und dem Hörer signalisieren, dass ein Abschnitt beendet ist.
Wie wird gesprochene Sprache segmentiert?
Die Segmentierung erfolgt in Intonationsphrasen (IP). Kriterien hierfür sind neben Grenztönen auch Pausen, Änderungen im Sprechtempo und der sogenannte Tonhöhen-Reset am Anfang einer neuen Phrase.
Was ist der Unterschied zwischen H% und L% Grenztönen?
H% steht für einen hohen (steigenden) Grenzton, der oft bei Fragen oder Unabgeschlossenheit auftritt. L% bezeichnet einen tiefen (fallenden) Grenzton, der meist das Ende einer Aussage markiert.
Was bedeutet „German ToBI“?
German ToBI (Tones and Break Indices) ist ein System zur standardisierten Umschrift und Beschreibung der Intonationsverläufe im Deutschen, das auf der autosegmental-metrischen Phonologie basiert.
Wie werden Abbrüche in der Spontansprache klassifiziert?
In der Forschung werden Abbrüche oft von regulär beendeten Phrasen unterschieden. Sie treten auf, wenn der Sprecher eine Einheit mitten im Wort oder Satz stoppt, oft ohne den typischen finalen Grenzton auszuführen.
- Citar trabajo
- Markus Greif (Autor), 2005, Grenztöne im Deutschen - eine empirische Studie spontansprachlicher Texte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68762