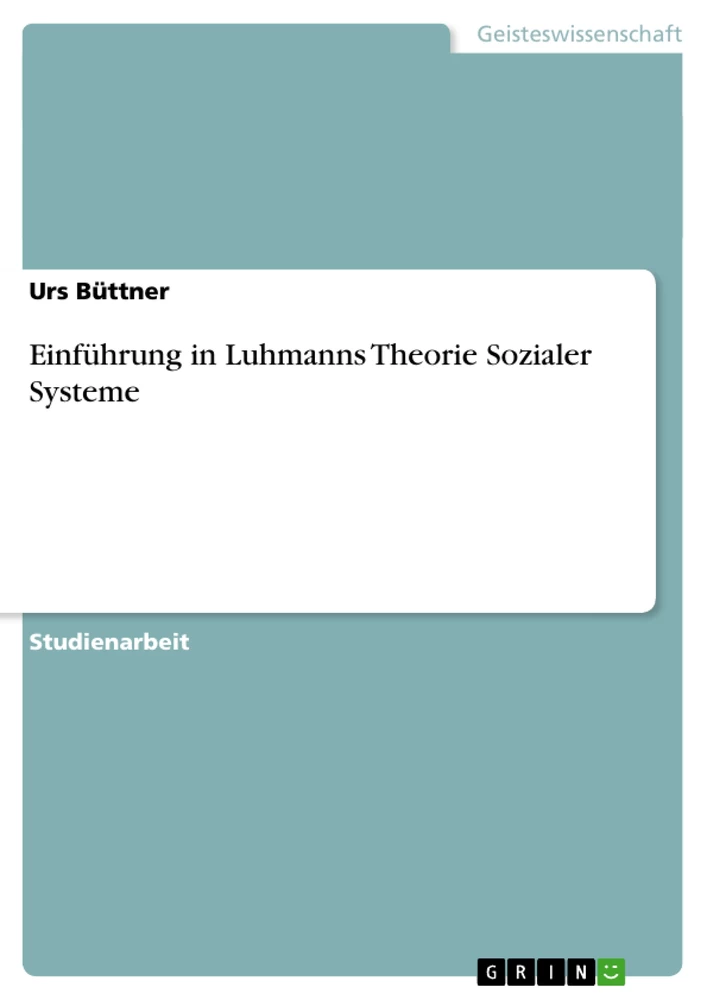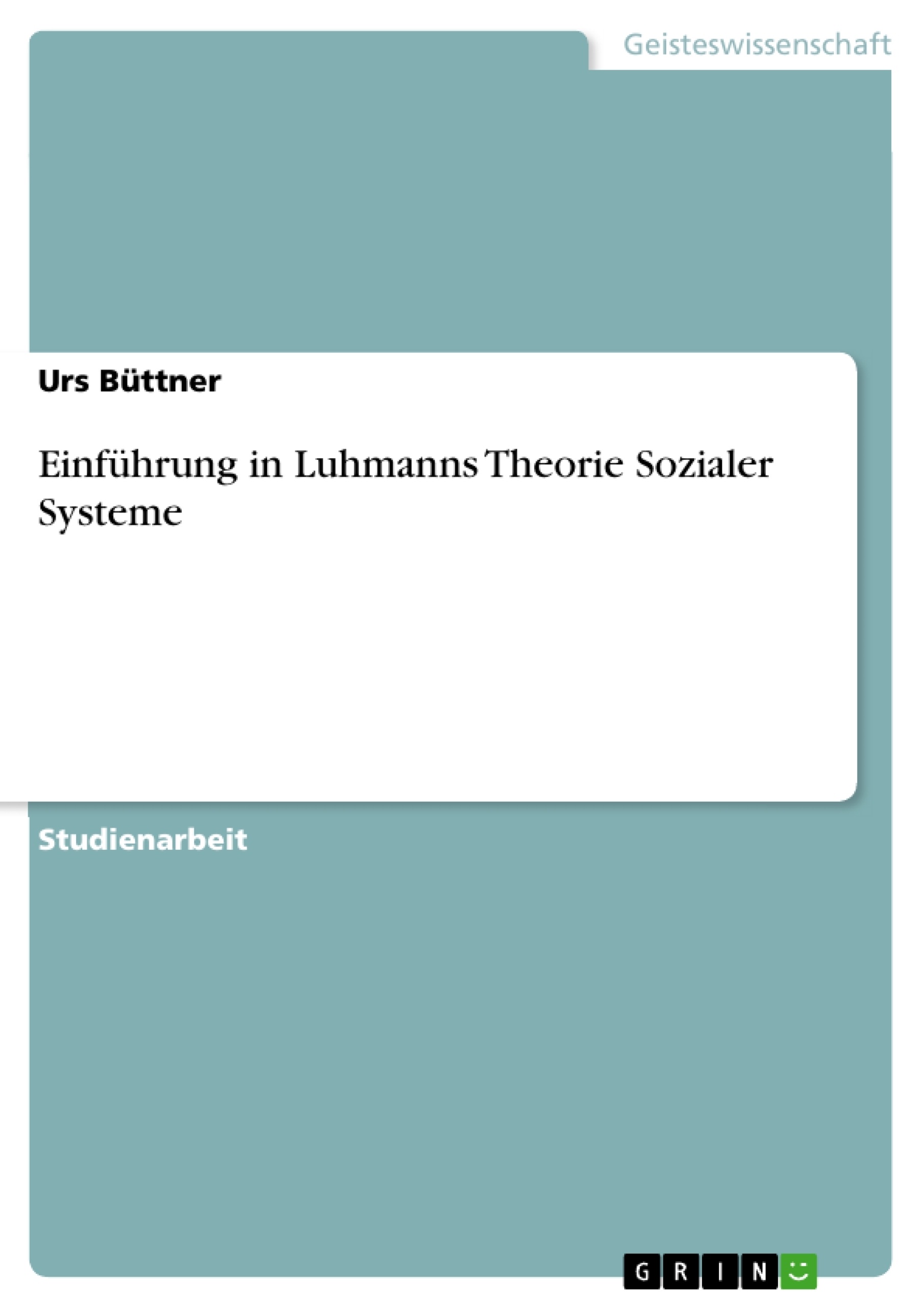Die Luhmanns Systemtheorie gilt neben Habermas’ Diskurstheorie momentan sicherlich als eine der wichtigsten makrosoziologischen Theorien. Luhmann hat Parsons handlungstheoreti-sche Systemtheorie, die in ihren Grundlagen noch auf Max Weber fußt, zu einer hochkomple-xen, ganz eigenen Kommunikationstheorie umgebaut. Von Parsons schlichtem Renaissance-bau hat Luhmann nur einige Mauern stehen gelassen. Sein Theoriebau hat die Mannigfaltig-keit des Barock. Luhmann hat seine Baumaterialen in vielen anderen Disziplinen zusammen-geklaubt. So hat er die Phänomenologie, den Konstruktivismus, die Kybernetik, die Semiotik u. v. m. in seine Theorie eingeschmolzen. Auch seine Begrifflichkeit hat er oft aus anderen Disziplinen entlehnt, so „Autopoiesis“ aus der Biologie, „Differenz“ aus Logik und „Medien“ aus der Psychologie.
Dieses komplexe Theoriegebäude bildet in sich ein eigenes Sprachspiel. Das erschwert den Zugang zu dieser Theorie ungemein. Will man einen Begriff erläutern, muss man dazu wieder zwei Begriffe verwenden, die man auch erst wieder erläutern muss mit weiteren Begrif-fen...usw.
Eine weitere Schwierigkeit bei der Annäherung an diese Theorie ist die Größe des Gegens-tandsbereichs, den sie erklären möchte. Die Systemtheorie „reklamiert für sich nie: Wider-spiegelung der kompletten Realität des Gegenstandes. Auch nicht: Ausschöpfung aller Mög-lichkeiten der Erkenntnis des Gegenstandes. Daher auch nicht: Ausschließlichkeit des Wahr-heitsanspruchs im Verhältnis zu anderen, konkurrierenden Theorieunternehmungen. Wohl aber: Universalität der Gegenstandserfassung in dem Sinne, dass sie als soziologische Theo-rie alles Soziale behandelt und nicht nur Ausschnitte (wie z.B. Schichtung, Mobilität, Beson-derheiten der modernen Gesellschaft, Interaktionsmuster etc.).“
In Folge dieser Schwierigkeiten muss klar sein, dass meine Arbeit nicht den Anspruch haben kann, die Luhmann’sche Theorie umfassend und en Detail darzustellen. Wer diesen Anspruch verfolgt, ist mit den zwei Bänden „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ und ihren knapp 1150 Seiten als Lektüre besser bedient. Hier kann ich nur in einige Grundbegriffe einführen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Hintergründe der Theorie
- System und Umwelt
- Sinnsysteme
- Beziehungen von Systemen zur Umwelt
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit bietet eine Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann und stellt die grundlegenden Konzepte und Argumentationen vor.
- Die Unterscheidung von System und Umwelt
- Der Begriff der Autopoiesis und die Selbststeuerung von Systemen
- Die Bedeutung von Codes und Programmen für die Funktion von Systemen
- Die Unterscheidung von verschiedenen Sinnsystemen
- Die Beziehung von Systemen zur Umwelt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hintergründe der Theorie
Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die Entwicklung der Luhmannschen Systemtheorie, die von Parsons' Handlungstheorie ausgeht und sich zu einer eigenständigen Kommunikationstheorie entwickelt hat. Es wird auf die Komplexität der Theorie sowie die Schwierigkeit des Zugangs hingewiesen. Des Weiteren wird die Universalität des Gegenstandsbereiches der Theorie betont und die Grenzen dieser Arbeit im Hinblick auf eine vollständige Darstellung der Theorie erläutert.
2. System und Umwelt
Das zentrale Konzept der Systemtheorie, die Differenz zwischen System und Umwelt, wird in diesem Kapitel eingeführt. Es wird erläutert, dass es nicht die Umwelt an sich gibt, sondern immer nur die Umwelt im Bezug auf ein bestimmtes System. Systeme konstituieren sich durch auf einander bezogene Operationen, die durch einen spezifischen Code definiert werden. Alles, was sich nicht in diesem Code fassen lässt, ist Systemumwelt. Die Autopoiesis von Systemen wird mit dem Beispiel des Wirtschaftssystems erläutert, das sich durch die fortlaufende Rekursion von Geldzahlungen selbst steuert.
3. Sinnsysteme
In diesem Kapitel wird die Unterscheidung von verschiedenen Sinnsystemen beleuchtet. Es wird deutlich gemacht, dass die Luhmannsche Theorie nicht antihumanistisch ist, sondern den Menschen als Bedingung der Möglichkeit von Systemen betrachtet. Menschen agieren in verschiedenen Systemen, sind aber selbst keine Systeme, sondern bestehen aus Systemen (Bewusstsein, Kreislauf, Zellen etc.).
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und zentralen Themen der Arbeit sind: Systemtheorie, Niklas Luhmann, System, Umwelt, Autopoiesis, Code, Programm, Sinnsystem, Kommunikation, Selbststeuerung, Komplexität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Konzept von Luhmanns Systemtheorie?
Das zentrale Konzept ist die Differenz zwischen System und Umwelt. Ein System konstituiert sich durch auf einander bezogene Operationen, die es von seiner Umwelt abgrenzen.
Was bedeutet der Begriff Autopoiesis in der Systemtheorie?
Autopoiesis beschreibt die Selbststeuerung und Selbsterzeugung von Systemen. Ein System produziert seine eigenen Elemente durch Rekursion, wie etwa das Wirtschaftssystem durch fortlaufende Geldzahlungen.
Wie werden Menschen in Luhmanns Theorie eingeordnet?
Menschen werden nicht als Teile von sozialen Systemen gesehen, sondern als deren Umwelt. Sie sind die Bedingung der Möglichkeit für Systeme, bestehen aber selbst aus verschiedenen Systemen wie Bewusstsein oder biologischen Zellen.
Welche Rolle spielen Codes und Programme?
Codes definieren die spezifische Funktion eines Systems. Alles, was nicht in den Code eines Systems passt (z. B. "Zahlung/Nicht-Zahlung" im Wirtschaftssystem), gehört zur Systemumwelt.
Warum gilt der Zugang zu Luhmanns Theorie als schwierig?
Die Theorie bildet ein eigenes, hochkomplexes "Sprachspiel". Begriffe sind oft aus anderen Disziplinen entlehnt und müssen durch weitere Fachbegriffe erläutert werden, was den Einstieg erschwert.
Was ist der Unterschied zwischen Luhmann und Parsons?
Luhmann entwickelte Parsons' handlungstheoretische Systemtheorie zu einer eigenständigen Kommunikationstheorie weiter, wobei er nur grundlegende Strukturen beibehielt und neue Konzepte wie Autopoiesis integrierte.
- Citar trabajo
- Urs Büttner (Autor), 2002, Einführung in Luhmanns Theorie Sozialer Systeme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6880