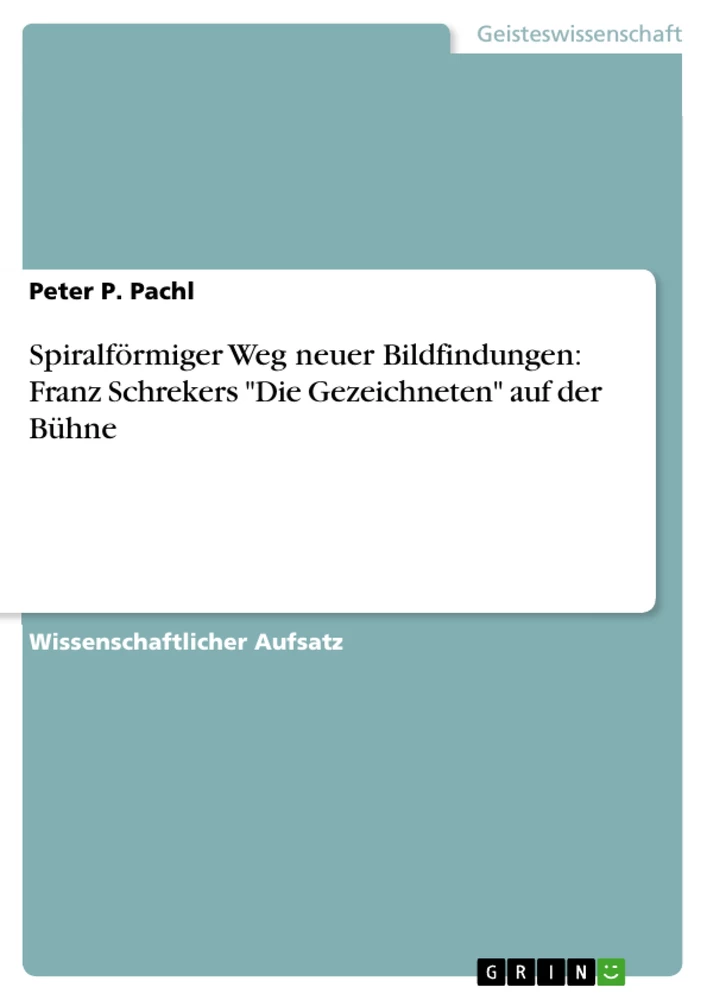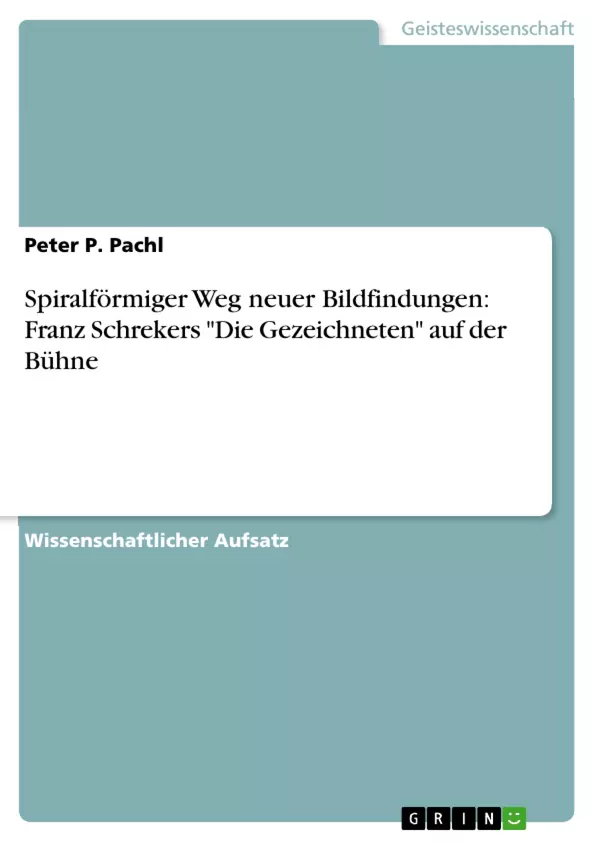Franz Schrekers epochales Bühenwerk hat Regisseure zu höchst unterschiedlichen Interpretationen und szenischen Versinnlichungen angeregt. Die Arbeit untersucht den Wandel der Aufführungsästhetik und -Praxis zu Lebzeiten des Komponisten und an Inszenierungen dieser Oper in Inszenierungen von Günter Krämer, Hans Neuenfels, Martin Kusej u. a.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Salzburg und die „Gezeichneten“
- 1. Die Salzburger „Gezeichneten“ als konzertantes Seelengemälde (16.8.1984)
- 2. Frankenstein im menschenleeren Frankfurt oder „Die Gezeichneten“ als szenische Provokation (20. 1. 1979)
- 3. Der Juden-Krüppel und der schwule SS-Mann oder „Die Gezeichneten“ als politisches Zeitbild in Düsseldorf (18. 12. 1987)
- 4. Die 1:1-Umsetzung der szenischen Vorschriften erweist sich als nicht mehr ausreichend: Die Schweizer Erstaufführung der „Gezeichneten“ an der Züricher Oper (20. 12. 1992)
- 5. Auf den Pfaden der ersten Wiederaufführung, schlüssig weiterentwickelt: „Die Gezeichneten\" in Stuttgart (22. 1. 2002)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Publikation verfolgt das Ziel, die Entwicklung der szenischen Interpretation von Franz Schrekers Oper „Die Gezeichneten“ seit ihrer Wiederbelebung in Frankfurt 1979 bis heute zu untersuchen. Dabei werden die verschiedenen Inszenierungen in ihren historischen und gesellschaftlichen Kontexten beleuchtet.
- Die Wiederbelebung von Schrekers Oper „Die Gezeichneten“ im Kontext der Nachkriegszeit
- Die verschiedenen künstlerischen Ansätze zur Inszenierung des Werkes
- Die Rezeption der Oper in unterschiedlichen Epochen und Gesellschaften
- Die Bedeutung der Oper für die Auseinandersetzung mit Themen wie Hässlichkeit, Liebe und Macht
- Die Beziehung zwischen Musik und Inszenierung in Schrekers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort stellt die historische Verbindung zwischen Salzburg und Franz Schreker dar, beleuchtet die fehlgeschlagene Zusammenarbeit mit Max Reinhardt und die konzertante Aufführung der „Gezeichneten“ im Jahr 1984.
- Kapitel 1 untersucht die Salzburger Aufführung von 1984 als konzertantes Seelengemälde und analysiert die musikalische Interpretation von Gerd Albrecht im Vergleich zu Michael Gielens Inszenierung. Die Besetzung und die Rezeption der Aufführung werden ebenfalls beleuchtet.
- Kapitel 2 beleuchtet die Frankfurter Aufführung von 1979 als szenische Provokation und analysiert die Inszenierung von Hans Neuenfels, die Schrekers Geschichte in einen futuristischen Trivialmythos verwandelte.
Schlüsselwörter
Franz Schreker, „Die Gezeichneten“, Oper, Inszenierung, Wiederbelebung, Frankfurter Oper, Salzburger Festspiele, Musiktheater, Szenische Interpretation, Geschichte, Kunst, Musik
Häufig gestellte Fragen
Wer komponierte die Oper "Die Gezeichneten"?
Die Oper stammt von dem Komponisten Franz Schreker.
Welche Inszenierungen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Inszenierungen von Günter Krämer, Hans Neuenfels, Martin Kusej und anderen.
Warum war die Aufführung in Frankfurt 1979 so bedeutend?
Sie galt als "szenische Provokation" und leitete eine Wiederbelebung des Werkes in der Nachkriegszeit ein.
Wie hat sich die Aufführungsästhetik über die Zeit verändert?
Von der strikten Einhaltung szenischer Vorschriften hin zu modernen, oft politisch oder psychologisch gedeuteten Interpretationen.
Welche Rolle spielten die Salzburger Festspiele für das Werk?
Dort wurde das Werk 1984 als "konzertantes Seelengemälde" aufgeführt, was einen weiteren Meilenstein der Rezeption darstellte.
- Citar trabajo
- Prof. Dr. Peter P. Pachl (Autor), 2005, Spiralförmiger Weg neuer Bildfindungen: Franz Schrekers "Die Gezeichneten" auf der Bühne, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68926