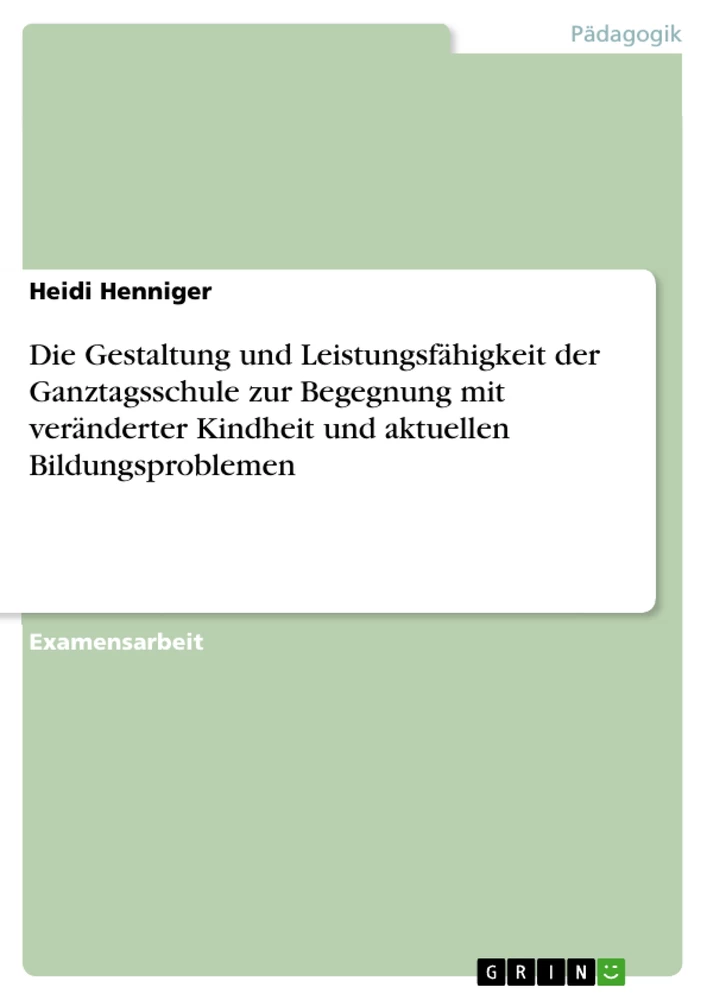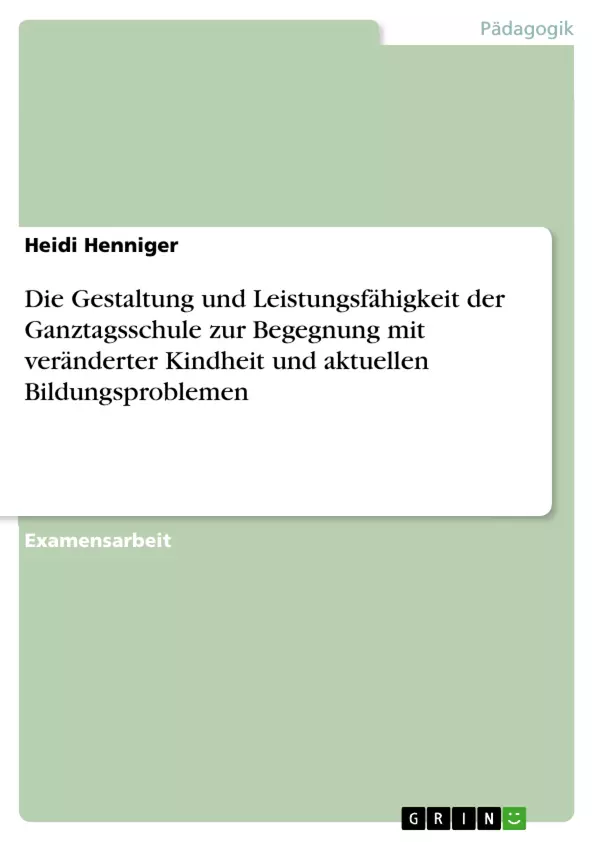Deutschland befindet sich in einer Zeit des Wandels. Bei der Herstellung arbeitsintensiver Produkte sehen wir uns längst einer übermächtigen Konkurrenz aus Niedriglohnländern gegenüber, der wir als Industrienation nur mit Innovation und überdurchschnittlichen Produkten begegnen können.
Um die Existenz unserer Gesellschaft abzusichern, müssen nachwachsende Generationen auf diese neuen Anforderungen vorbereitet werden. Die durchgeführten Studien zum Bildungsstand von Kindern und Jugendlichen zeigen jedoch, dass Deutschland dem Wandel bildungspolitisch noch nicht gewachsen ist. Mit gerade einmal durchschnittlichen Leistungen wird man im globalen Wettbewerb nicht mehr bestehen können. Die Bundesrepublik muss sich mehr auf bildungspolitische Aspekte konzentrieren, um bestehende Chancen zu nutzen und nicht in der Mittelmäßigkeit zu versinken.
Neue Anforderungen erfordern neue Strategien. Jedes Kind muss gefordert und gefördert werden. Lehrerinnen und Lehrer brauchen die Möglichkeit, Wissen nicht nur zu vermitteln, sondern ermitteln zu lassen. Praktisches Lernen in Projekten, Eigenverantwortung im Lernprozess und Interesse müssen durch den Lebensweltbezug den Schülerinnen und Schülern näher gebracht werden. So kann auch dem demographischen Wandel begegnet werden. Es darf nicht zugelassen werden, dass Kinder vereinsamen. Notwendig sind methodisch-didaktische Formen, die die neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation berücksichtigen.
Eine Schule, die den Anforderungen einer veränderten Kindheit und den aktuellen Bildungsproblemen gerecht werden soll, ist die Ganztagsschule. Mit umfangreichen pädagogischen Gestaltungsmerkmalen, ist sie durchaus bereit den beschriebenen Bedingungen zu begegnen.
Diese Arbeit setzt an den derzeitigen Kindheitsbedingungen an und soll Möglichkeiten aufzeigen, Bildungsansprüche kindgerecht zu verwirklichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangspunkt: Lebensbedingungen und Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft
- Individuelle Lebenswelten im Veränderungsprozess
- Kinderwelten: zerrissen und isoliert
- Kinderräume: eingegrenzt und vorbestimmt
- Kinderleben: ausgeliefert und anspruchsvoll
- Defizite in der Bildungswirksamkeit unseres Schulsystems anhand der Ergebnisse aus der IGLU- und PISA-Studie
- Bildungsanforderungen an die Grundschule
- Die Grundschule als Komplexität
- Die Grundschule als gemeinsame Schule: Individualisierung und soziale Integration
- Die Ganztagsschule unter dem Anspruch der Heterogenität
- Historische Wurzeln der Ganztagsschule am Beispiel des Jena-Plans
- Versuch einer Begriffsbestimmung
- Ziele und Aufgaben der Ganztagsschule
- Grundlegende Gestaltungsprinzipien
- Rhythmisierung des Schulalltags
- Öffnung des Unterrichts der Räume
- Organisation des Schullebens und die Funktionalität
- Die veränderte Personalstruktur: Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Erzieher
- Schulöffnung und Gemeinwesen
- Erwartungen der Eltern
- Die Umsetzung von Ganztagsschulen anhand eines Beispiels aus Thüringen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gestaltung und Leistungsfähigkeit der Ganztagsschule im Hinblick auf veränderte Kindheitsbedingungen und aktuelle Bildungsprobleme. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der sich wandelnden Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ergeben und untersucht, wie die Ganztagsschule als pädagogisches Konzept diesen Herausforderungen begegnen kann.
- Die veränderte Kindheit in der BRD im Kontext von Globalisierung, Massenarbeitslosigkeit und Konsumdruck
- Die Defizite in der Bildungswirksamkeit des deutschen Schulsystems im Lichte der IGLU- und PISA-Studien
- Die Bedeutung der Ganztagsschule für die Förderung der Individualität und sozialen Integration von Kindern
- Die Gestaltungsprinzipien der Ganztagsschule und ihre Bedeutung für die Rhythmisierung des Schulalltags, die Öffnung des Unterrichts und die Zusammenarbeit von Lehrkräften, Sozialpädagogen und Erziehern
- Die Erwartungen der Eltern an die Ganztagsschule und die praktische Umsetzung des Konzepts in Thüringen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Lebensbedingungen und Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen in der heutigen Gesellschaft. Sie beleuchtet die Veränderungen in der Kindheit, die durch die Globalisierung, den Konsumdruck und die Massenarbeitslosigkeit entstehen.
Anschließend werden die Defizite im Bildungswesen Deutschlands anhand der Ergebnisse der IGLU- und PISA-Studien aufgezeigt. Die Arbeit untersucht die Bildungsanforderungen an die Grundschule und analysiert die Rolle der Grundschule als gemeinsame Schule, die Individualisierung und soziale Integration gewährleisten soll.
Im nächsten Kapitel wird die Ganztagsschule als pädagogisches Konzept vorgestellt. Die historischen Wurzeln der Ganztagsschule werden am Beispiel des Jena-Plans beleuchtet. Die Arbeit erläutert die Ziele, Aufgaben und Gestaltungsprinzipien der Ganztagsschule. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rhythmisierung des Schulalltags, der Öffnung des Unterrichts, der Organisation des Schullebens, der Zusammenarbeit von Lehrkräften, Sozialpädagogen und Erziehern sowie der Schulöffnung und Gemeinwesenarbeit.
Abschließend wird die Umsetzung von Ganztagsschulen anhand eines Beispiels aus Thüringen vorgestellt. Die Arbeit befasst sich mit den Erwartungen der Eltern an die Ganztagsschule und den Herausforderungen, die sich bei der praktischen Umsetzung des Konzepts ergeben.
Schlüsselwörter
Ganztagsschule, Bildungswesen, Kindheit, Lebensbedingungen, Bildungsprobleme, Individualisierung, soziale Integration, Gestaltungsprinzipien, Thüringen, Eltern, Erwartungen
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Ganztagsschule als Lösung für aktuelle Bildungsprobleme gesehen?
Sie bietet durch mehr Zeit und pädagogische Konzepte wie Rhythmisierung die Möglichkeit, Kinder individueller zu fördern und auf globale Anforderungen vorzubereiten.
Was sind die zentralen Gestaltungsprinzipien einer Ganztagsschule?
Dazu gehören die Rhythmisierung des Schulalltags, die Öffnung des Unterrichts, eine veränderte Personalstruktur (Lehrer und Sozialpädagogen) und der Lebensweltbezug.
Welche Rolle spielen PISA- und IGLU-Studien in dieser Arbeit?
Diese Studien deckten Defizite im deutschen Schulsystem auf und dienen als Begründung für die notwendige bildungspolitische Neuorientierung.
Wie reagiert die Ganztagsschule auf die „veränderte Kindheit“?
Sie wirkt der Isolation und Vereinsamung von Kindern in einer zerrissenen Medien- und Konsumwelt durch soziale Integration und gemeinsames Leben entgegen.
Was ist der Jena-Plan im Kontext der Ganztagsschule?
Der Jena-Plan dient als historisches Beispiel für pädagogische Konzepte, die bereits früh Elemente der Ganztagsbildung und des projektorientierten Lernens vorwegnahmen.
- Arbeit zitieren
- Heidi Henniger (Autor:in), 2006, Die Gestaltung und Leistungsfähigkeit der Ganztagsschule zur Begegnung mit veränderter Kindheit und aktuellen Bildungsproblemen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68943