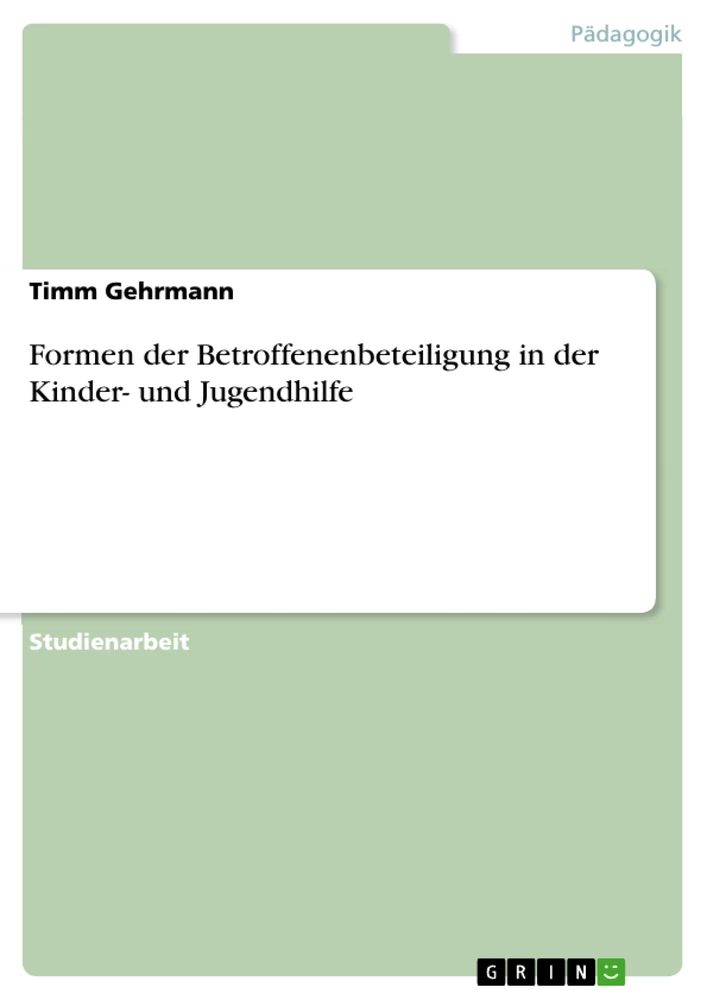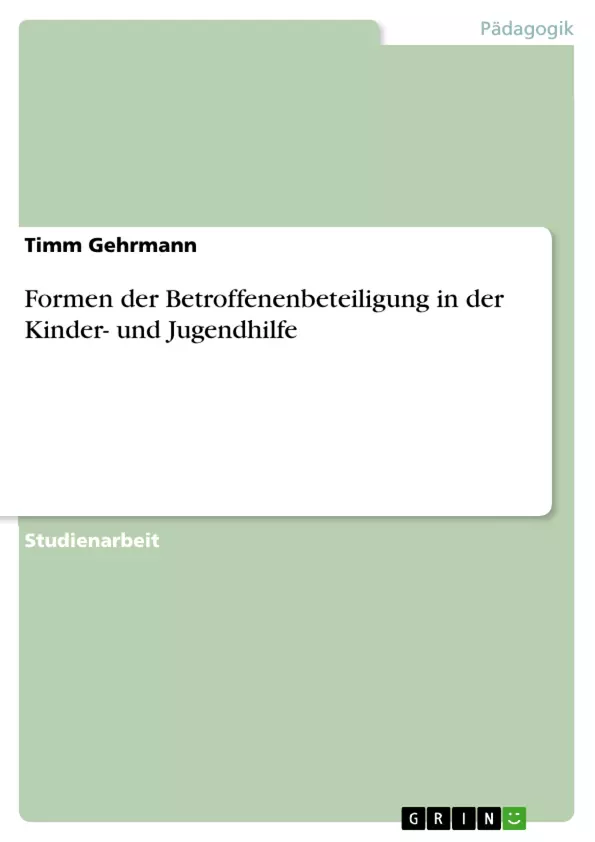Die diversen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind zur Planung durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verpflichtet. Diese Planung soll sich dabei neben dem nominellen Bedarf vor allem an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientieren. Die Modalitäten dieser Bedarfsermittlung und der Ermittlung der Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen liegen jedoch in den Händen der Gemeinden.
Aus diesem Grunde haben sich ganz unterschiedliche Modelle der Betroffenenbeteiligung an den Planungsprozessen entwickelt. Den Gemeinden sind dabei verschiedene Möglichkeiten des Einbezugs von Jugendlichen in das planerische Handeln an die Hand gegeben. Diese rangieren zwischen vollkommener nicht-Einbeziehung bis hin zur vollen Partizipation der Jugendlichen in jeder Phase der Planung.
Aber auch diese Miteinbeziehung der Betroffenen garantiert noch lange nicht, dass sich auch entsprechend gelungene Umsetzungen von Planungen, die sich an den Bedürfnissen von Kindern- und Jugendlichen orientieren, einstellen. So werden nicht selten durch Anhörungen und andere Partizipationsverfahren zwar Daten gesammelt, diese jedoch falsch ausgewertet oder aber bewusst missachtet. Auch die Formen der Bedarfsermittlung bergen Probleme in der Gestaltung von Befragungen sowie deren Auswertungen, so dass selbst gut gemeinte Versuche von Gemeinden nicht dazu führen, dass entsprechend adäquate Angebote für Kinder und Jugendliche auf Basis von Bedarfsermittlungen geschaffen werden können.
Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich die grundlegenden Anforderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes an die Planungstätigkeit kurz vorstellen und im Folgenden untersuchen wie gut Betroffenenbeteiligungsverfahren und andere Verfahren zur Ermittlung von Bedürfnissen es vermögen den Planungsprozess auf kommunaler Ebene zu gestalten und die planerische Tätigkeit zu unterstützen. Maßgeblich sollte dabei vor allem sein, in welchem Kosten / Nutzen Verhältnis die diversen Beteiligungsverfahren stehen und wie diese es ermöglichen, auch mit beschränkten Mitteln, dennoch Bedürfnisse zu ermitteln, die auch sinnvoll zu befriedigen sind. Es sollten also keine Luftschlösser durch die Beteiligung der Jugendlichen aufgebaut werden, die sich dann als (finanziell) nicht realisierbar erweisen und zur Folge haben, dass die Jugendlichen das Vertrauen an die Beteiligungsverfahren und deren Potential zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Die Bedürfnisorientierung der Kinder- und Jugendhilfe
- Grundorientierungen in der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Der Bereichsorientierte Ansatz in der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Der zielorientierte Ansatz in der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Der sozialraumorientierte Ansatz in der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Der zielgruppenorientierte Ansatz in der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Partizipationsverfahren in der Kinder- und Jugendhilfeplanung
- Passive Partizipationsverfahren
- Aktive Partizipationsverfahren
- Direkte aktive Partizipation
- Indirekte aktive Partizipation
- Alternative Formen der Partizipation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Betroffenenbeteiligung in der Kinder- und Jugendhilfeplanung. Ziel ist es, die unterschiedlichen Verfahren der Partizipation im Hinblick auf ihre Eignung zur Gestaltung des Planungsprozesses auf kommunaler Ebene zu analysieren. Die Analyse konzentriert sich dabei auf das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen der jeweiligen Verfahren und deren Fähigkeit, Bedürfnisse zu ermitteln, die sinnvoll zu befriedigen sind.
- Bedürfnisorientierte Planung in der Kinder- und Jugendhilfe
- Methoden der Betroffenenbeteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe
- Kosten-Nutzen-Verhältnis von Partizipationsverfahren
- Optimierung der Planungspraxis durch Betroffenenbeteiligung
- Vertrauensbildung durch gelungene Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Bedeutung von Betroffenenbeteiligung in der Planung der Kinder- und Jugendhilfe, wobei die Herausforderungen und Chancen der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den Planungsprozess hervorgehoben werden. Kapitel II beleuchtet die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfeplanung und unterstreicht die Bedeutung der Bedürfnisorientierung. Kapitel III untersucht verschiedene Grundorientierungen in der Kinder- und Jugendhilfeplanung, darunter der Bereichsorientierte, der Zielorientierte, der Sozialraumorientierte und der Zielgruppenorientierte Ansatz. In Kapitel IV werden verschiedene Partizipationsverfahren in der Kinder- und Jugendhilfeplanung vorgestellt, einschließlich passiver, direkter und indirekter aktiver Verfahren sowie alternativer Formen der Partizipation.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Betroffenenbeteiligung, Partizipation, Bedarfsermittlung, Bedürfnisorientierung, Kosten-Nutzen-Analyse, Planungsprozess, kommunale Ebene, Jugendhilfegesetz, Evaluation, Qualität, Zeitgemäßheit, Planungspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Warum müssen Kinder und Jugendliche an der Jugendhilfeplanung beteiligt werden?
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verpflichtet Gemeinden dazu, Planungen an den tatsächlichen Wünschen und Bedürfnissen der Betroffenen auszurichten.
Welche Formen der Partizipation gibt es?
Man unterscheidet zwischen passiven (z.B. Beobachtung), aktiven direkten (z.B. Jugendparlamente) und aktiven indirekten Verfahren (z.B. Befragungen durch Stellvertreter).
Was sind die Risiken einer misslungenen Betroffenenbeteiligung?
Wenn durch Beteiligung „Luftschlösser“ gebaut werden, die finanziell nicht realisierbar sind, verlieren Jugendliche das Vertrauen in demokratische Prozesse und Beteiligungsverfahren.
Was ist der sozialraumorientierte Ansatz in der Jugendhilfeplanung?
Dieser Ansatz betrachtet nicht nur das Individuum, sondern die gesamte Lebenswelt und den geografischen Raum, in dem Kinder und Jugendliche aufwachsen.
Wie steht es um das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Beteiligungsverfahren?
Die Arbeit untersucht, wie Gemeinden trotz beschränkter Mittel effektive Verfahren einsetzen können, um bedarfsgerechte Angebote zu schaffen.
- Quote paper
- Timm Gehrmann (Author), 2006, Formen der Betroffenenbeteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68981