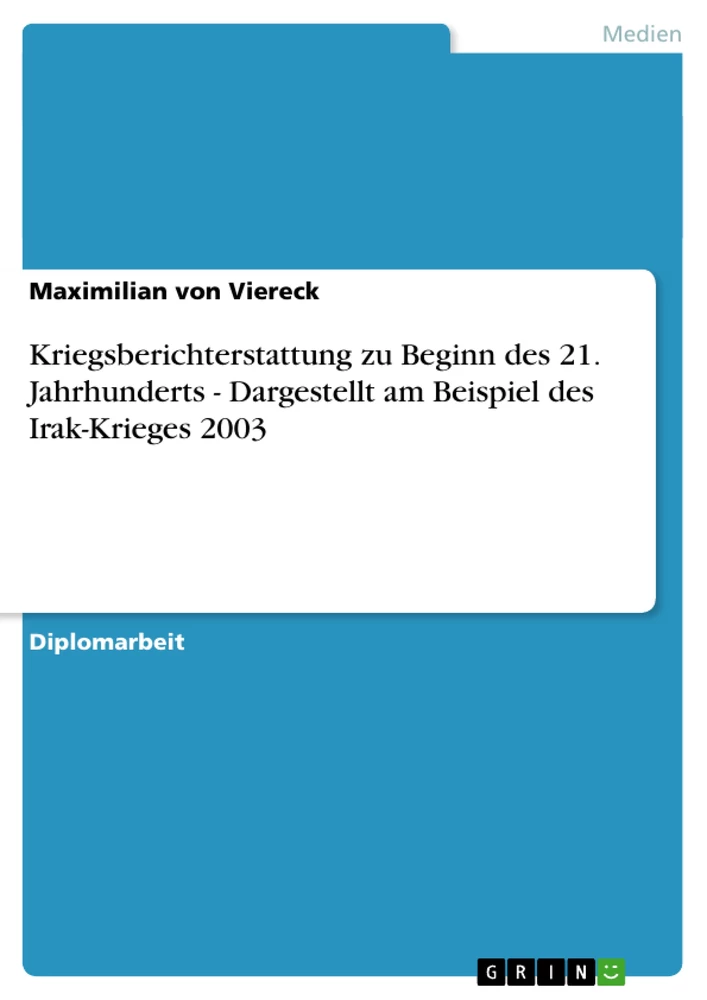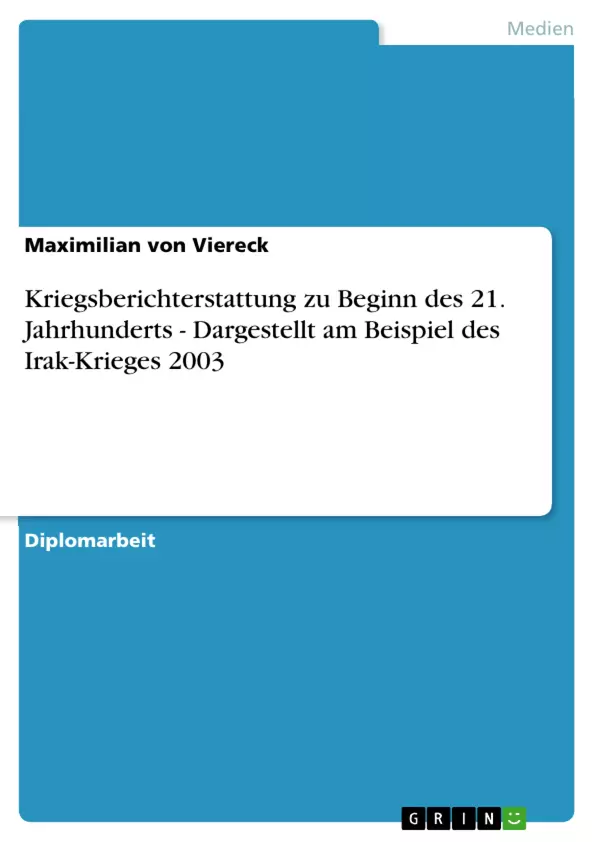Der lang angedrohte Krieg der USA, Großbritanniens, Spaniens und Polens, sowie anderer Länder in der „Koalition der Willigen“, beginnt am Morgen des 20. März 2003. Zeitgleich sind fast alle privaten TV-Stationen rund um den Globus live dabei, von CNN, über Fox News bis zu Al-Jazeera oder N-TV, um nur einige zu nennen. Die öffentlichrechtlichen Fernsehstationen oder staatlichen TV-Sender aus Europa und aus anderen Teilen der Welt sind, um ihrem Informationsauftrag nachzukommen und aus Wettbewerbsgründen auf dem Nachrichtenmarkt, ebenso auf Sendung. An unterschiedlichen Orten fest installierte Kameras zeigen Bagdad bei Nacht. Plötzlich wird die Stille durch Einschläge von Bomben unterbrochen, abgeworfen von hochfliegenden amerikanischen Kampfflugzeugen. Gelb-orange-farbene Pilze von Detonationen, dunkler Qualm und Leuchtspuren von Flakfeuer signalisieren den Beginn des Krieges. Nach Beginn der Kampfhandlungen werden die gewohnten oder angekündigten Programme komplett geändert, Sondersendungen werden eingespielt, Expertengespräche und Interviews geführt, Schaltungen zu Korrespondenten hergestellt und die Info-Laufbänder am unteren Bildschirmrand bringen die neuesten Entwicklungen. In den folgenden Tagen herrscht Ausnahmezustand im Fernsehen, die Berichterstattung wird ausgedehnt und die Einschaltquoten schnellen in die Höhe. Einige Nachrichtensender wie N-TV und N24 können nachts ihre Zuschauerzahlen sogar verdoppeln.
Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welchen Rahmenbedingungen Kriegsberichterstattung unterliegt, was ihren Wandel beeinflusst und welche charakteristischen Merkmale die Berichterstattung über den Krieg im Irak 2003 aufweist.
Zum Einstieg in das Thema wird in Kapitel 2 zunächst der historische und politische Hintergrund des Irak-Krieges 2003 dargestellt. Anschließend soll in einem kurzen Exkurs erläutert werden welche Methoden und Mittel westliche Demokratien anwenden, um Zustimmung für ein militärisches Vorgehen zu erhalten und was für eine Rolle die Medien in dem Legitimierungsprozess von Kriegen übernehmen. Daraufhin wird gezeigt mit welcher Argumentationsstrategie es der US-Administration gelang eine Mehrheit der Amerikaner von der propagierten Notwendigkeit des Krieges gegen den Irak zu überzeugen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichtlicher Hintergrund und Rechtfertigung des Krieges
- 2.1 Saddam Husseins Machtübernahme und 1. Golfkrieg
- 2.2 Die Zeit vom 11. September 2001 bis zum 20. März 2003
- 2.3 Öffentliche Stimmung vor dem Krieg
- 2.4 Legitimation von Kriegen in Demokratien
- 2.5 Feindbildaufbau in den Medien
- 2.6 Die Rechtfertigungsstrategie der Bush Administration
- 3. Geschichte der Kriegsberichterstattung
- 3.1 Die Anfänge
- 3.2 Frühes 19. Jahrhundert
- 3.3 Erster Weltkrieg
- 3.4 Zweiter Weltkrieg
- 3.5 Vietnam-Krieg
- 3.6 Golf-Krieg 1991
- 3.7 Kosovo-Krieg
- 3.8 Afghanistan-Krieg
- 3.9 Strukturelle Militarisierbarkeit der Medien
- 4. Von der Propaganda zum Infowar
- 4.1 Geschichte und Begriff der Propaganda
- 4.2 Zensur
- 4.3 Maßnahmen und Instrumente der militärischen Öffentlichkeitsarbeit
- 4.4 Information Warfare und Information Operations
- 4.5 Kommunikationsstrategie der US-Regierung während des Irak-Krieges
- 5. Das Konzept der „embedded journalists“
- 5.1 Konzept und Plan des Pentagons
- 5.2 Kritik an dem Konzept
- 6. Kriegsberichterstattung im Fernsehen
- 6.1 Nachrichtenwert eines Krieges
- 6.2 Die Pluralisierung der int. Fernsehberichterstattung am Beispiel Al-Jazeeras
- 6.3 Fiktionalisierung und Entertainisierung der Berichterstattung
- 6.4 Die Berichterstattung der deutschen Sender
- 6.5 Kritische Reflexion
- 6.6 Patriotismus im Journalismus
- 7. Kriegberichterstattung und Internet
- 7.1 Nutzung des Internets während des Krieges
- 7.2 Warblogs
- 7.3 Internet als Plattform für eine Gegenöffentlichkeit
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rahmenbedingungen der Kriegsberichterstattung, ihren Wandel und die charakteristischen Merkmale der Berichterstattung über den Irak-Krieg 2003. Sie analysiert die Wechselwirkungen zwischen Medien, Militär und Politik im Kontext des Krieges.
- Historischer und politischer Hintergrund des Irak-Krieges 2003
- Legitimation von Kriegen in Demokratien und die Rolle der Medien
- Wandel der Kriegsberichterstattung im Laufe der Geschichte
- Öffentlichkeitsarbeit militärischer und politischer Akteure während des Krieges
- Analyse des Konzepts der „embedded journalists“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Beginn des Irak-Krieges 2003 und die unmittelbare Berichterstattung der Medien. Sie führt die Zielsetzung der Arbeit ein, die darin besteht, die Rahmenbedingungen, den Wandel und die charakteristischen Merkmale der Kriegsberichterstattung im Irak-Krieg 2003 aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Wechselwirkungen zwischen Medien, Militär, Politik und Rezipienten.
2. Geschichtlicher Hintergrund und Rechtfertigung des Krieges: Dieses Kapitel liefert einen historischen Überblick über die Ereignisse, die zum Irak-Krieg führten, einschließlich Saddam Husseins Machtübernahme, des Ersten Golfkriegs und der Zeit nach dem 11. September 2001. Es analysiert die öffentliche Stimmung vor dem Krieg, die Legitimation von Kriegen in Demokratien und die Rolle der Medien in diesem Prozess, sowie die Rechtfertigungsstrategie der Bush-Administration, um die öffentliche Unterstützung für den Krieg zu gewinnen.
3. Geschichte der Kriegsberichterstattung: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung der Kriegsberichterstattung von den Anfängen bis zum Golfkrieg 1991 nach, zeigt den Wandel auf und untersucht die Einflussfaktoren. Es analysiert die Berichterstattung in verschiedenen Kriegen (Erster und Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Golfkrieg 1991, Kosovo-Krieg, Afghanistan-Krieg), um die Grundlage für die Analyse der Berichterstattung zum Irak-Krieg 2003 zu legen und die komplexen Wechselwirkungen zwischen Medien, Militär, Politik und Rezipienten zu verdeutlichen.
4. Von der Propaganda zum Infowar: Dieses Kapitel behandelt die Öffentlichkeitsarbeit militärischer und politischer Akteure und ihre Kommunikationsbemühungen während des Krieges. Es beleuchtet die Rolle der Medien, insbesondere des Fernsehens, in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, untersucht die Geschichte und den Begriff der Propaganda, die Zensur und die Maßnahmen der militärischen Öffentlichkeitsarbeit, sowie den „Information Warfare“ und die Kommunikationsstrategie der US-Regierung während des Irak-Krieges.
5. Das Konzept der „embedded journalists“: Dieses Kapitel analysiert das Konzept der „embedded journalists“, das vom amerikanischen Verteidigungsministerium entwickelt wurde. Es untersucht die Ziele des Pentagons mit diesem Konzept und die Kritik daran. Die Einbettung von Journalisten in militärische Einheiten erlaubte die unmittelbare Berichterstattung vom Kriegsgeschehen in Echtzeit, aber warf gleichzeitig Fragen der Objektivität und der Einflussnahme auf.
6. Kriegsberichterstattung im Fernsehen: Dieses Kapitel analysiert die Fernsehberichterstattung über den Irak-Krieg, einschließlich des Nachrichtenwerts eines Krieges, der Pluralisierung der internationalen Fernsehberichterstattung (am Beispiel von Al-Jazeera), der Fiktionalisierung und Entertainisierung der Berichterstattung, der Berichterstattung deutscher Sender und einer kritischen Reflexion sowie dem Aspekt des Patriotismus im Journalismus.
7. Kriegberichterstattung und Internet: Dieses Kapitel untersucht die Nutzung des Internets während des Irak-Krieges, die Rolle von Warblogs und das Internet als Plattform für eine Gegenöffentlichkeit.
Schlüsselwörter
Irak-Krieg 2003, Kriegsberichterstattung, Medien, Militär, Politik, Propaganda, „embedded journalists“, Information Warfare, Öffentlichkeitsarbeit, Demokratie, Legitimation von Kriegen, Al-Jazeera, Internet, Gegenöffentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Kriegsberichterstattung im Irak-Krieg 2003
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die Kriegsberichterstattung über den Irak-Krieg 2003. Sie untersucht die Rahmenbedingungen, den Wandel und die charakteristischen Merkmale dieser Berichterstattung und die komplexen Wechselwirkungen zwischen Medien, Militär und Politik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse umfasst den historischen und politischen Hintergrund des Irak-Krieges, die Legitimation von Kriegen in Demokratien und die Rolle der Medien dabei, den Wandel der Kriegsberichterstattung im Laufe der Geschichte, die Öffentlichkeitsarbeit militärischer und politischer Akteure, das Konzept der „embedded journalists“, die Fernsehberichterstattung (inkl. Al-Jazeera und der deutschen Sender), die Rolle des Internets und die Entstehung einer Gegenöffentlichkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Geschichtlicher Hintergrund und Rechtfertigung des Krieges, Geschichte der Kriegsberichterstattung, Von der Propaganda zum Infowar, Das Konzept der „embedded journalists“, Kriegsberichterstattung im Fernsehen, Kriegberichterstattung und Internet und Resümee.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit will die Rahmenbedingungen, den Wandel und die charakteristischen Merkmale der Kriegsberichterstattung im Irak-Krieg 2003 aufzeigen und die Wechselwirkungen zwischen Medien, Militär, Politik und Rezipienten analysieren.
Welche Aspekte der Kriegsberichterstattung werden besonders untersucht?
Besonders untersucht werden der Einfluss der Medien auf die öffentliche Meinung, die Strategien der Öffentlichkeitsarbeit von Militär und Politik (inkl. Propaganda und Information Warfare), die Rolle der „embedded journalists“, die Pluralisierung der internationalen Berichterstattung (z.B. Al-Jazeera), die Fiktionalisierung und Entertainisierung der Berichterstattung und die Nutzung des Internets als Plattform für eine Gegenöffentlichkeit.
Wie wird die Geschichte der Kriegsberichterstattung dargestellt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der Kriegsberichterstattung von den Anfängen bis zum Irak-Krieg 2003, indem sie verschiedene Kriege (Erster und Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Golfkrieg 1991, Kosovo-Krieg, Afghanistan-Krieg) als Beispiele heranzieht, um den Wandel aufzuzeigen und Einflussfaktoren zu analysieren.
Welche Rolle spielen die „embedded journalists“ in der Analyse?
Die Analyse untersucht das Konzept der „embedded journalists“, ihre Einbettung in militärische Einheiten, die damit verbundenen Vorteile (unmittelbare Berichterstattung) und die Kritik an diesem Konzept hinsichtlich Objektivität und möglicher Einflussnahme.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Irak-Krieg 2003, Kriegsberichterstattung, Medien, Militär, Politik, Propaganda, „embedded journalists“, Information Warfare, Öffentlichkeitsarbeit, Demokratie, Legitimation von Kriegen, Al-Jazeera, Internet, Gegenöffentlichkeit.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die deren Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse beschreibt.
Für wen ist diese Analyse relevant?
Diese Analyse ist relevant für Wissenschaftler, Journalisten, Studenten und alle, die sich für die Medienberichterstattung im Krieg, die Rolle der Medien in demokratischen Gesellschaften und die Wechselwirkungen zwischen Medien, Militär und Politik interessieren.
- Quote paper
- Maximilian von Viereck (Author), 2005, Kriegsberichterstattung zu Beginn des 21. Jahrhunderts - Dargestellt am Beispiel des Irak-Krieges 2003, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69131