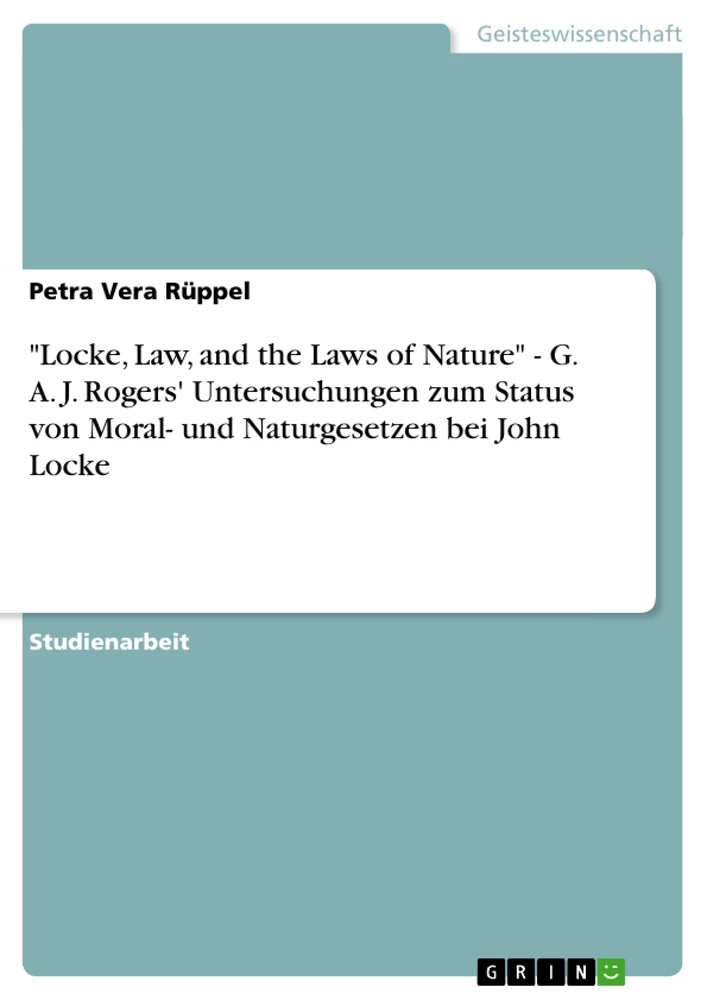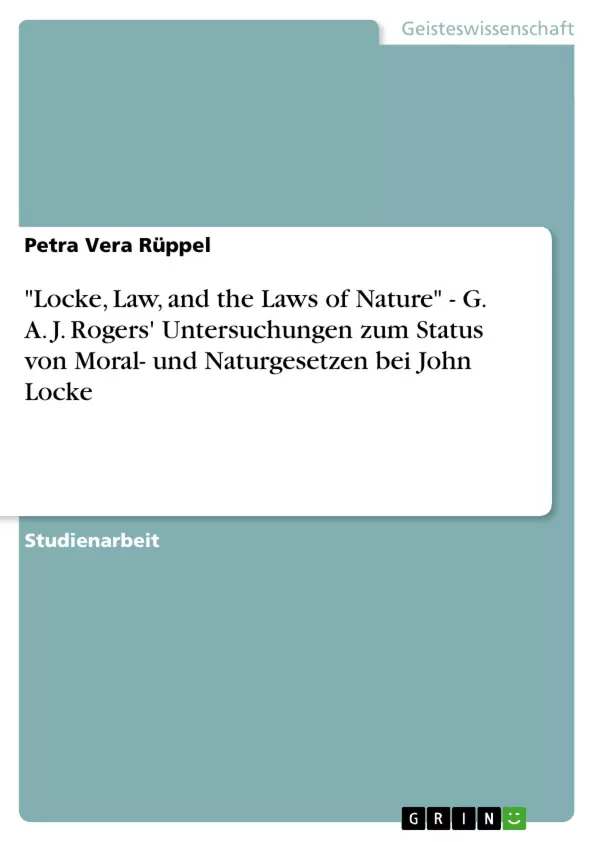In seinem anlässlich des Wolfenbütteler Locke-Symposiums im Jahre 1979 verfassten Essay "Locke, Law, and the Laws of Nature" thematisiert G. A. J. Rogers die menschliche Erkenntniskraft auf dem Gebiet von Moral und Naturphilosophie bei John Locke. Im Zentrum seiner Ausführungen steht der logische Status der Moral- und Naturgesetze: den Ausgangspunkt bildet die Frage, ob es sich hierbei um notwendige oder kontingente Wahrheiten handelt, wobei eine Beleuchtung der theologischen, epistemologischen und moralphilosophischen Aspekte von Lockes Werk von grundlegender Bedeutung für die Erörterung dieses Problems ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Status des Naturgesetzes
- Begriffsklärung
- Locke und die Naturgesetze
- Möglichkeit einer Naturwissenschaft
- Parallelen zwischen Lockes Gedanken über die Moral und seiner Sicht der Naturgesetze
- Beweisbarkeit von Moral und Naturphilosophie
- Erkenntnis der Naturgesetze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In seinem Essay „Locke, Law, and the Laws of Nature" analysiert G. A. J. Rogers die menschliche Erkenntnisfähigkeit im Bereich der Moral und Naturphilosophie bei John Locke. Er untersucht insbesondere den logischen Status von Moral- und Naturgesetzen, indem er sich mit der Frage beschäftigt, ob es sich um notwendige oder kontingente Wahrheiten handelt. Die Ausführungen beleuchten die theologischen, epistemologischen und moralphilosophischen Aspekte von Lockes Werk.
- Der Status von Moral- und Naturgesetzen als notwendige oder kontingente Wahrheiten
- Lockes Konzeption von Moral und Naturgesetzen im Kontext seiner philosophischen Ansichten
- Die Rolle der göttlichen Setzung in Lockes Moralphilosophie
- Die Beweisbarkeit von Moral und die Beziehung zwischen Moral und Naturphilosophie
- Der Einfluss von Newtons „Principia" auf Lockes ethisches Programm
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Essay von G. A. J. Rogers analysiert die menschliche Erkenntnisfähigkeit im Bereich von Moral und Naturphilosophie bei John Locke. Er beleuchtet die Frage, ob Moral- und Naturgesetze notwendige oder kontingente Wahrheiten sind.
Status des Naturgesetzes
Der Abschnitt beschreibt Lockes Konzept des Naturgesetzes und dessen Beziehung zur Moral. Er erklärt, dass Locke die Moral als Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Menschen sieht. Die Moralische Sätze sind für Locke gemischte Modi, d.h. Kombinationen einfacher Ideen aus verschiedenen Seinsbereichen.
Locke und die Naturgesetze
Dieser Abschnitt erörtert Lockes Sicht auf die Möglichkeit einer Naturwissenschaft und die Parallelen zwischen seiner Moralphilosophie und seinen Ideen über die Naturgesetze. Die Ausführungen betonen die Beweisbarkeit von Moral bei Locke, die jedoch wiederum auf die Existenz Gottes angewiesen ist.
Beweisbarkeit von Moral und Naturphilosophie
Dieser Abschnitt untersucht die Beweisbarkeit von Moral und Naturphilosophie bei Locke. Er erklärt Lockes Konzept der 'Gewissheit' und seine Argumentation für die Beweisbarkeit moralischer Sätze. Die Ausführungen beleuchten auch die Rolle Gottes in Lockes Ethik und das Problem der Spannungen zwischen rationalistischer und voluntaristischer Position.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Essays sind John Locke, Moral, Naturgesetz, Naturphilosophie, Beweisbarkeit, Gottesbeweis, gemischte Modi, deduktive Ethik, Naturwissenschaft, rationalistische und voluntaristische Position.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht G. A. J. Rogers in Bezug auf John Locke?
Er untersucht den logischen Status von Moral- und Naturgesetzen und ob diese bei Locke als notwendige oder kontingente Wahrheiten zu verstehen sind.
Sind Moralgesetze für John Locke beweisbar?
Ja, Locke vertritt die Ansicht, dass die Moral eine beweisbare Wissenschaft sein kann, ähnlich wie die Mathematik, sofern sie auf klaren Ideen basiert.
Welche Rolle spielt Gott in Lockes Moralphilosophie?
Gott gilt als der Gesetzgeber; die Verbindlichkeit der Moralgesetze leitet sich aus dem göttlichen Willen und der Vernunft ab.
Was sind „gemischte Modi“ bei Locke?
Es sind komplexe Ideen, die der Geist frei kombiniert (z.B. Begriffe wie Gerechtigkeit), und die die Grundlage für moralische Sätze bilden.
Welchen Einfluss hatte Newton auf Lockes Denken?
Newtons naturwissenschaftliche Methode beeinflusste Lockes Bestreben, auch in der Philosophie und Ethik nach rationalen und systematischen Gesetzen zu suchen.
- Quote paper
- Mag. Petra Vera Rüppel (Author), 2000, "Locke, Law, and the Laws of Nature" - G. A. J. Rogers' Untersuchungen zum Status von Moral- und Naturgesetzen bei John Locke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69244