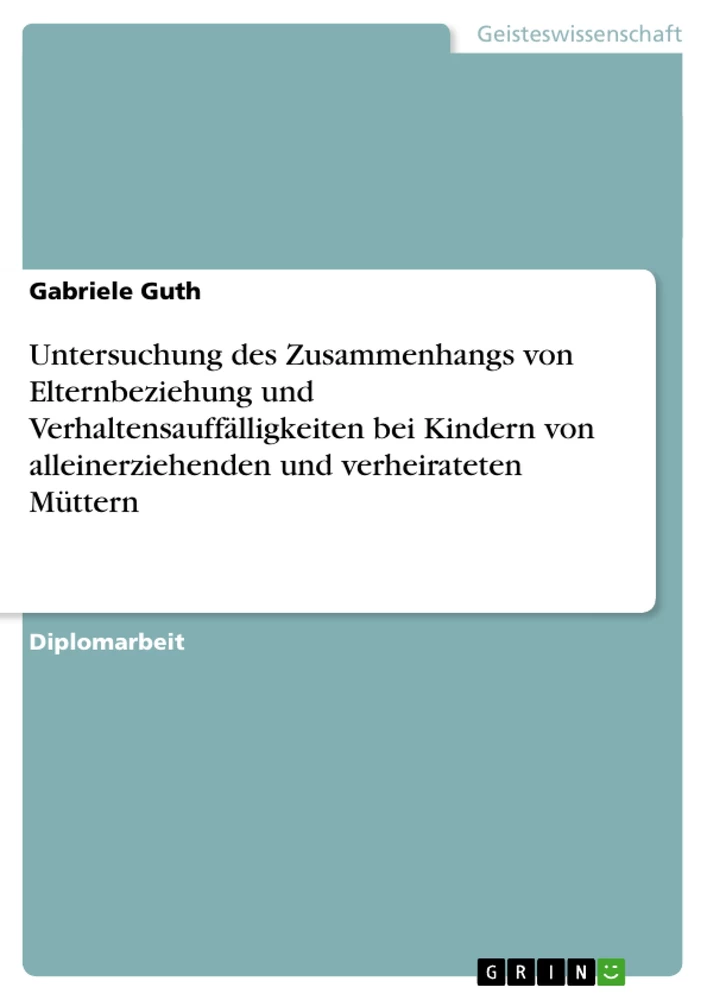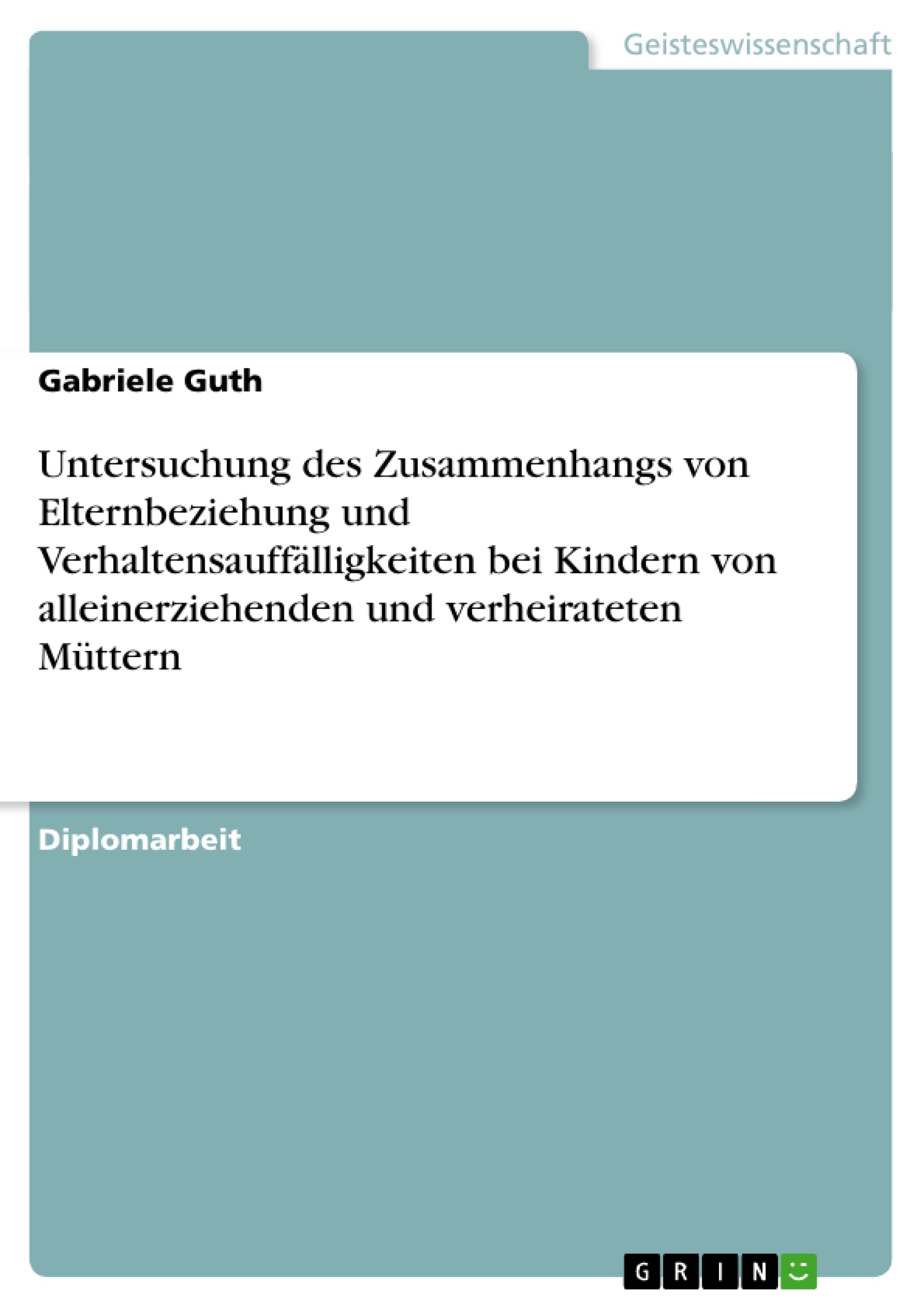Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher wenige Untersuchungen, welche die Partnerschaftszufriedenheit bei Vergleichen von Verheirateten und Alleinerziehenden berücksichtigen. In Bezug auf die Entwicklung von Verhaltensstörungen bei Kindern fand dieser Faktor ebenfalls kaum Beachtung. Ziel dieser Untersuchung war es, einen Beitrag zu der Beantwortung der Forschungsfragen zu leisten, die sich aus dem Einfluss der Elternbeziehung auf die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern von Alleinerziehenden und Verheirateten ergeben.
An einer großen epidemiologischen Stichprobe von alleinerziehenden und verheirateten Müttern (N = 1124) wurden durch Selbstauskünfte mittels Fragebögen die Partnerschaftszufriedenheit und soziodemographische Faktoren erhoben. Die Alleinerziehenden wurden zusätzlich zur Trennungssituation befragt, insbesondere zu Konflikten im Jahr vor der Trennung. Es wurde untersucht, ob diese Variablen im Zusammenhang mit den ebenfalls an beiden Stichproben erhobenen Daten zu Verhaltenauffälligkeiten der Kinder stehen. Außerdem wurde geprüft, ob sich das Verhalten der Kinder von Verheirateten und Alleinerziehenden unterscheidet.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Partnerschaftsqualität der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, unabhängig von den soziodemographischen Variablen Alter und Bildung der Mutter. Je geringer die Partnerschaftsqualität war, desto mehr Verhaltensauffälligkeiten der Kinder wurden berichtet. Auch die eigenen Scheidungserfahrungen, welche die Mütter bei ihren Eltern gemacht hatten, standen damit nicht in Zusammenhang. Die Beziehungsqualität war im Vergleich zu den Verheirateten bei den Alleinerziehenden deutlich geringer, jedoch nur in der Beziehung zum leiblichen Vater der Kinder. Dieser Unterschied zeigte sich nicht bei der Partnerschaftszufriedenheit der Alleinerziehenden in Bezug auf einen neuen Partner. Alleinerziehende schätzten ihre Kinder als verhaltensauffälliger ein. Dies gilt insbesondere für die Jungen und bei diesen vor allem im Bereich externalisierender Auffälligkeiten. Für die Alleinerziehenden konnte der Zusammenhang zwischen elterlichen Konflikten und dem Verhalten der Kinder nachgewiesen werden. Hier waren auch die Konfliktthemen von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Theoretischer Ausgangspunkt: Partnerschaftskonflikte als Risikofaktoren für Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
- Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
- Definition, Erscheinungsformen und Auftretenshäufigkeiten
- Altersunterschiede
- Geschlechtsunterschiede
- Verlaufsmuster
- Komorbidität
- Erklärungsmodelle
- Partnerschaftszufriedenheit
- Stress und Belastungen
- Stress: Auswirkungen und Bewältigung
- Übergang zur Elternschaft
- Erklärungsmodelle
- Auswirkungen auf die Kinder
- Zufriedenheit in der Partnerschaft
- Konflikte zwischen den Eltern
- Art der Konflikte
- Inhalte von Konflikten
- Auffälligkeiten der Kinder
- Geschlechtsunterschiede
- Alter der Kinder
- Vermittelnde Faktoren zwischen Elternkonflikten und dem Verhalten von Kindern
- Theorien und Modelle
- Erziehungsverhalten
- Eltern-Kind-Beziehungen
- Emotionale Sicherheit
- Konflikte und Trennung
- Scheidung
- Scheidungsrisiken
- Auswirkungen auf die Kinder
- Alleinerziehende und ihre Kinder
- Forschungsfragen
- Methode
- Stichprobenbeschreibung, Untersuchungsdurchführung
- Versuchsplan
- Prädiktorvariablen
- Kriteriumsvariable
- Hypothesen
- Instrument
- Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)
- Zufriedenheit in Paarbeziehungen (ZIP)
- Sozialfragebogen
- Trennungsfragebogen (T-FB)
- Statistische Auswertungstechniken (Inferenzstatistik)
- Ergebnisse
- Deskriptive Statistik zu soziodemographischen Variablen
- Hypothesengeleitete inferenzstatistische Analysen
- Hypothese 1: Partnerschaftsqualität
- Hypothese 2: Verhaltensauffälligkeiten
- Hypothese 3: Geschlecht des Kindes
- Hypothese 4: Konfliktpotential
- Hypothese 5: Trennungszeitpunkt
- Hypothese 6: Konfliktlösung
- Diskussion
- Deskriptive Statistik
- Hypothese 1: Partnerschaftsqualität
- Hypothese 2: Verhaltensauffälligkeiten
- Hypothese 3: Geschlechtsunterschiede
- Hypothese 4: Konfliktpotential
- Hypothese 5: Trennungszeitpunkt
- Hypothese 6: Konfliktlösung
- Zusammenfassung
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit zielt darauf ab, den Einfluss der Elternbeziehung auf die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern von Alleinerziehenden und Verheirateten zu untersuchen. Sie analysiert, wie die Partnerschaftszufriedenheit, insbesondere im Hinblick auf Konflikte und Trennungssituationen, mit dem Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zusammenhängt.
- Partnerschaftsqualität und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
- Vergleichende Analyse von Alleinerziehenden und Verheirateten
- Einfluss von Konflikten und Trennung auf das Kind
- Soziodemographische Faktoren und ihre Rolle
- Geschlechtsunterschiede in den Verhaltensauffälligkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Diplomarbeit beginnt mit einer Zusammenfassung der relevanten Literatur zum Thema. Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund, indem es die Definition von Verhaltensauffälligkeiten, die Bedeutung der Partnerschaftszufriedenheit und die Auswirkungen von Elternkonflikten auf Kinder behandelt. Besonders untersucht werden hier die verschiedenen Erklärungsmodelle, die den Zusammenhang zwischen Elternbeziehung und Kindentwicklung verdeutlichen. Kapitel 3 definiert die Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf den Einfluss der Elternbeziehung auf die Verhaltensauffälligkeiten von Kindern von Alleinerziehenden und Verheirateten fokussieren. Kapitel 4 beschreibt die Forschungsmethodik, inklusive der Stichprobenbeschreibung, dem Versuchsplan, den verwendeten Instrumenten und den statistischen Auswertungstechniken. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, sowohl die deskriptive Statistik als auch die hypothesengeleiteten inferenzstatistischen Analysen. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Untersuchung ausführlich diskutiert und in den theoretischen Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, Partnerschaftszufriedenheit, Elternkonflikte, Trennung, Alleinerziehende, Verheiratete, soziodemographische Faktoren, Geschlechtsunterschiede, Erklärungsmodelle, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Partnerschaftsqualität der Eltern die Kinder?
Die Studie zeigt einen deutlichen Zusammenhang: Je geringer die Partnerschaftszufriedenheit der Eltern ist, desto häufiger treten Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern auf.
Gibt es Unterschiede zwischen Kindern von Alleinerziehenden und Verheirateten?
Alleinerziehende schätzen ihre Kinder häufiger als verhaltensauffälliger ein, insbesondere Jungen im Bereich externalisierender Auffälligkeiten (z. B. Aggressivität).
Welche Rolle spielt die Beziehung zum leiblichen Vater bei Alleinerziehenden?
Die Beziehungsqualität zum leiblichen Vater war bei Alleinerziehenden oft deutlich geringer, was im Zusammenhang mit Konflikten vor der Trennung und Auffälligkeiten der Kinder steht.
Haben soziodemographische Faktoren wie Bildung einen Einfluss?
Der Zusammenhang zwischen Partnerschaftsqualität und kindlichen Auffälligkeiten erwies sich als unabhängig von Variablen wie Alter oder Bildungsniveau der Mutter.
Welche Instrumente wurden für die Untersuchung genutzt?
Eingesetzt wurden standardisierte Fragebögen wie der Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) und die Skala zur Zufriedenheit in Paarbeziehungen (ZIP).
- Citation du texte
- Diplom-Psychologin Gabriele Guth (Auteur), 2005, Untersuchung des Zusammenhangs von Elternbeziehung und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern von alleinerziehenden und verheirateten Müttern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69248