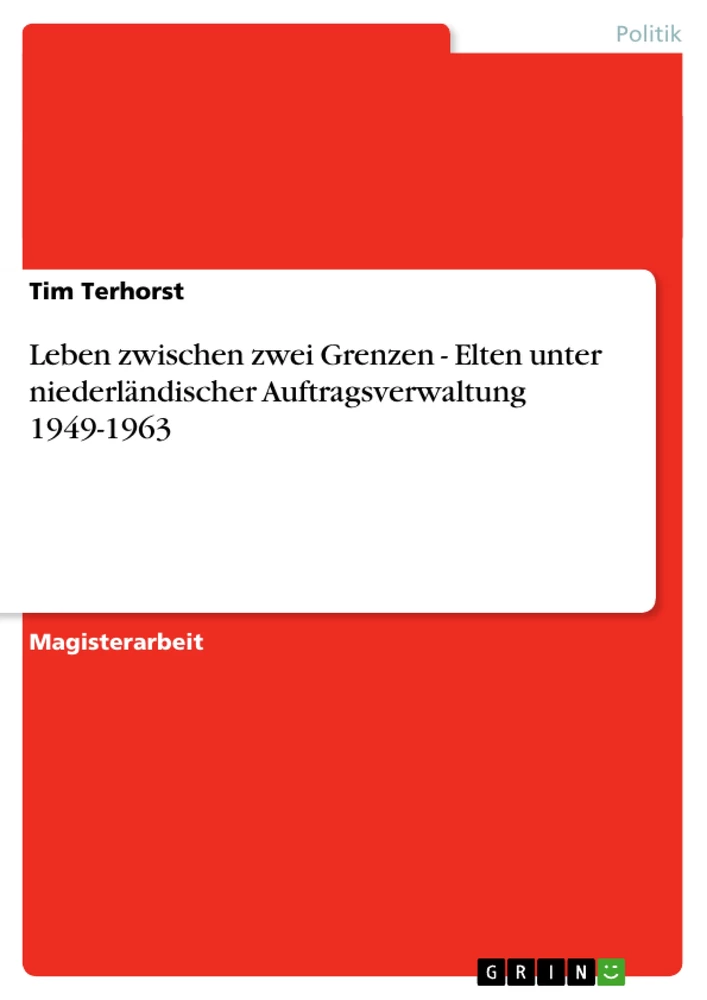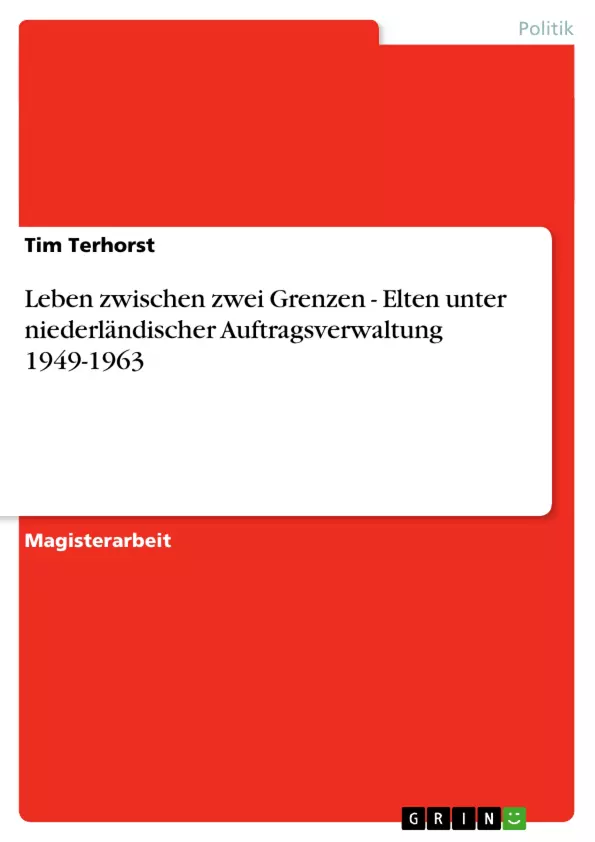Verfolgt man auf einer Landkarte den Verlauf des Rheins von der Quelle bis zur Mündung stößt man, kurz bevor der Fluss das deutsche Staatsgebiet verlässt, auf einen kleinen Punkt namens „Elten“. Seine Bewohner sind stolz auf die mehr als 1000-jährige Geschichte ihres Ortes, die es vor allem dem 83 Meter hohen „Eltenberg“ zu verdanken hat. Auf dieser Erhebung, die einen malerischen aber auch strategisch wichtigen Blick über das Rheintal ermöglicht, standen seit dem 10. Jahrhundert eine Grafenburg, eine Abtei und ein Kloster. Betrachtet man den heutigen deutsch-niederländischen Grenzverlauf an dieser Stelle, erscheint das Gebiet rund um Elten, beinahe wie der abgespreizte Daumen einer flachen Hand. Am 23. April 1949, einem sonnigen Frühlingssamstag - vier Jahre nach den Schrecken des zweiten Weltkrieges und nur einen Monat vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland - amputierten die Niederlande im Zuge der so genannten „Grenzkorrektur“ diesen Daumen vom deutschen Staatsgebiet. Etwas weniger martialisch ausgedrückt: Auf Grundlage der Verhandlungen mit den Alliierten von 1948/49 wurde es dem niederländischen Königreich gestattet, sein Staatsgebiet um insgesamt 69 km² ehemals deutschen Bodens zu vergrößern, darunter auch die Gemeinde Elten mitsamt seinen ca. 3200 Einwohnern. Obwohl die Grenzkorrekturen eigentlich nur einen vorläufigen Charakter hatten, dauerte es 14 Jahre bis das Dorf und seine Bewohner wieder in deutsches Hoheitsgebiet zurückkehrten.
Unter dem Schutz der „Koninklijke Marechaussee“ zog ein großer Tross niederländischer Beamte in den Dorfkern ein und übernahm die Verwaltung des Grenzortes. Aus der „Gemeinde Elten“ wurde das „Drostamt Elten“. Deutsche Briefkästen wurden gegen niederländische ausgetauscht und am Bahnhof fertigten Beamte der „Nederslandse Spoorwegen“ die Züge ab. Sogar die Straßenschilder wurden umgehend ersetzt: Die „Bergstraße“ hieß somit „Bergstraat“. Binnen weniger Wochen war Elten nach außen hin sichtbar zu einem neuen Stück Niederlande geworden. Allerdings existierten auch Bereiche, in denen die „Niederlandisierung“ nicht so schnell voranschritt: So wurde in der katholischen Kirche weiterhin von deutschen Geistlichen in deutscher Sprache gepredigt und in der Volksschule weiterhin von deutschen Lehrkräften nach deutschen Lehrplänen unterrichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Makrohistorischer Kontext..
- 2.1. Niederländische Annexionsforderungen
- 2.2. Vollzug der Grenzkorrekturen trotz öffentlicher Kritik
- 2.3. Verhandlungen um die Rückgabe
- 3. Elten zwischen zwei Grenzen
- 3.1. Der 23. April 1949 – „Als wir bei Holland kamen …“
- 3.2. Politisches Leben in Elten.
- 3.2.1. Eine außergewöhnliche Konstruktion - Das „Drostamt\" Elten
- 3.2.2. Landdrost Dr. Adriaan Blaauboer – Ein pragmatischer Diktator?
- 3.2.3. Secretaris Henk Welling und die Verwaltung – im Dienste des Bürgers?
- 3.2.4. Die,,Commissie van Advies“ – Sprachrohr der Bevölkerung?
- 3.2.5. Wie die,,Maiglöckchen“ für Ordnung sorgten
- 3.3. Wirtschaftsleben.
- 3.3.1. Der Fremdenverkehr - eine „Goldgrube“.
- 3.3.2. Gut Leben an der Grenze? – Die Entwicklung von Handel und Handwerk.
- 3.3.3. Das,,Sorgenkind“ Landwirtschaft
- 3.3.4. Der pendelnde Arbeiter und die ökonomische Lage der Bevölkerung...
- 3.4. Dorfleben.
- 3.4.1. Platzmangel – Die Wohnraumproblematik .
- 3.4.2. Die Volksschule - Ein,,deutscher\" Eckpfeiler
- 3.4.3. Die Katholische Kirche - ein zweiter deutscher Pfeiler?
- 3.4.4. Eingeschränkte Mobilität – Der Grenzverkehr
- 3.4.5. Vereine und Feste - Feiern ohne Grenzen
- 3.5. Der 1. August 1963 – „Die Butternacht“.
- 4. Elten 1946-1963 – Ein Stimmungsbild ..
- 4.1. November 1946 bis April 1949 – Angst und Ungewissheit regieren ..
- 4.2. April 1949 bis Mitte der 50er Jahre – Die Lage entspannt sich.
- 4.3. Mitte der 50er Jahre bis 1963 – Ein Stimmungswandel?
- 5. Schlussfolgerungen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der besonderen Situation der Gemeinde Elten, die im Zuge der Grenzkorrekturen von 1949 bis 1963 unter niederländischer Verwaltung stand. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Zeit auf das Leben der Eltener Bevölkerung in verschiedenen Lebensbereichen, von der politischen und wirtschaftlichen Situation bis hin zum Dorfleben und den sozialen Beziehungen.
- Die Auswirkungen der niederländischen Auftragsverwaltung auf das politische Leben in Elten.
- Die wirtschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen für die Eltener Bevölkerung während der Grenzkorrektur.
- Die Entwicklung des Dorflebens und der sozialen Strukturen in Elten unter dem Einfluss der „Niederlandisierung“.
- Die subjektiven Erfahrungen und Perspektiven der Eltener Bevölkerung während der Grenzkorrektur.
- Die Kontinuitäten und Veränderungen in Elten, die über die Zeit der Grenzkorrektur hinauswirkten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die historische und geografische Einordnung von Elten sowie die Forschungslücke im Bereich der mikrohistorischen Analyse der Grenzkorrekturen hervorhebt. Kapitel 2 beleuchtet den makrohistorischen Kontext der Grenzkorrekturen, indem es die niederländischen Annexionsforderungen, die politischen Debatten und die Verhandlungen um die Rückgabe von Gebieten in den Fokus nimmt.
Kapitel 3 fokussiert auf das Leben in Elten zwischen 1949 und 1963. Die Darstellung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten im Dorfkern veranschaulicht die Herausforderungen und Veränderungen, denen die Eltener Bevölkerung während der niederländischen Auftragsverwaltung ausgesetzt war.
Kapitel 4 widmet sich dem Stimmungsbild in Elten während der verschiedenen Phasen der Grenzkorrektur, beginnend mit der anfänglichen Angst und Ungewissheit bis hin zur zunehmenden Entspannung der Lage und möglichen Stimmungswandel.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen und Themen: Grenzkorrekturen, niederländische Auftragsverwaltung, Elten, Mikrohistorie, Alltag, politische Veränderungen, Wirtschaftsleben, Dorfleben, soziale Strukturen, subjektive Erfahrungen, Kontinuität, Wandel.
- Quote paper
- Tim Terhorst (Author), 2006, Leben zwischen zwei Grenzen - Elten unter niederländischer Auftragsverwaltung 1949-1963, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69307