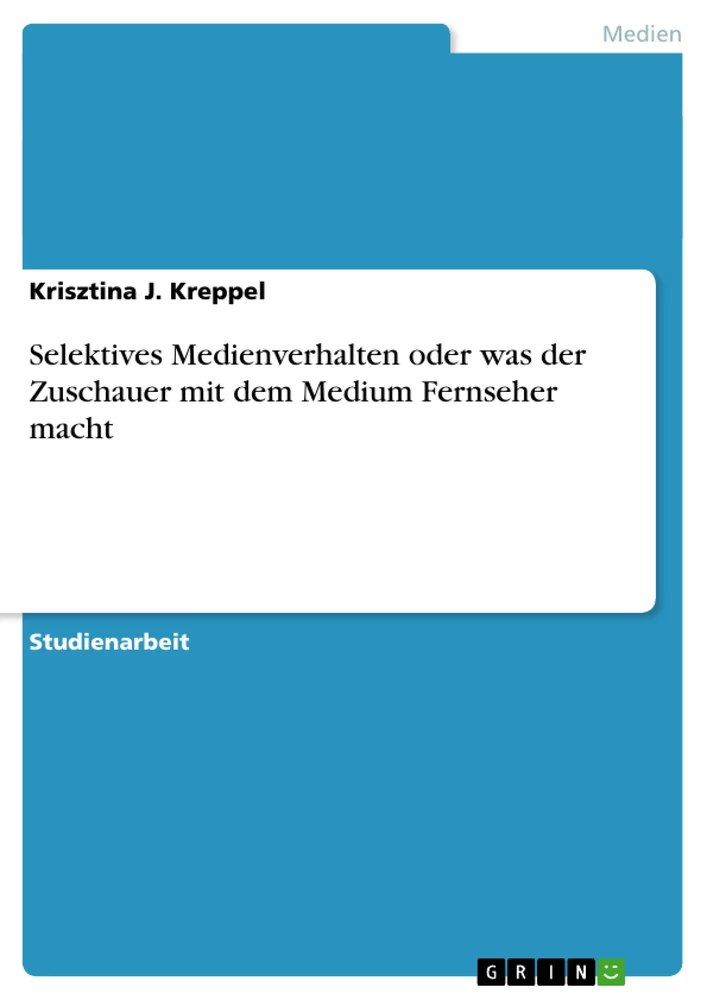INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. THEORETISCHER TEIL
2.1. MEDIENVERHALTEN
2.1.1. Verschiedene Medientypen
2.1.2. Fernseh- und Programmnutzung
2.1.3. Kabelfernsehen
2.1.4. Das Fernsehprogrammangebot
2.1.5. Qualitative Aspekte der Mediennutzung
2.2. PROGRAMM-SELEKTIONSVORGÄNGE
2.2.1. Programm-im-Programm-Selektion
2.2.1.2. Flipping
2.2.1.3. Switching
2.2.1.4. Grazing
2.2.1.5. Psychische Abwesenheit
2.2.2. Selektive Werbevermeidung
2.2.2.1. Zapping
2.2.2.2. Sticker
2.2.2.3. Physisches Zapping
2.2.2.4. Zipping
2.2.2.5. Zipping mit VPS (Video-Programming-System)
2.3. PROGRAMMAUSWAHL UND -ABWAHL
2.3.1. Fehlende Planungsphase, starke Orientierungsphase: Flipping
2.3.2. Starke Reevaluationsphase: Switching
2.4. TV-PHASEN
2.4.1. Präwerbephase
2.4.2. Werbephase
2.4.3. Postwerbephase
2.5. PSYCHOLOGISCHE HINTERGRÜNDE SELEKTIVEN MEDIENVERHALTENS
2.5.1. Technisierung des Lebensraumes
2.5.2. Eskapismus
2.5.3. Zeitökonomie
2.5.4. Prestige
2.5.5. Sozialer Informationsstress
2.5.6. Soziale Hilflosigkeit
2.5.7. Vererbungseffekt
2.5.8. Soziale Medienverpflichtung
2.6. URSACHENZUSCHREIBUNGEN AUS DER SICHT DER FERNSEHZUSCHAUER
2.6.1. Lokation: Internalität und Externalität
2.6.2. Stabilität
2.6.3. Kontrollierbarkeit
3. EMPIRISCHER TEIL
3.1. UNTERSUCHUNGSDESIGN, ERHEBUNG
3.2. STICHPROBENCHARAKTERISTIK
3.3. UMSCHALTQUOTE
3.4. SENDERENTSCHEIDUNG
3.5. PROGRAMMRUBRIKEN UND ZAPPING
3.6. ZAPPER UND STICKER: TRENDS
3.6.1. Geschlecht und Alter
3.6.2. Ausbildung, Beruf und Einkommen
3.6.3. Familie und soziales Umfeld
3.6.4. Sehzeitensegmente
3.6.5. Einstellung zur Werbung und weitere Variablen
3.6.6. TV-Phasen und Zapping
3.7. ZAPPER- UND STICKER-TYPOLOGIEN I: FAKTORENÜBERSICHT
3.7.1. Werbekritikfaktor
3.7.2. Faktor der medienkritischen Senderenttäuschung
3.7.3. Anklagefaktor
3.7.4. Selbsteinschätzungsfaktor
3.7.5. Dritte-Personen-Faktor
3.8. ZAPPER UND STICKER-TYPOLOGIEN II
3.8.1. Segmentierung der Begründungsmuster
3.8.2. Trügerische Mehrheitsvermutung
3.8.3. Emotionale Konsequenzen
3.8.4. Attributionsbezogene Imageanalyse der Fernsehsender
3.9. ERGEBNISSE ZU ANDEREN FORMEN SELEKTIVEN MEDIENVERHALTENS
3.9.1. Zipping
3.9.2. Physisches Zapping
3.9.3.Psychische Abwesenheit
3.9.4. Der Flipper
3.9.5. Der Hopper
3.10. EINFLUß DER PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
4. ZUSAMMENFASSUNG
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1. Medienverhalten
- 2.1.1. Verschiedene Medientypen
- 2.1.2. Fernseh- und Programmnutzung
- 2.1.3. Kabelfernsehen
- 2.1.4. Das Fernsehprogrammangebot
- 2.1.5. Qualitative Aspekte der Mediennutzung
- 2.2. Programm-Selektionsvorgänge
- 2.2.1. Programm-im-Programm-Selektion
- 2.2.2. Selektive Werbevermeidung
- 2.3. Programmauswahl und -abwahl
- 2.4. TV-Phasen
- 2.5. Psychologische Hintergründe selektiven Medienverhaltens
- 2.6. Ursachenzuweisungen aus der Sicht der Fernsehzuschauer
- 3. Empirischer Teil
- 3.1. Untersuchungsdesign, Erhebung
- 3.2. Stichprobencharakteristik
- 3.3. Umschaltquote
- 3.4. Senderentscheidung
- 3.5. Programmrubriken und Zapping
- 3.6. Zapper und Sticker: Trends
- 3.7. Zapper- und Sticker-Typologien I: Faktorenübersicht
- 3.8. Zapper und Sticker-Typologien II
- 3.9. Ergebnisse zu anderen Formen selektiven Medienverhaltens
- 3.10. Einfluss der Programmzeitschriften
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das selektive Medienverhalten von Fernsehzuschauern, insbesondere das Zapping und ähnliche Strategien zur Vermeidung von Werbung oder zur gezielten Programmauswahl. Ziel ist es, die psychologischen und soziologischen Faktoren zu analysieren, die dieses Verhalten beeinflussen. Die empirische Untersuchung soll verschiedene Zuschauertypen identifizieren und deren Motivationen beschreiben.
- Selektive Programmauswahl und Werbevermeidung
- Psychologische Hintergründe des Medienverhaltens
- Einflussfaktoren wie Zeitökonomie und sozialer Druck
- Typologisierung von Zapping-Verhalten
- Analyse der Ergebnisse der empirischen Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Fernsehen als ein Phänomen, das sowohl Stütze als auch Bedrohung der individuellen Zeitgestaltung darstellt. Es wird darauf hingewiesen, dass Fernsehkonsum ein Ausdruck der gesellschaftlichen Zeitnot sein kann und dass die ständige Reizüberflutung des Fernsehens sich auf die Zuschauer auswirkt. Die Einleitung dient als Einführung in die Thematik des selektiven Medienverhaltens und seiner gesellschaftlichen Einbettung.
2. Theoretischer Teil: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es wird das Konzept des dualen Fernsehens und die damit einhergehende Zunahme an Programmen und die daraus resultierende Notwendigkeit selektiven Medienverhaltens erläutert. Der Abschnitt beschreibt verschiedene Formen selektiven Medienverhaltens, wie Zapping, Flipping und Switching, und analysiert die psychologischen und soziologischen Faktoren, die dieses Verhalten beeinflussen, wie z.B. Zeitökonomie, Eskapismus und sozialer Druck. Es werden verschiedene Medientypen vorgestellt und die Ausdifferenzierung von Mediennutzungsmustern untersucht.
3. Empirischer Teil: Dieser Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung zum selektiven Medienverhalten. Es werden das Untersuchungsdesign, die Stichprobe und die erhobenen Daten detailliert dargestellt. Die Ergebnisse zur Umschaltquote, Senderentscheidung, Programmrubriken und Zapping werden präsentiert. Der Fokus liegt auf der Analyse von Zapper- und Sticker-Typologien, der Identifizierung verschiedener Zuschauergruppen anhand ihrer Motive und des Einflusses von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung und sozialem Umfeld. Zusätzlich werden andere Formen selektiven Medienverhaltens wie Zipping und physisches Zapping untersucht.
Schlüsselwörter
Selektives Medienverhalten, Zapping, Flipping, Switching, Werbevermeidung, Fernsehnutzung, Programmselektion, Psychologische Faktoren, Soziologische Faktoren, Empirische Untersuchung, Zuschauertypologien, Zeitökonomie, Mediennutzungsmuster.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Selektives Medienverhalten
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht das selektive Medienverhalten von Fernsehzuschauern, insbesondere das Zapping und ähnliche Strategien zur Vermeidung von Werbung oder zur gezielten Programmauswahl. Analysiert werden die psychologischen und soziologischen Faktoren, die dieses Verhalten beeinflussen. Ziel ist die Identifizierung verschiedener Zuschauertypen und die Beschreibung ihrer Motivationen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Selektive Programmauswahl und Werbevermeidung, psychologische Hintergründe des Medienverhaltens, Einflussfaktoren wie Zeitökonomie und sozialer Druck, Typologisierung von Zapping-Verhalten und die Analyse der Ergebnisse der empirischen Untersuchung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil legt die Grundlagen zum selektiven Medienverhalten dar, während der empirische Teil die Ergebnisse einer Untersuchung präsentiert. Zusätzlich enthält die Arbeit eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste von Schlüsselwörtern.
Was wird im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil beschreibt das Konzept des dualen Fernsehens und die Notwendigkeit selektiven Medienverhaltens aufgrund der Programmanzahl. Er erläutert verschiedene Formen selektiven Medienverhaltens (Zapping, Flipping, Switching) und analysiert die psychologischen und soziologischen Einflussfaktoren (Zeitökonomie, Eskapismus, sozialer Druck). Verschiedene Medientypen und die Ausdifferenzierung von Mediennutzungsmustern werden ebenfalls untersucht.
Was wird im empirischen Teil behandelt?
Der empirische Teil beschreibt das Untersuchungsdesign, die Stichprobe und die erhobenen Daten. Präsentiert werden die Ergebnisse zur Umschaltquote, Senderentscheidung, Programmrubriken und Zapping. Der Fokus liegt auf der Analyse von Zapper- und Sticker-Typologien, der Identifizierung verschiedener Zuschauergruppen und dem Einfluss von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung und sozialem Umfeld. Andere Formen selektiven Medienverhaltens (Zipping, physisches Zapping) werden ebenfalls untersucht.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung, deren Design, Stichprobe und Datenerhebung im Detail im empirischen Teil beschrieben werden. Die genauen Methoden der Datenauswertung werden im Text ebenfalls erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen Daten zur Umschaltquote, Senderentscheidung, Programmrubriken und Zapping. Ein wichtiger Teil der Ergebnisse konzentriert sich auf die Identifizierung und Beschreibung von Zapper- und Sticker-Typologien, also verschiedener Zuschauergruppen mit unterschiedlichen Motiven für ihr selektives Medienverhalten. Der Einfluss von Faktoren wie Alter, Geschlecht und Bildung wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selektives Medienverhalten, Zapping, Flipping, Switching, Werbevermeidung, Fernsehnutzung, Programmselektion, Psychologische Faktoren, Soziologische Faktoren, Empirische Untersuchung, Zuschauertypologien, Zeitökonomie, Mediennutzungsmuster.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit Mediennutzung, Medienpsychologie und dem Einfluss von Medien auf das individuelle Verhalten auseinandersetzen. Die Ergebnisse können für die Medienforschung, die Medienplanung und das Medienmarketing von Bedeutung sein.
- Quote paper
- Krisztina J. Kreppel (Author), 1998, Selektives Medienverhalten oder was der Zuschauer mit dem Medium Fernseher macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69337