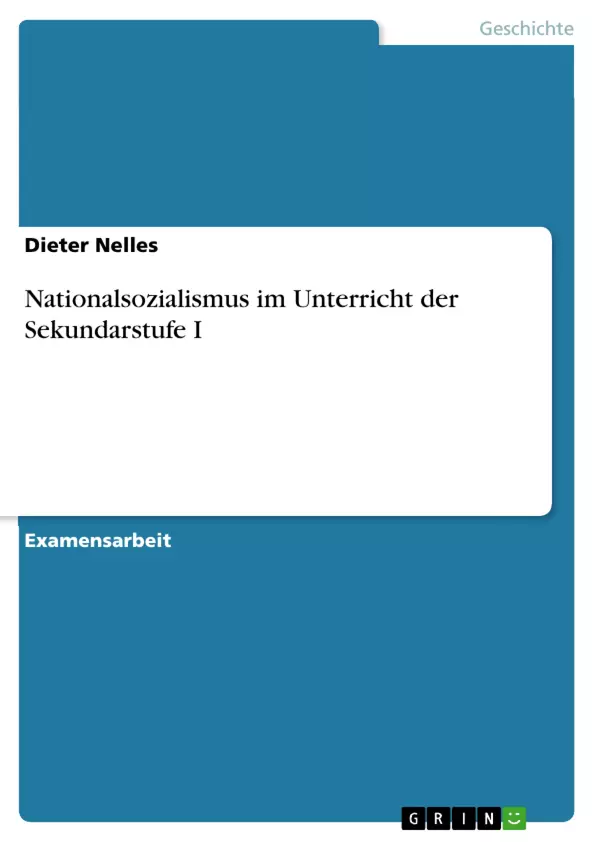Das Thema der Arbeit ist die Frage, wie auf dem Hintergrund der veränderten Erinnerung an den Nationalsozialismus mit dem demographischen Wandel (Generationenfolge und Einwanderung) im historisch-politischen Unterricht in der Schule über Nationalsozialismus umzugehen ist. Die Diskussion über diese Frage steckt noch in den Anfängen und wird bislang eher von Wissenschaftlern (Erziehungs- und Sozialwissenschaftlern, Geschichts- und Politikdidaktikern) und Mitarbeitern außerschulischer Bildungseinrichtungen denn von schulischen Praktikern geführt.
In der vorliegenden Arbeit wird die Fragestellung auf drei Ebenen thematisiert:
1. Aus welcher bildungstheoretischen Perspektive soll der Nationalsozialismus vermittelt werden? Was bedeutet dies für die methodisch-didaktische Umsetzung im Unterricht?
2. Wie soll der Nationalsozialismus pädagogisch bearbeitet werden? Was sollen die Schüler aus der Geschichte lernen? Was sind die moralischen Lernziele?
3. Welche fachlichen Anforderungen verlangt dies von den Lehrenden?
Ausgangspunkt meiner Überlegungen bilden meine Erfahrungen aus einer Unterrichtsreihe – Gewalt im 20. Jahrhundert am Beispiel des Ersten und Zweiten Weltkrieges -, die ich in einer Klasse 9 der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler (GELS) in Wuppertal im Fach Gesellschaftslehre (GL) durchgeführt habe.
Ausgehend von diesen Erfahrungen betrachte ich zunächst in Kapitel 2 die Bedingungen, die für heutige Jugendliche in Deutschland bei der schulischen Vermittlung des Themas Nationalsozialismus und Holocaust bestehen. Und fasse dann in einem zweiten Schritt wesentliche Aspekte der Diskussionen der letzten Jahre zu diesem Thema zusammen.
Auf dieser Basis entwickele ich in Kapitel 3 Vorschläge, wie eine „Erziehung nach Auschwitz“ umgesetzt werden könnte, auf der Ebene der Lerninhalte und des unterrichtlichen Zugangs, auf der pädagogischen Ebene und auf der Ebene der Lehrenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Unterrichtsreihe „Gewalt im 20. Jahrhundert“
- 3.1. Lerngruppe und Unterrichtsverlauf
- 3.2. Reflexion
- 3. Schule und Nationalsozialismus
- 3. 1. Bedingungen
- 3.1.1. Nationalsozialismus und Familiengedächtnis
- 3.1.2. Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland
- 3.1.3. Nationalsozialismus im Unterricht
- 3. 2. Schulischer Unterricht und Nationalsozialismus
- 3.2.1. Perspektiven zum Unterricht über Nationalsozialismus
- 3.2.2. Didaktische Zugriffe
- 4. Vorschläge für die Praxis
- 4. 1. Unterricht
- 4. 2. Pädagogische Bearbeitung
- 4. 3. Lehrende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie im historischen Unterricht über den Nationalsozialismus und den Holocaust in der heutigen Zeit sinnvoll unterrichtet werden kann. Im Zentrum stehen die sich verändernden Bedingungen und Herausforderungen der deutschen Gesellschaft, die durch die Generationenfolge und Einwanderung geprägt sind. Die Arbeit analysiert die aktuellen Debatten um die Vermittlung des Nationalsozialismus und entwickelt konkrete Vorschläge für die Praxis, die sowohl die didaktische als auch die pädagogische Dimension des Themas berücksichtigen.
- Die Bedeutung des Nationalsozialismus und des Holocaust in der heutigen Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Vermittlung von Geschichte in einer multikulturellen Gesellschaft
- Die pädagogischen Ziele und Lerninhalte einer „Erziehung nach Auschwitz“
- Die Rolle des Lehrers bei der Vermittlung von Geschichte und der Förderung kritischer Reflexion
- Die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für die Gegenwart und Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit einer „Erziehung nach Auschwitz“ im Kontext der sich verändernden Erinnerungskulturen und gesellschaftlichen Debatten. Es werden die Herausforderungen diskutiert, die sich aus dem demographischen Wandel, dem Aussterben der Zeitzeugen und der wachsenden biographischen Distanz zum Nationalsozialismus ergeben.
Das zweite Kapitel stellt eine Unterrichtsreihe zum Thema „Gewalt im 20. Jahrhundert“ vor, die der Autor in einer Klasse 9F der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler (GELS) durchgeführt hat. Es werden die Rahmenbedingungen der Unterrichtsreihe, der Lernverlauf und die Reflexionen des Autors auf die Erfahrungen dargestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Bedingungen für die schulische Vermittlung des Themas Nationalsozialismus und Holocaust. Es werden die verschiedenen Perspektiven auf den Nationalsozialismus, die unterschiedlichen Geschichtsbilder junger Migranten in Deutschland und die didaktischen Zugriffe im Unterricht diskutiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Entwicklung von Vorschlägen für die Praxis, die auf der Ebene der Lerninhalte, des unterrichtlichen Zugangs, der pädagogischen Ebene und der Ebene der Lehrenden umgesetzt werden könnten. Es werden konkrete Ideen für die Gestaltung einer „Erziehung nach Auschwitz“ im 21. Jahrhundert vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der politischen Bildung und der Didaktik, insbesondere mit den Schlüsselbegriffen „Nationalsozialismus“, „Holocaust“, „Erziehung nach Auschwitz“, „Generationenfolge“, „Einwanderung“, „multikulturelle Gesellschaft“, „geschichtspolitische Debatten“, „Zeitzeugen“, „biographische Distanz“, „didaktische Zugriffe“, „pädagogische Ziele“ und „Lehrerfunktion“. Die Arbeit legt den Fokus auf die Herausforderungen der Vermittlung von Geschichte in einer sich wandelnden Gesellschaft und die Bedeutung der kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Erziehung nach Auschwitz“ im heutigen Unterricht?
Es geht darum, wie der Nationalsozialismus vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des Aussterbens von Zeitzeugen moralisch und fachlich vermittelt werden kann.
Welche Rolle spielt die Einwanderung für die Geschichtsvermittlung?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Geschichtsbilder junger Migranten und wie der Unterricht auf diese vielfältigen familiären Hintergründe reagieren muss.
Was sind die zentralen Lernziele beim Thema Holocaust?
Neben fachlichem Wissen stehen moralische Lernziele und die Förderung kritischer Reflexion über Gewalt und Diskriminierung im Vordergrund.
Welche Anforderungen werden an die Lehrenden gestellt?
Lehrer müssen nicht nur fachlich kompetent sein, sondern auch sensibel auf die biographische Distanz der Schüler und aktuelle gesellschaftliche Debatten eingehen können.
Wie kann der Unterricht praktisch gestaltet werden?
Die Arbeit schlägt neue didaktische Zugriffe vor, die über klassische Methoden hinausgehen und die heutige Lebenswelt der Jugendlichen einbeziehen.
- Citation du texte
- Dr. Dieter Nelles (Auteur), 2006, Nationalsozialismus im Unterricht der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69371