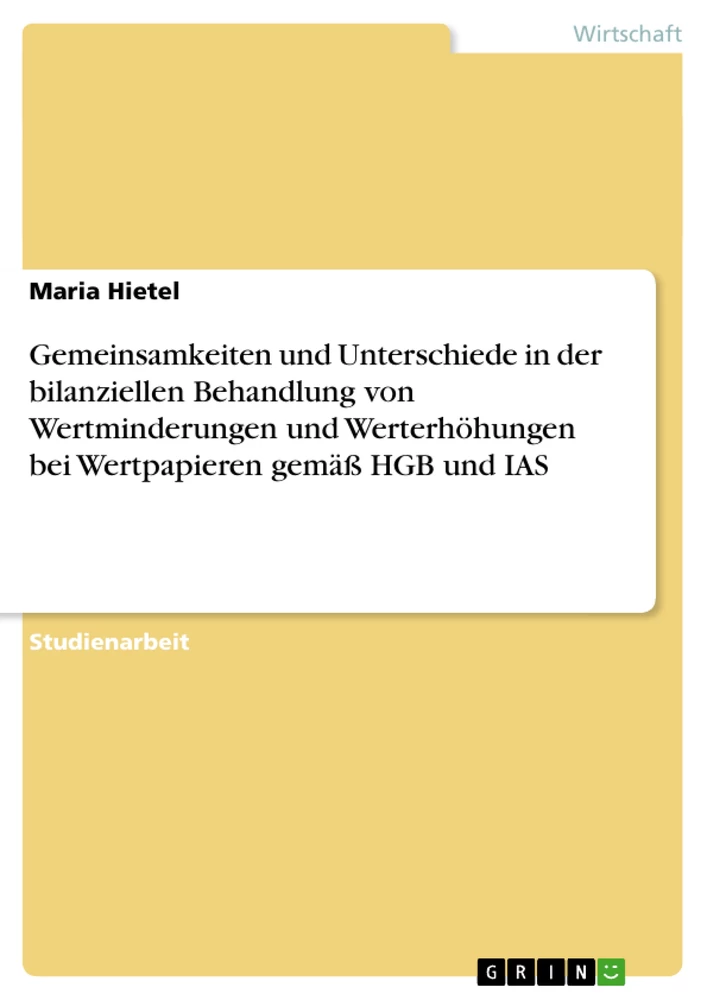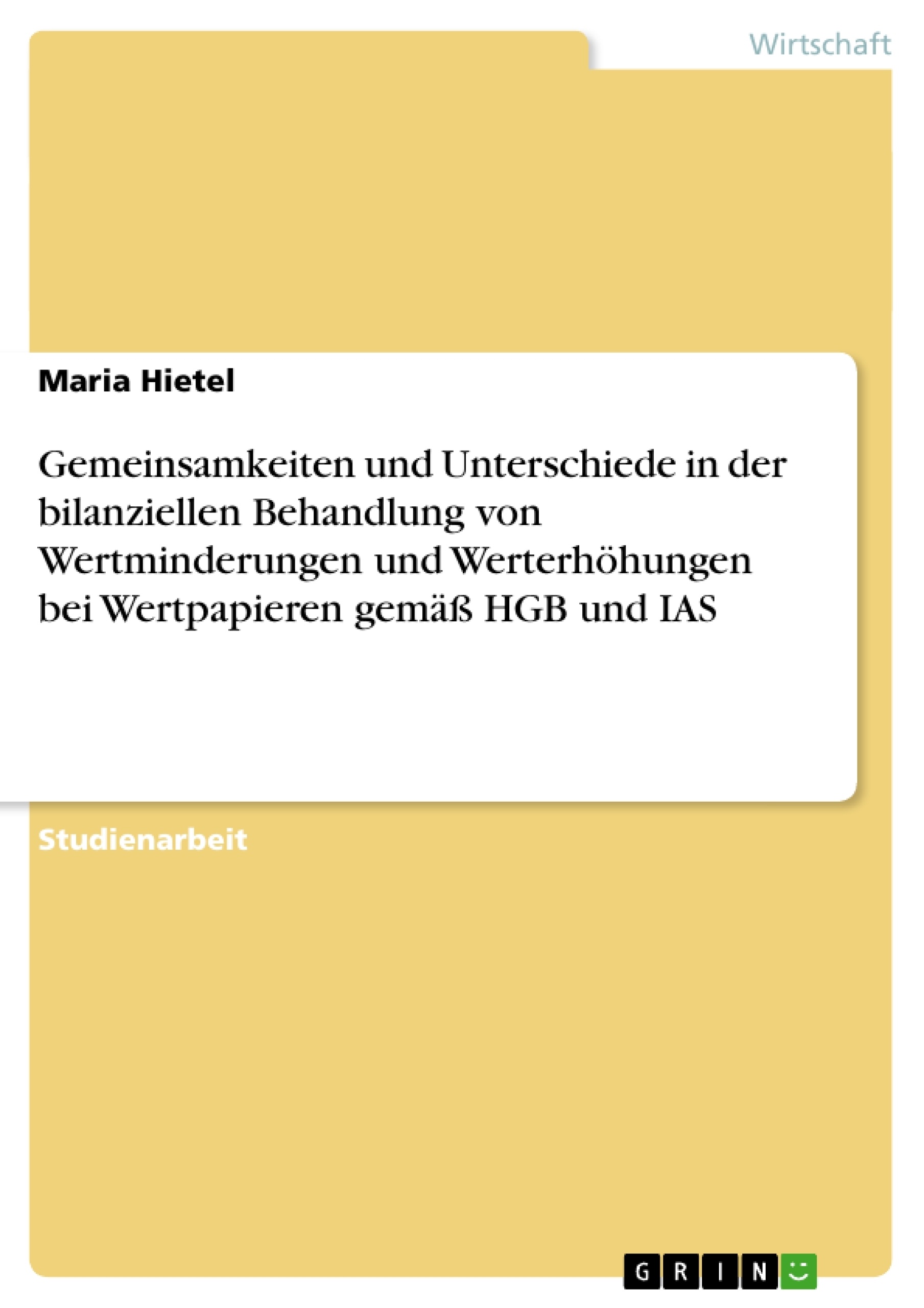In der deutschen Rechnungslegung vollzieht sich, angestoßen durch Globalisierungstendenzen in der Wirtschaft und erhöhten Kapitalbedarf von Unternehmen, ein grundlegender Wandel. Prinzipien, die lange als unantastbar galten, geraten in den fachwissenschaftlichen Blickpunkt.
Ein Grund dafür ist, dass das deutsche Rechnungslegungsrecht auf Grundlage des Handelsgesetzbuches sich den Vorwurf gefallen lassen muss, die tatsächliche Vermögens-, Finanz-und Ertragslage eines Unternehmens nur unvollständig wiederzugeben. Ein Kritikpunkt ist z.B. die Steueroptimierung der Jahresabschlüsse aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzipes, da viele Unternehmen im Dienste einer geringeren Steuerlast ihr Ergebnis bilanzpolitisch schmälern. Auch die zulässige Bildung (unsichtbarer) stiller Reserven durch Ausnutzung von Wahlrechten und Unterbewertung führt dazu, dass nicht alle entscheidungsrelevanten Informationen an den jeweiligen Adressaten des Jahresabschlusses vermittelt werden. Demnach geraten also grundlegende bilanztheoretische Fragen wie z.B. die Bewertungsmaßstäbe des HGB, also die Behandlung von Wertminderungen und Werterhöhungen bei Vermögensgegenständen des Unternehmens, in den Brennpunkt der Kritik. Gegenüber diesen Problemen zeigt man sich auch in der Praxis kritisch: eine Studie der Price Waterhouse Coopers in Zusammenarbeit mit der Universität Frankfurt/Oder zeigt z.B., dass unter befragten Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft 97% den HGB- Jahresabschluss als Hindernis für die Auslandsnachfrage nach deutschen Aktien betrachten. In deutschen Unternehmen, die international tätig sind, hat sich daher in den letzten Jahren die Praxis entwickelt, neben dem HGB- Jahresabschluss noch einen weiteren Abschluss nach internationalen Standards aufzustellen, d.h. entweder Rechnungslegung nach den US Generally Accepted Accounting Principles (US-Gaap) oder nach den europäischen International Accounting Standards (IAS). Im neuen Segment der Deutschen Börse AG für junge und wachstumsstarke Unternehmen, dem TecDAX, ist die Bilanzierung nach diesen international anerkannten Grundsätzen zur Erfüllung umfangreicher Publizitäts- und Transparenzkriterien sogar Pflicht. In einer Übergangsregelung bis 31. Dezember 2004 sind auch alle anderen deutschen Unternehmen, die einen Abschluss nach internationalem Recht aufstellen, durch den § 292a HGB von der Verpflichtung zur Erstellung eines Abschlusses nach deutschem Recht befreit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundsätzliche Überlegungen
- Einführende Gegenüberstellung der Rechnungslegung nach IAS und HGB
- Wertpapiere im Unternehmen
- Bilanzierung von Wertpapieren nach IAS
- Wertbegriffe und Wertpapierkategorien nach IAS
- Held to maturity securities
- Trading securities
- Available for sale securities
- Umgruppierung von Wertpapieren
- Wertbegriffe und Wertpapierkategorien nach IAS
- Bilanzierung von Wertpapieren nach HGB
- Wertbegriffe und Wertpapierkategorien nach HGB
- Wertpapiere des Anlagevermögens
- Wertpapiere des Umlaufvermögens
- Weiterführende Erkenntnisse
- Vergleichaspekte in der Wertpapierbewertung nach IAS und HGB
- Die Entwicklung der Rechnungslegung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der bilanziellen Behandlung von Wertminderungen und Werterhöhungen bei Wertpapieren gemäß HGB und IAS. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Bewertungsgrundsätze beider Rechnungslegungssysteme und untersucht die Auswirkungen auf die Darstellung der Unternehmenslage. Der Fokus liegt auf den Regelungen, die für alle Unternehmen gelten, ohne branchenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.
- Vergleich der Bewertungsgrundsätze von IAS und HGB bei Wertpapieren
- Analyse der Auswirkungen von Wertminderungen und Werterhöhungen auf die Unternehmensbilanz
- Bedeutung der internationalen Rechnungslegung im Kontext der Globalisierung
- Untersuchung der Entwicklung der Rechnungslegung in Deutschland
- Bewertung des Einflusses von IAS auf die Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert den grundlegenden Wandel in der deutschen Rechnungslegung, der durch die Globalisierung und den erhöhten Kapitalbedarf von Unternehmen angestoßen wird. Sie beleuchtet die Kritikpunkte am HGB und die wachsende Bedeutung internationaler Rechnungslegungsstandards wie IAS.
- Grundsätzliche Überlegungen: Dieses Kapitel stellt die Grundphilosophien der Rechnungslegung nach IAS und HGB einander gegenüber. Es erläutert die Entstehung und Struktur der International Accounting Standards und führt in die wichtigsten Kategorien von Wertpapieren ein.
- Bilanzierung von Wertpapieren nach IAS: Dieses Kapitel analysiert die Wertbegriffe und Wertpapierkategorien im IAS, darunter Held to maturity securities, Trading securities und Available for sale securities. Es behandelt die Umgruppierung von Wertpapieren und die Bewertung von Available for sale securities.
- Bilanzierung von Wertpapieren nach HGB: Dieses Kapitel betrachtet die Wertbegriffe und Wertpapierkategorien im HGB, die Unterscheidung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen und die relevanten Bewertungsgrundsätze.
- Weiterführende Erkenntnisse: Dieses Kapitel beleuchtet Vergleichaspekte der Wertpapierbewertung nach IAS und HGB und diskutiert die Entwicklung der Rechnungslegung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den zentralen Themen der Rechnungslegung, insbesondere der Behandlung von Wertminderungen und Werterhöhungen bei Wertpapieren. Die wichtigsten Schlüsselwörter umfassen: International Accounting Standards (IAS), Handelsgesetzbuch (HGB), Wertpapiere, Bewertungsgrundsätze, Fair Value, Held to maturity, Trading securities, Available for sale securities, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Globalisierung, Transparenz, Vergleichbarkeit, Unternehmensbilanz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen HGB und IAS bei Wertpapieren?
Das HGB folgt dem Vorsichtsprinzip und dem Anschaffungskostenmodell, während die IAS (jetzt IFRS) verstärkt auf den „Fair Value“ (Marktwert) setzen, um die Transparenz zu erhöhen.
Was bedeutet das Vorsichtsprinzip im HGB?
Es besagt, dass Gewinne erst ausgewiesen werden dürfen, wenn sie realisiert sind, während Verluste bereits bei ihrer Absehbarkeit berücksichtigt werden müssen.
Welche Wertpapierkategorien gibt es im IAS?
IAS unterscheidet unter anderem zwischen „Held to maturity“ (bis zur Endfälligkeit gehalten), „Trading“ (zu Handelszwecken) und „Available for sale“ (zur Veräußerung verfügbar).
Warum nutzen immer mehr deutsche Unternehmen internationale Standards?
Internationale Standards wie IAS/IFRS erleichtern den Zugang zum globalen Kapitalmarkt, da sie die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse für ausländische Investoren erhöhen.
Was sind „stille Reserven“?
Stille Reserven entstehen im HGB durch Unterbewertung von Vermögen oder Überbewertung von Schulden. Sie sind für Externe nicht sofort erkennbar und schmälern optisch das Ergebnis.
Wie werden Wertminderungen im HGB behandelt?
Im HGB müssen Wertminderungen im Umlaufvermögen nach dem strengen Niederstwertprinzip zwingend abgeschrieben werden, im Anlagevermögen nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung.
- Arbeit zitieren
- Maria Hietel (Autor:in), 2003, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der bilanziellen Behandlung von Wertminderungen und Werterhöhungen bei Wertpapieren gemäß HGB und IAS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69387