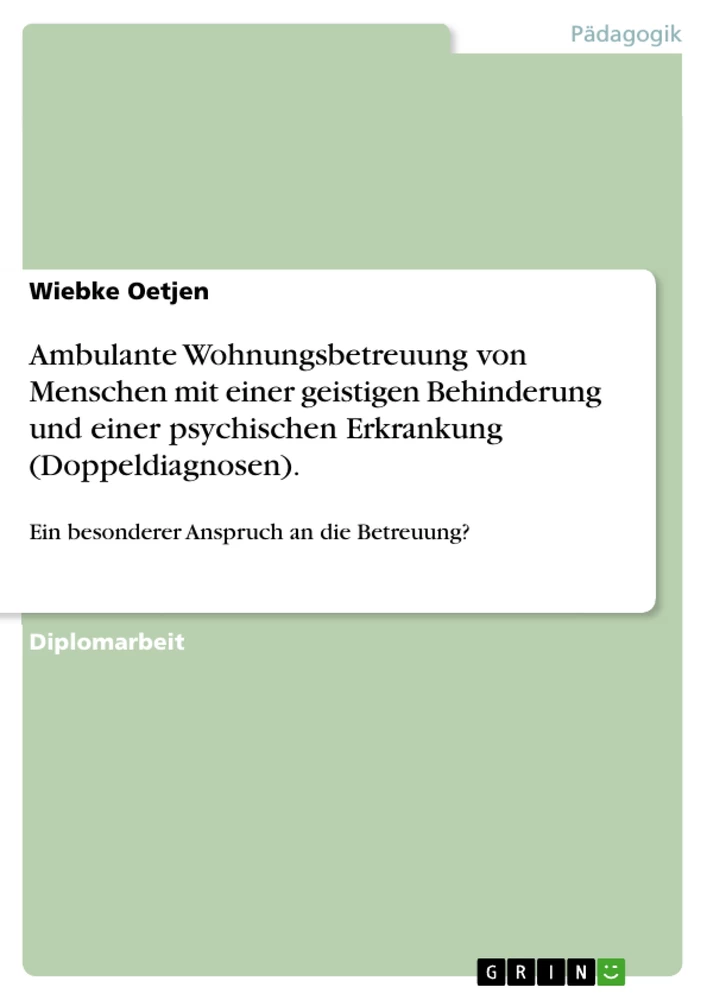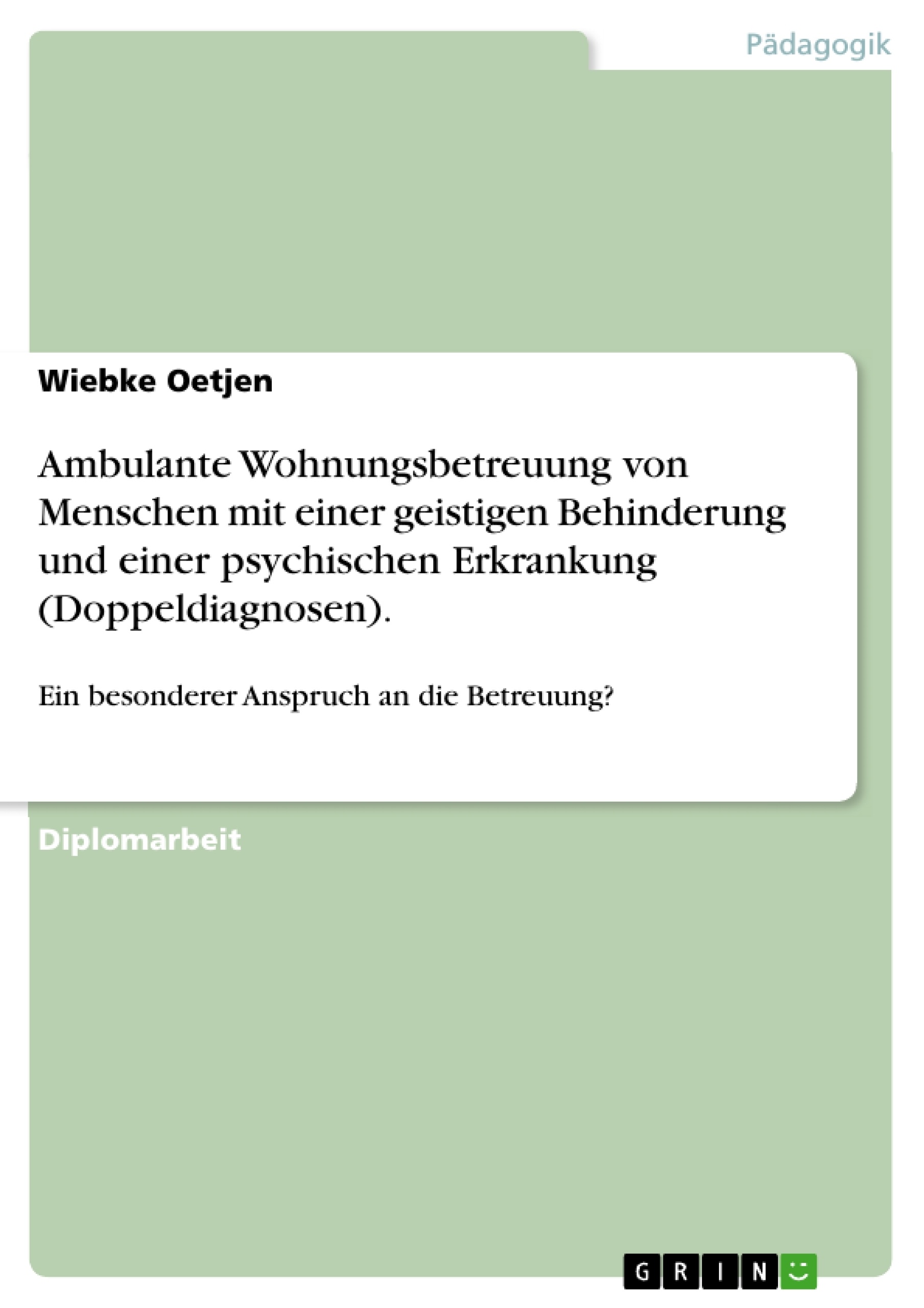Fordert die ambulante Wohnungsbetreuung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer zusätzlichen psychischen Erkrankung einen besonderen Anspruch an die Betreuung?
Mit dieser Fragestellung setzt sich die folgende Diplomarbeit detailliert auseinander und sucht nach einer theoretischen Abhandlung unterstützende Aussagen in Interviews mit Betroffenen und Betreuern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- THEORETISCHER TEIL
- I. Ambulante Wohnungsbetreuung
- I.1. Allgemeines Verständnis von „Ambulanter Wohnungsbetreuung“
- I.2. Entstehung und Geschichte
- I.3. Aktuelle Situation
- II. Exkurs: Wohnen als Grundbedürfnis des Menschen
- II.1. Anthropologisches Verständnis vom Wohnen
- II.2. Wohnen als psychologisches Grundbedürfnis des Menschen
- III. Geistige Behinderung und psychische Erkrankungen
- III.1. Das pädagogische Dilemma der Begriffsbestimmung
- III.2. Definitionsgrundlagen
- III.2.1. Geistige Behinderung
- III.2.1.1. Geistige Behinderung als soziale Konstruktion
- III.2.1.2. Vorurteile gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung als Stigma
- III.2.2. Psychische Erkrankung
- III.2.2.1. Psychische Erkrankungen als Ausdruck veränderter Entwicklungspfade
- IV. Psychische Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung – Ein langer Weg der Erkenntnis
- V. Doppeldiagnosen
- V.1. Allgemeines Verständnis von sogenannten Doppeldiagnosen
- V.2. Epidemiologie, Prävalenz und Symptomatik
- V.3. Besonderheiten in dem Erscheinungsbild von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung
- V.4. Erhöhte Risikofaktoren in der Sozialisation von Menschen mit geistiger Behinderung
- VI. Exemplarische Darstellung der Entstehung von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung am Beispiel von Verhaltensauffälligkeiten
- VII. Rehistorisierende Diagnostik als Schlüssel zum Verstehen
- VIII. Ambulante Wohnungsbetreuung bei Menschen mit Doppeldiagnosen
- VIII.1. Arbeitsschwerpunkte in der ambulanten Wohnungsbetreuung
- VIII.2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der ambulanten Wohnungsbetreuung und der Doppeldiagnose?
- VIII.3. Besonderheiten in der Betreuung von Menschen mit Doppeldiagnosen
- VIII.4. Macht und Ohnmacht in der Betreuung
- EMPIRISCHER TEIL
- QUALITATIVE ERHEBUNG
- IX. Methodische Vorbereitung und Durchführung der Interviewerhebung
- X. Durchführung der Interviews
- X.1. Auswahl der Institution
- X.2. Auswahl der Interviewpartner
- X.3. Kontaktaufnahme und Rahmenbedingungen der Interviews
- X.4. Kurzbiografien der interviewten Klienten
- X.4.1. Biografischer Hintergrund von Tim
- X.4.2. Biografischer Hintergrund von Olaf
- XI. Auswertung der Interviews
- XI.1. Auswertung der Interviewaussagen von Tim
- XI.2. Auswertung der Interviewaussagen von Olaf
- XI.3. Auswertung der Interviewaussagen von Betreuer 1
- XI.4. Auswertung der Interviewaussagen von Betreuerin 2
- XII. Interpretation der Interviewaussagen
- XII.1. Interpretation der Klienteninterviews
- XII.2. Interpretation der Interviews mit dem Fachpersonal
- XII.3. Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse aus den Interpretationen
- XIII. Gesamtzusammenfassung
- Der Einfluss von Doppeldiagnosen auf die Betreuungspraxis
- Die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen in der Arbeit mit Menschen mit Doppeldiagnosen
- Die Bedeutung einer rehistorisierenden Diagnostik für ein besseres Verständnis der individuellen Situation
- Die Rolle von Vorurteilen und Stigmatisierung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung
- Die aktuelle Situation der ambulanten Wohnungsbetreuung für Menschen mit Doppeldiagnosen
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Motivation und die Fragestellungen der Autorin dar, die aus ihrer eigenen Erfahrung in der ambulanten Wohnungsbetreuung entstanden sind. Sie beschreibt die Ambivalenz zwischen persönlichem Empfinden und der Beurteilung ihrer Arbeit von außen und die Schwierigkeiten, die mit dem Thema „geistige Behinderung und psychische Erkrankung“ verbunden sind.
- I. Ambulante Wohnungsbetreuung: Dieses Kapitel beleuchtet das allgemeine Verständnis von ambulanter Wohnungsbetreuung, deren Entstehung und Geschichte sowie die aktuelle Situation in Deutschland.
- II. Exkurs: Wohnen als Grundbedürfnis des Menschen: Dieses Kapitel betrachtet Wohnen aus anthropologischer und psychologischer Perspektive und betont die Bedeutung von Wohnen als Grundbedürfnis des Menschen.
- III. Geistige Behinderung und psychische Erkrankungen: Dieses Kapitel analysiert die pädagogischen Herausforderungen, die mit der Begriffsbestimmung von geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung verbunden sind. Es beleuchtet die Definitionsgrundlagen beider Konzepte, einschließlich der sozialen Konstruktion von geistiger Behinderung und der damit verbundenen Vorurteile und Stigmatisierung.
- IV. Psychische Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung – Ein langer Weg der Erkenntnis: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Erkenntnisse über psychische Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung.
- V. Doppeldiagnosen: Dieses Kapitel definiert Doppeldiagnosen, untersucht die epidemiologischen und symptomatischen Aspekte sowie die besonderen Erscheinungsformen psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Außerdem werden die erhöhten Risikofaktoren in der Sozialisation dieser Personengruppe betrachtet.
- VI. Exemplarische Darstellung der Entstehung von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung am Beispiel von Verhaltensauffälligkeiten: Dieses Kapitel untersucht exemplarisch die Entstehung von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung anhand des Beispiels von Verhaltensauffälligkeiten.
- VII. Rehistorisierende Diagnostik als Schlüssel zum Verstehen: Dieses Kapitel argumentiert für die Bedeutung einer rehistorisierenden Diagnostik, um ein besseres Verständnis der individuellen Situation von Menschen mit Doppeldiagnosen zu ermöglichen.
- VIII. Ambulante Wohnungsbetreuung bei Menschen mit Doppeldiagnosen: Dieses Kapitel beleuchtet die Arbeitsschwerpunkte, die Besonderheiten und die Herausforderungen in der Betreuung von Menschen mit Doppeldiagnosen. Es stellt zudem den Zusammenhang zwischen ambulanter Wohnungsbetreuung und Doppeldiagnosen her.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der ambulanten Wohnungsbetreuung von Menschen mit geistiger Behinderung und einer psychischen Erkrankung (Doppeldiagnosen). Sie untersucht, ob diese Doppeldiagnose einen besonderen Anspruch an die Betreuung stellt und welche Auswirkungen sie auf die pädagogische Arbeit hat. Dabei werden die Herausforderungen in der Betreuungspraxis beleuchtet und die besondere Situation dieser Personengruppe im Kontext von Vorurteilen und Stigmatisierung betrachtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Ambulante Wohnungsbetreuung, Doppeldiagnosen, geistige Behinderung, psychische Erkrankung, Stigmatisierung, Rehistorisierende Diagnostik, pädagogische Arbeit, Betreuungspraxis, Vorurteile, Sozialisation, Verhaltensauffälligkeiten, Risikofaktoren, Grundbedürfnis, Wohnen, Anthropologie, Psychologie, Epidemiologie, Prävalenz, Symptomatik.
- Citation du texte
- Diplom Pädagogin Wiebke Oetjen (Auteur), 2006, Ambulante Wohnungsbetreuung von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankung (Doppeldiagnosen)., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69448