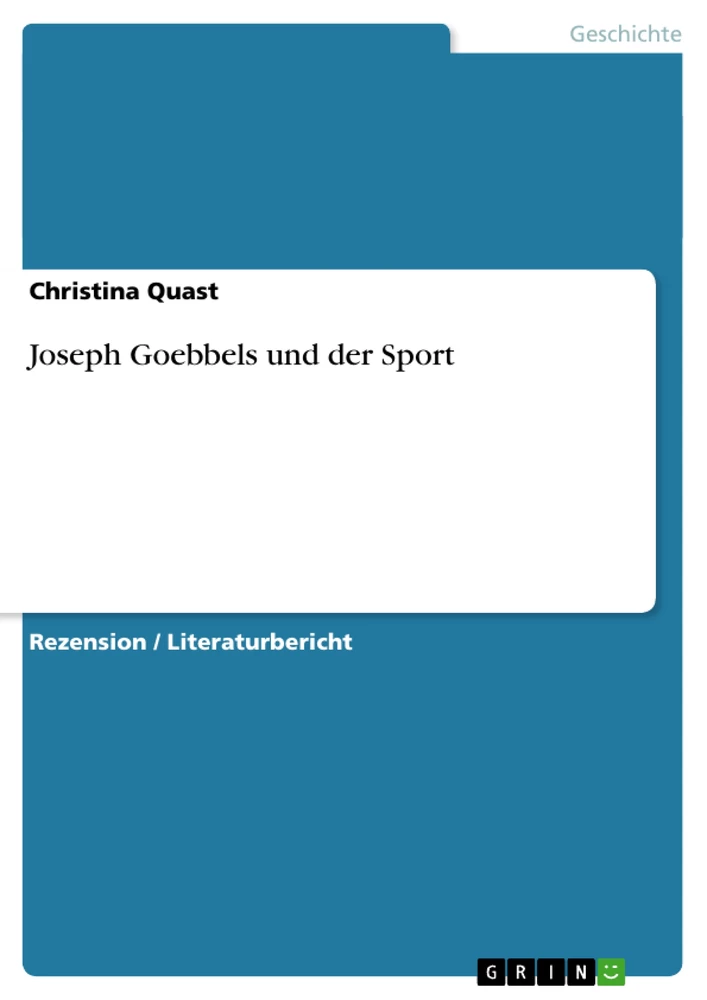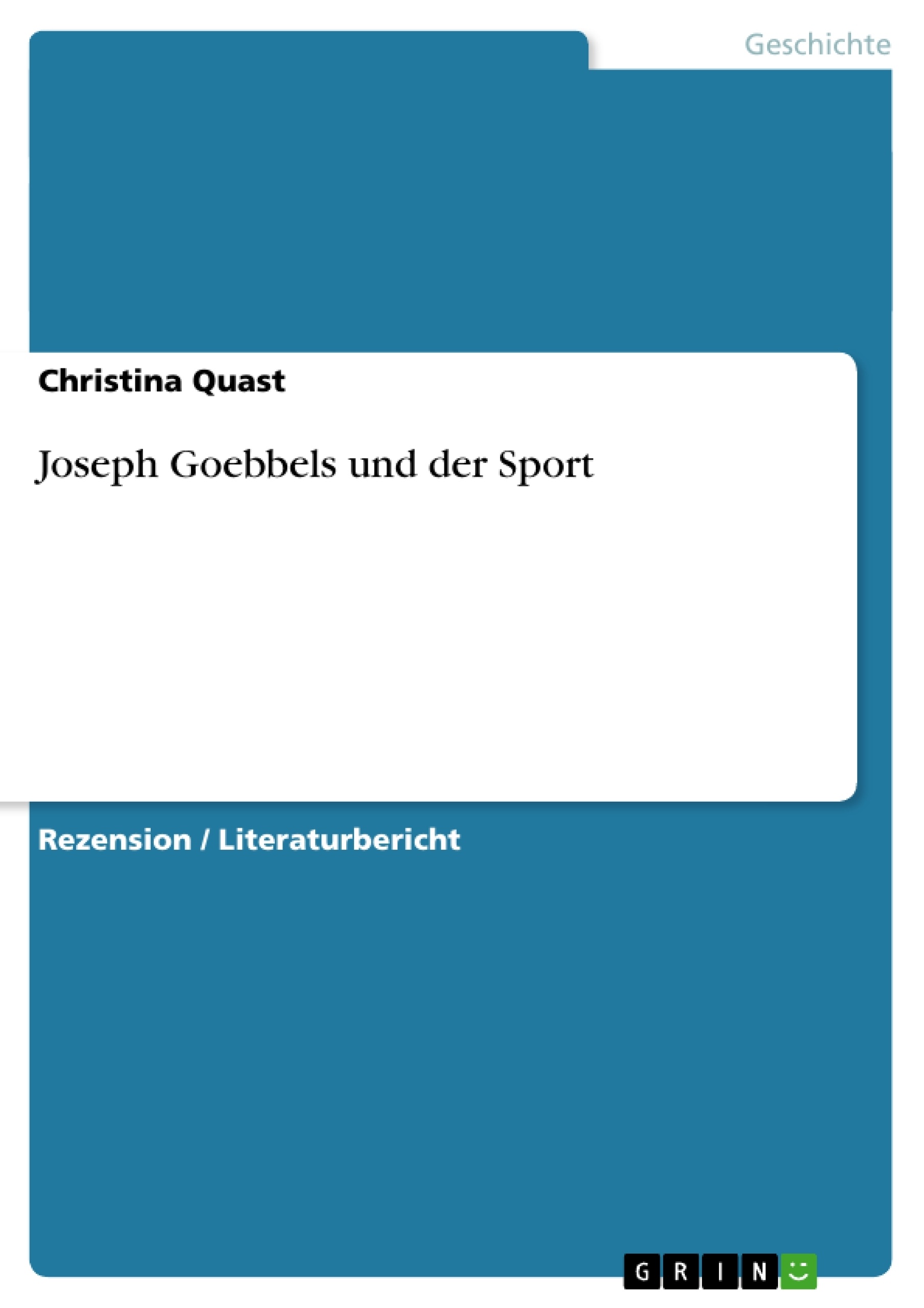Nahezu die Hälfte seines Lebens hat Joseph Goebbels in Tagebüchern festgehalten. Die Eintragungen zwischen 1923 und 1945 umfassen seine politische Karriere in der NSDAP vom Gauleiter in Berlin (1926) und Reichstagsabgeordneten (1928) zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda (1933) und schließlich Generalbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz (1944). Welche Bedeutung die Tagebücher für Goebbels hatten, belegen nicht nur Zeitspanne und Umfang der Eintragungen, welche der Nationalsozialist bis zum Angriff gegen Russland 1941 handschriftlich verfasst und anschließend bis April 1945 diktiert hatte, sondern auch, dass der Reichsminister sämtliche Eintragungen auf Glasplatten sichern ließ, damit diese über das Kriegsende hinaus erhalten bleiben.
Entdeckt wurden die Kopien 1992 im Sonderarchiv in Moskau, das Institut für Zeitgeschichte in München veröffentlichte die Goebbels-Tagebücher. Die bisher 27-bändige Edition ist Grundlage dieser Analyse, welche Goebbels persönliche Sicht auf den Sport und dessen propagandistische Nutzung untersuchen soll. Es werden nur die Tagebuch-Eintragungen zwischen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und dem Kriegsbeginn am 1. September 1939 berücksichtigt, weil im Krieg die sportlichen Wettbewerbe zunehmend ausgesetzt wurden und Goebbels dem Sport aufgrund des Kriegsgeschehens und seiner eigentlichen Betätigungsfelder Kunst und Medien vermutlich kaum Beachtung geschenkt haben dürfte.
In der Friedensphase des Nationalsozialismus sind die olympischen Spiele in Garmisch und Berlin sowie zahlreiche Boxkämpfe von Max Schmeling angesiedelt. Die Analyse beschränkt sich auf diese beiden Themen, um die Anzahl der Eintragungen zu begrenzen. In Goebbels Tagebücher finden sich zwar zahlreiche Nennungen von Wettkämpfen und Sportlern, denen aber nur ein bis zwei Zeilen gewidmet sind, welche selten über eine faktische Darstellung mit Ort, Sportart und Ergebnis hinausgehen und somit wenig aussagekräftig sind.
Olympia und die Boxkämpfe von Schmeling sind die einzigen Sportereignisse, die von Goebbels in seinen Tagebüchern über einen längeren Zeitraum erwähnt werden und umfangreicher ausfallen. Nicht zuletzt ist die Wahl so ausgefallen, weil die sportlichen Wettkämpfe durch den Nationalsozialismus politisch vereinnahmt und Goebbels Ministerium instrumentalisiert wurden. Wie sich die propagandistische Nutzung des Sports in den Tagebuch-Eintragungen widerspiegelt soll ebenfalls Teil dieser Analyse sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Boxkämpfe von Max Schmeling
- Schmeling privat
- Olympische Spiele 1936
- Sommerspiele in Berlin
- Winterspiele in Garmisch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse untersucht die Sicht des Reichsministers Joseph Goebbels auf den Sport und dessen propagandistische Nutzung im Nationalsozialismus. Sie basiert auf den Goebbels-Tagebüchern, die zwischen 1923 und 1945 entstanden sind und die gesamte politische Karriere Goebbels dokumentieren. Die Analyse beschränkt sich auf die Zeitspanne zwischen Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und dem Kriegsbeginn am 1. September 1939, wobei die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch sowie die Boxkämpfe von Max Schmeling im Fokus stehen. Die Analyse untersucht, wie Goebbels die sportlichen Ereignisse in seinen Tagebüchern darstellte und wie er sie für propagandistische Zwecke nutzte.
- Propagandistische Nutzung des Sports im Nationalsozialismus
- Die Rolle von Max Schmeling als nationalsozialistisches Symbol
- Die Olympischen Spiele 1936 als propagandistische Großveranstaltung
- Die Darstellung von Sportlern und Sportveranstaltungen in den Tagebüchern Goebbels
- Die Verknüpfung von Sport mit nationalsozialistischer Ideologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit den Boxkämpfen von Max Schmeling. Goebbels zeigt in seinen Tagebuchaufzeichnungen ein starkes Interesse an Schmeling, der als erfolgreicher Boxer die nationalsozialistische Propaganda unterstützte. Besondere Aufmerksamkeit widmet Goebbels dem Kampf von Schmeling gegen den US-amerikanischen Boxer Joe Louis im Jahr 1936. In diesem Zusammenhang äußert Goebbels seine rassistischen Ansichten und propagiert die Überlegenheit der deutschen Rasse. Das zweite Kapitel behandelt die Olympischen Spiele 1936. Goebbels sah die Olympischen Spiele als Chance, das nationalsozialistische Deutschland der Welt zu präsentieren und die nationalsozialistische Ideologie zu propagieren. In seinen Tagebüchern beschreibt er die Spiele in detaillierten Einträgen und hebt die Erfolge deutscher Sportler hervor. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Joseph Goebbels, Tagebücher, Nationalsozialismus, Propaganda, Sport, Max Schmeling, Olympische Spiele, Rasseideologie, Deutschland, 1933-1939
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzte Joseph Goebbels den Sport für die Propaganda?
Goebbels instrumentalisierte sportliche Großereignisse, um die Überlegenheit der "deutschen Rasse" und die Stärke des NS-Regimes darzustellen.
Welche Rolle spielten die Olympischen Spiele 1936?
Sie dienten als gigantische Propagandashow, um Deutschland der Weltöffentlichkeit als friedlich und modern zu präsentieren.
Warum war Max Schmeling für Goebbels wichtig?
Schmeling wurde als Symbol für deutsche Kraft und Erfolg vermarktet, besonders nach seinem Sieg gegen Joe Louis.
Was verraten Goebbels' Tagebücher über seine Sicht auf den Sport?
Die Tagebücher zeigen, dass Sport für ihn primär ein Mittel der Volksaufklärung und Medieninszenierung war.
Wurde der Sport im Krieg weiterhin thematisiert?
Mit Kriegsbeginn 1939 nahm die Bedeutung sportlicher Berichterstattung in Goebbels' Aufzeichnungen deutlich ab, da andere Themen Priorität hatten.
- Quote paper
- Christina Quast (Author), 2006, Joseph Goebbels und der Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69527