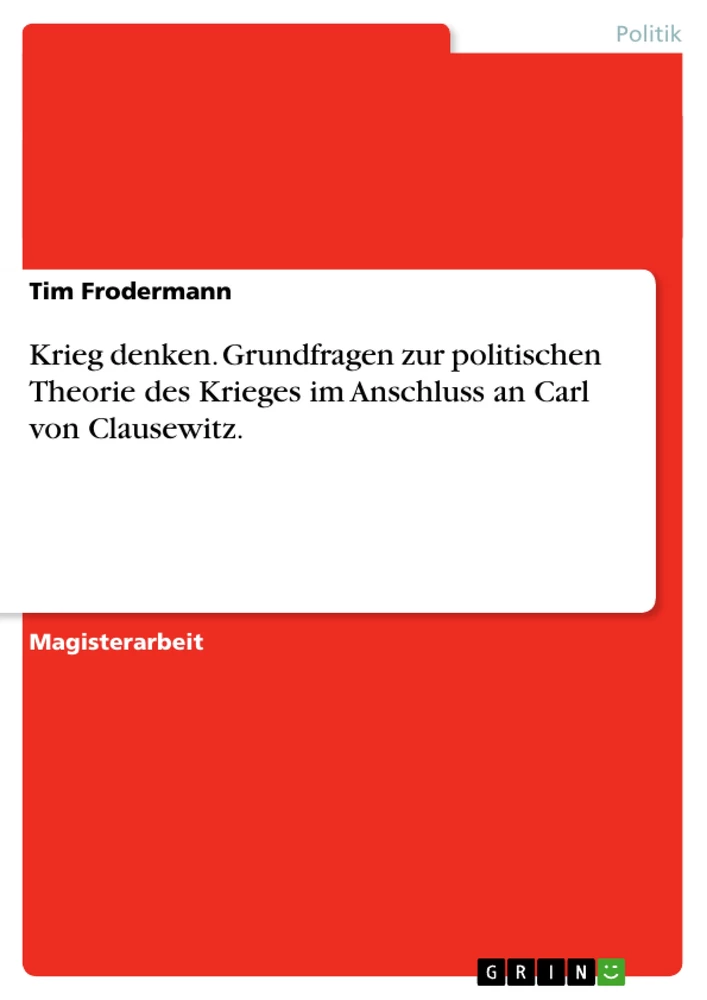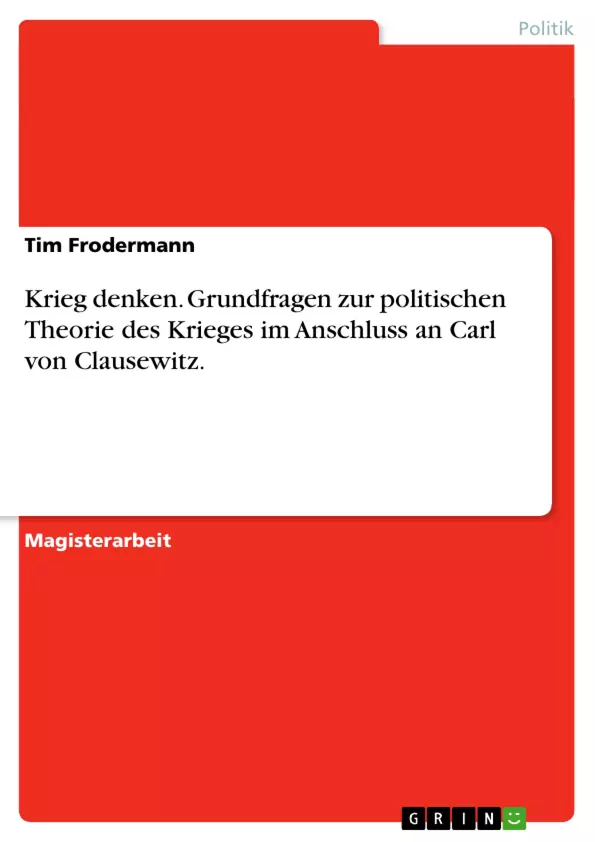"Politische" Theorie des Krieges mag manchem als Widerspruch in sich erscheinen. So wird der Krieg heute auch in der Forschung gerade als das Scheitern aller politischen Bemühungen empfunden. Als etwas, das "nach" der Politik kommt. In Deutschland wird sich dem Thema Krieg daher meist von einem rechtstheoretischen oder einem ethisch-moralischen Standpunkt aus genähert. Ein rechtstheoretischer Ansatz kann jedoch nur darüber Auskunft geben, wann ein Krieg legal ist, der moraltheoretische, wann er legitim ist. Beides ist kaum geeignet, zu klären, welche Funktion der Krieg im politischen Prozess erfüllt. Die Grundlage dieser Arbeit ist die These, dass gerade derjenige, der Krieg nicht führen will, ihn stattdessen notwendigerweise denken muss: Um eine Vorstellung davon zu erhalten, warum Menschen Krieg führen und welchen Platz der Krieg in der Politik hat beziehungsweise welche Wechselwirkungen zwischen beiden existieren. In diesem Sinne hat niemand den Krieg so ausführlich gedacht wie Carl von Clausewitz (1770-1831). Bis heute bietet sein Werk "Vom Kriege" die einzige umfassende Theorie des Krieges. Ich bin der Ansicht, dass es für die Forschung ein lohnenswertes Unterfangen ist, zu prüfen, inwieweit Clausewitz' Ideen noch geeignet sind, die heutige Wirklichkeit des Krieges abzubilden und zu beschreiben; wo gegebenenfalls Anpassungen an die Gegenwart zwingend notwendig werden. Ich behaupte, dass künftige Ansätze zu einer politischen Theorie des Krieges adäquate Antworten auf die Grundfragen finden müssen, die bereits Clausewitz durch seine Ideen thematisiert hat. In diesem Sinne versuche ich in dieser Arbeit, wie Clausewitz den Krieg zu denken, um das diskursive Feld dieser Grundfragen vor dem Leser auszubreiten.
Inhaltsverzeichnis
- Den Krieg denken
- Zur politischen Theorie des Krieges
- Vom „Kabinettskrieg“ zum „Volkskrieg“: Clausewitz und der Wandel des Krieges an der Schwelle zum 19. Jahrhundert
- Der „Begriff“ des Krieges
- Der Krieg als politisches Mittel
- Thematische Ausgestaltung der Theorie
- Existentielle und instrumentelle Kriegsauffassung
- Angriff und Verteidigung
- Entscheidungsschlacht und Volkskrieg
- Die Clausewitz-Kritik
- Kriegsdefinitionen
- Krieg, Völkerrecht und Moral
- Wie begründet man einen Krieg? Aktuelle Entwicklungen zu einer zwingenden Frage
- Krieg zwischen Völkerrecht und Moral
- Die Entwicklung des modernen Völkerrechts und der Einfluss der Moral
- Zur moralischen Begründung von Kriegen
- ,,Gerechter Krieg“ und „Gerechter Feind“
- Vom Primat der Politik zum Primat der Moral?
- Machtpolitik und kooperative Politik im Widerstreit
- Offene Fragen zu Clausewitz' Theorie
- Clausewitz und die Theorie rationaler Entscheidung
- Kooperation und Konflikt in den internationalen Beziehungen
- Rationalität in den internationalen Beziehungen – eine Bestandsaufnahme
- Praktische Anwendungsmöglichkeit der Theorie am Beispiel der Kriegsentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland
- Entscheidung über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan
- Entscheidung über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr im Irak
- Trifft die Bundesrepublik Kriegsentscheidungen im Sinne Clausewitz' ?
- Clausewitz und das 21. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der politischen Theorie des Krieges im Anschluss an Carl von Clausewitz. Ziel ist es, die zentralen Elemente von Clausewitz' Theorie zu analysieren und deren Bedeutung für die heutige Zeit zu beleuchten. Dabei stehen insbesondere die Frage nach der moralischen Rechtfertigung von Kriegen, die Rolle der Machtpolitik in den internationalen Beziehungen sowie die praktische Anwendung der Theorie in aktuellen politischen Entscheidungsprozessen im Fokus.
- Der Wandel des Krieges vom „Kabinettskrieg“ zum „Volkskrieg“
- Die moralische Rechtfertigung von Kriegen
- Die Rolle der Machtpolitik in den internationalen Beziehungen
- Die Anwendung von Clausewitz' Theorie auf aktuelle politische Entscheidungsprozesse
- Die Bedeutung von Clausewitz' Theorie im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Kriegsbildes und zeigt auf, wie die Friedenshoffnungen nach der Aufklärung durch die Realität der Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts zerstört wurden.
Das zweite Kapitel analysiert die politische Theorie des Krieges nach Clausewitz. Dabei werden zentrale Elemente wie der „Begriff“ des Krieges, die Rolle des Krieges als politisches Mittel, die Unterscheidung zwischen „Kabinettskrieg“ und „Volkskrieg“ sowie die Kritik an Clausewitz' Theorie beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Kriegsdefinitionen und deren Bedeutung für das Verständnis des Krieges.
Das vierte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Krieg, Völkerrecht und Moral. Es werden die aktuellen Diskussionen über die Begründung von Kriegen, die Entwicklung des modernen Völkerrechts und die Frage nach der moralischen Rechtfertigung von Kriegen behandelt.
Das fünfte Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Machtpolitik und kooperativer Politik im Widerstreit. Dabei werden offene Fragen zu Clausewitz' Theorie, die Theorie rationaler Entscheidung sowie die Rolle von Kooperation und Konflikt in den internationalen Beziehungen diskutiert.
Das sechste Kapitel betrachtet die praktische Anwendung von Clausewitz' Theorie an den Beispielen der Kriegsentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan und im Irak.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der politischen Theorie des Krieges, insbesondere auf Carl von Clausewitz' Werk. Wichtige Schlüsselwörter sind: Krieg, politische Theorie, Clausewitz, „Kabinettskrieg“, „Volkskrieg“, Machtpolitik, Völkerrecht, Moral, Entscheidungstheorie, internationale Beziehungen, Afghanistan, Irak.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Carl von Clausewitz zum Krieg?
Clausewitz betrachtet den Krieg als „die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, was bedeutet, dass der Krieg immer einem politischen Zweck untergeordnet sein muss.
Was ist der Unterschied zwischen Kabinettskrieg und Volkskrieg?
Kabinettskriege wurden von kleinen Berufsheeren der Herrscher geführt, während der Volkskrieg die gesamte Nation und ihre Ressourcen in den Konflikt einbezieht.
Sind Clausewitz' Ideen im 21. Jahrhundert noch aktuell?
Die Arbeit prüft, ob seine Theorien geeignet sind, heutige Kriege abzubilden, und wo Anpassungen an die moderne Wirklichkeit (z. B. asymmetrische Kriege) notwendig sind.
Wie wird ein Krieg heute moralisch und rechtlich begründet?
Die Diskussion dreht sich um Konzepte wie den „gerechten Krieg“, das Völkerrecht und die Frage, ob moralische Begründungen heute über dem Primat der Politik stehen.
Was bedeutet die instrumentelle Kriegsauffassung?
Sie sieht den Krieg als ein Werkzeug an, das gezielt eingesetzt wird, um rationale politische Ziele zu erreichen, im Gegensatz zu einer rein existenziellen Vernichtung.
- Quote paper
- M. A. Tim Frodermann (Author), 2006, Krieg denken. Grundfragen zur politischen Theorie des Krieges im Anschluss an Carl von Clausewitz., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69531