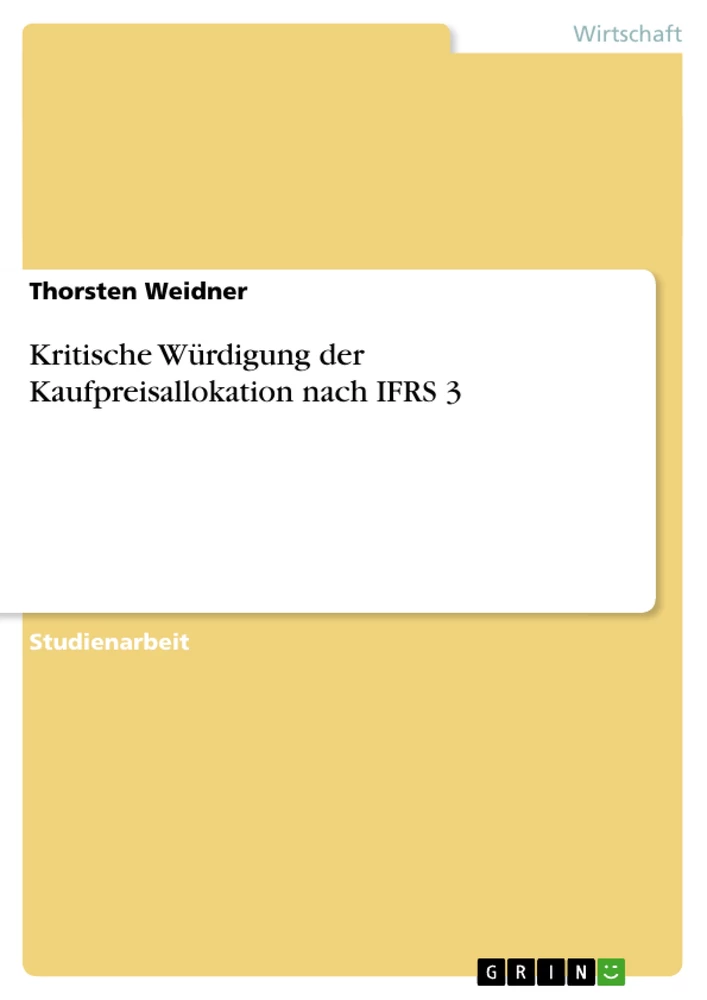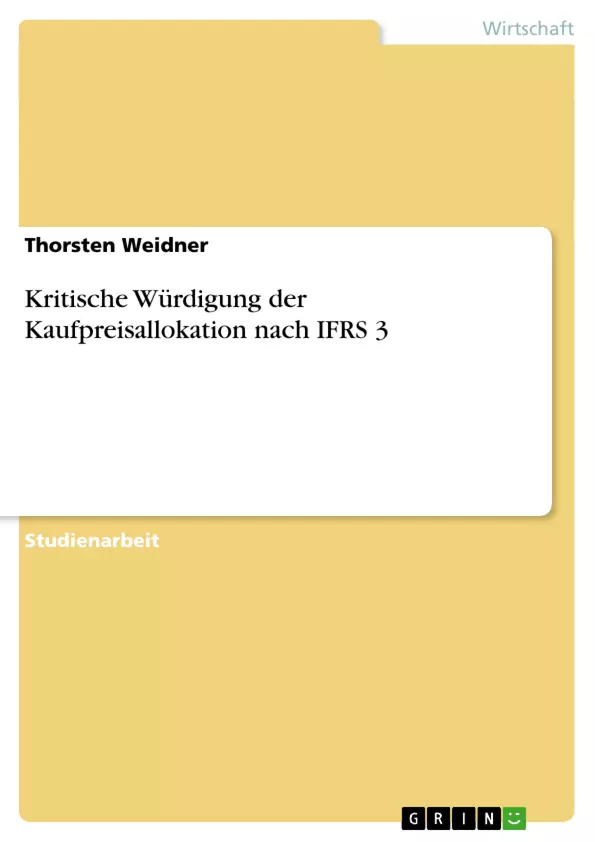Die Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen hat sich mit IFRS 3, der IAS 22 ersetzt, grundlegend geändert. Mit seiner Verabschiedung am 31.3.2004 endete die erste Projektphase „Business Combinations“ des IASB. Ziel des Projekts war eine Verbesserung der Finanzberichterstattung und eine Konvergenz mit US-GAAP. IFRS 3 lässt zur Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen nur noch die Verwendung der sog. Erwerbsmethode zu. Letzter und bedeutsamster Schritt der Erwerbsmethode – nach der Identifizierung des Erwerbers und Ermittlung der Anschaffungskosten des Unternehmenszusammenschlusses – ist die sog. Kaufpreisallokation („purchase price allocation“). Diese bezeichnet die Verteilung der Anschaffungskosten des Unternehmenserwerbs auf die identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden des Tochterunternehmens.
Die vorliegende Arbeit analysiert schwerpunktmäßig die bilanzielle Behandlung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten und Eventualschulden sowie von Restrukturierungsrückstellungen im Rahmen der Kaufpreisallokation. Es wird aufgezeigt, dass zwischen der Ansatzkonzeption des IFRS 3 auf der einen Seite und anderen Standards und dem Framework auf der anderen Seite Inkonsistenzen bestehen. Weiterhin wird der Konflikt zwischen der verbesserten Aufschlüsselung des Unternehmenskaufpreises im Rahmen der Kaufpreisallokation und der damit geschaffenen Ausdehnung bilanzpolitischer Möglichkeiten dargestellt. Außerdem wird auch auf die unterschiedlichen Grade der Objektivierungserfordernisse eingegangen.
Maßstab der kritischen Würdigung sind die im Framework formulierten qualitativen Anforderungen an die Abschlusserstellung. Sie sind Voraussetzung für die Erfüllung der Informationsvermittlungsfunktion der IAS/IFRS. Die kritische Würdigung beschränkt sich auf die Entscheidungsnützlichkeit als oberstes Qualitätsmerkmal. Entscheidungsnützlich sind Jahresabschlussinformationen, wenn sie entscheidungsrelevant und hinreichend zuverlässig sind.
Im Rahmen dieser Arbeit wird weder auf die Besonderheiten des beizulegenden Zeitwerts als Wertmaßstab der Kaufpreisallokation noch auf die Folgebewertung und auch nicht auf die bevorstehenden Änderungen infolge des ED Amendments zu IFRS 3 im Rahmen der zweiten Phase des Projektes näher eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Theoretische Grundlagen der Kaufpreisallokation
- Allgemeine Ansatzregeln
- Pflicht zur vollständigen Neubewertung
- Ausgewählte Probleme der Kaufpreisallokation
- Die neue Ansatzkonzeption von immateriellen Vermögenswerten
- Identifizierbarkeit kunden-bezogener immaterieller Vermögenswerte
- Entscheidungsrelevanz durch Verzicht auf das Probable-Kriterium
- Abbildung von Eventualschulden in der Konzernbilanz
- Asymmetrische Behandlung von Chancen und Risiken
- Verschiebung des Verhältnisses zwischen Verlässlichkeit und Relevanz
- Objektivierungserfordernisse für Restrukturierungsrückstellungen
- Fazit
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert kritisch die Kaufpreisallokation nach IFRS 3, wobei der Schwerpunkt auf der bilanzellen Behandlung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten, Eventualschulden und Restrukturierungsrückstellungen liegt. Ziel ist es, Inkonsistenzen zwischen der Ansatzkonzeption des IFRS 3 und anderen Standards sowie dem Framework aufzudecken, den Konflikt zwischen verbesserter Aufschlüsselung des Unternehmenskaufpreises und der damit verbundenen Erweiterung bilanzpolitischer Möglichkeiten zu beleuchten und die unterschiedlichen Objektivierungserfordernisse zu diskutieren.
- Analyse der Inkonsistenzen zwischen IFRS 3 und anderen Standards sowie dem Framework
- Bewertung der Auswirkungen der Kaufpreisallokation auf die bilanzpolitischen Möglichkeiten
- Untersuchung der Objektivierungserfordernisse für verschiedene Vermögenswerte und Schulden
- Beurteilung der Entscheidungsnützlichkeit der Kaufpreisallokation
- Kritische Würdigung des IFRS 3 im Hinblick auf seine Informationsvermittlungsfunktion
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Problemstellung dar und führt in die Thematik der Kaufpreisallokation nach IFRS 3 ein. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Kaufpreisallokation, einschließlich der allgemeinen Ansatzregeln und der Pflicht zur vollständigen Neubewertung. Kapitel 3 befasst sich mit ausgewählten Problemen der Kaufpreisallokation, darunter die Ansatzkonzeption von immateriellen Vermögenswerten, die Abbildung von Eventualschulden in der Konzernbilanz und die Objektivierungserfordernisse für Restrukturierungsrückstellungen.
Schlüsselwörter
IFRS 3, Kaufpreisallokation, immaterielle Vermögenswerte, Eventualschulden, Restrukturierungsrückstellungen, Entscheidungsnützlichkeit, Objektivierung, Framework, Bilanzpolitik, Unternehmenszusammenschlüsse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Kaufpreisallokation (PPA) nach IFRS 3?
Es ist die Verteilung der Anschaffungskosten eines Unternehmenskaufs auf die identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden des erworbenen Unternehmens.
Wie werden immaterielle Vermögenswerte nach IFRS 3 behandelt?
IFRS 3 fordert eine stärkere Identifizierung immaterieller Werte (z.B. Kundenlisten), oft unter Verzicht auf das bisherige Wahrscheinlichkeitskriterium (Probable-Kriterium).
Welche Probleme ergeben sich bei Eventualschulden?
Kritisiert wird die asymmetrische Behandlung von Chancen und Risiken sowie die Verschiebung zwischen Verlässlichkeit und Relevanz der Bilanzinformationen.
Was bedeutet „Entscheidungsnützlichkeit“ im IFRS-Framework?
Informationen sind nützlich, wenn sie relevant und zuverlässig sind, um Investoren bei ihren ökonomischen Entscheidungen zu unterstützen.
Führt die Kaufpreisallokation zu mehr Bilanzpolitik?
Ja, die Ausdehnung von Ermessensspielräumen bei der Bewertung schwer greifbarer Werte schafft neue Möglichkeiten für bilanzpolitische Gestaltungen.
- Citation du texte
- Thorsten Weidner (Auteur), 2007, Kritische Würdigung der Kaufpreisallokation nach IFRS 3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69664