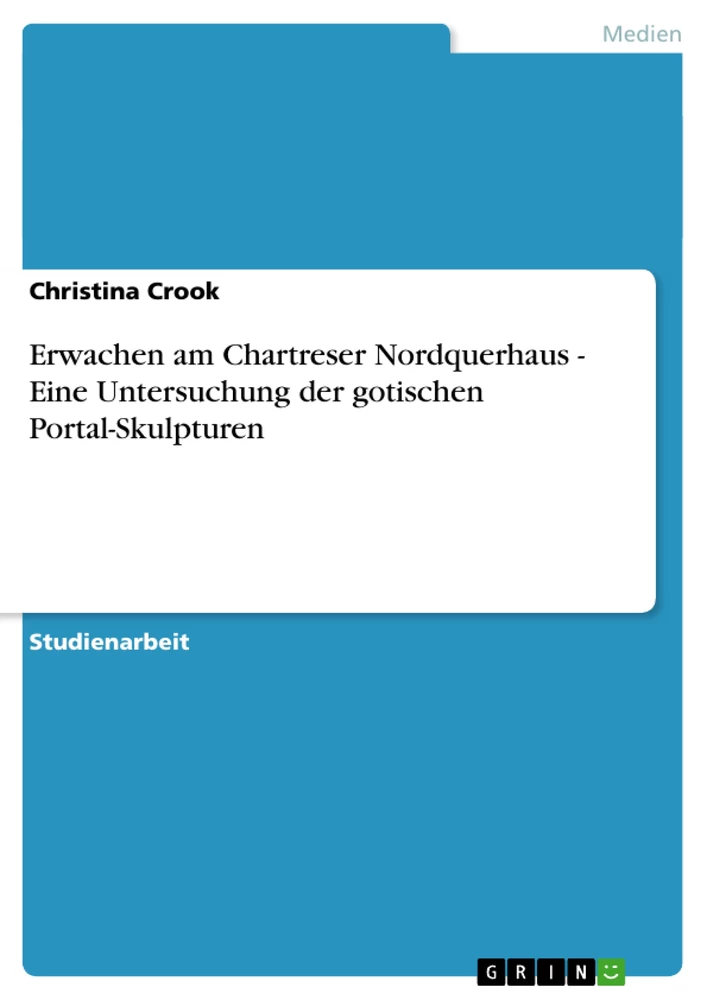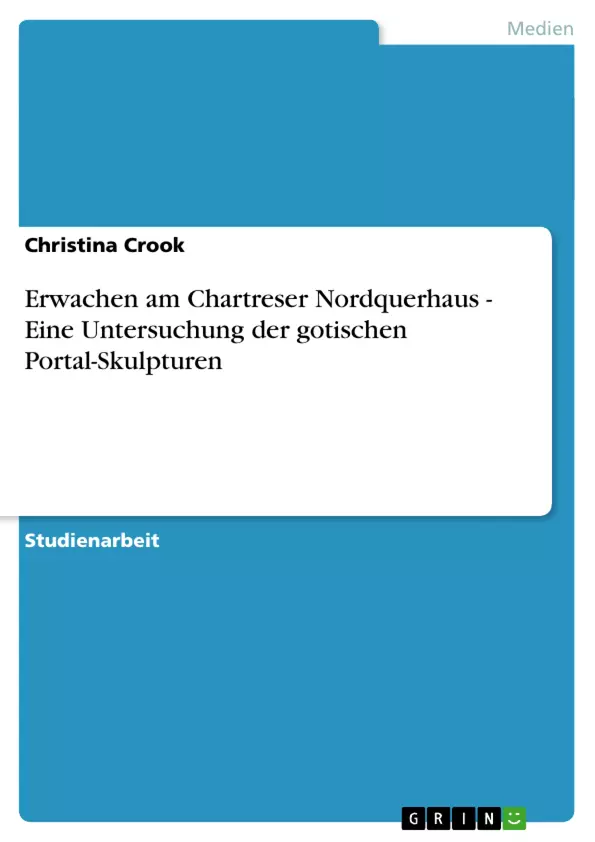Das nördliche Querhaus von Chartres ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sein ikonographisches Programm und die Ausarbeitung seines Bildwerkes spiegelt nicht nur ein geistiges und künstlerisches Erwachen wider, es stellt außerdem, ganz nach dem Vorbild von Senlis, das mariologische Thema in den Vordergrund und bricht so mit der christologischen Tradition. Die heterogene Gestaltung des nördlichen Querhauses erklärt sich durch das Ende eines religiös, dogmatischen Schlummers, denn zur Erbauungszeit der gotischen Kathedrale wurden wichtige theologische Fragen kontrovers diskutiert. Die Entscheidung, am nördlichen Querhaus von Chartres Themen des Alten und des Neuen Testaments darzustellen, könnte von dem Wunsch herrühren, beide Schriften als Einheit zu verknüpfen.
Vor allem aber, was die Skulpturengestaltung anbelangt, lassen sich am Nordquerhaus dieser Kathedrale tiefgreifende Veränderungen ausmachen. Wie in der Belser Stilgeschichte über die Entwicklung der gotischen Skulptur treffend zu lesen ist,„tritt die (...) freistehende Plastik vor der Folie des vertikalen Mauergerüstes in ein vollkommen neues Verhältnis zum Raum. Die lebensgroßen Standbilder stehen vereinzelt, sogar oft isoliert voneinander, unter kleinen Architekturbaldachinen, die ihnen optisch den notwendigen Raummantel umlegen. Selbst diese exemplarische Gestalten (Propheten, Apostel) werden im Laufe der Zeit menschlicher, körperlich bewegter und treten untereinander in dialogische Beziehungen. (...) Aus einem über die byzantinischen Vorbilder wiedergewonnenen Verhältnis zur Antike wird die Plastik mit neuem Leben erfüllt und vermenschlicht. (...) Die menschliche Gestalt wird für würdig befunden, Übermenschliches auszusprechen.“
Diese Seminararbeit wird untersuchen, inwiefern diese Entwicklung an den Portalen des Nordquerhauses auszumachen ist. Dabei spielen vor allem die Bildwerke des Hiob-Salomo-Portals eine große Rolle. Dieses Portal, welches von einer aus Sens stammenden Werkstatt angefertigt wurde, zeichnet sich laut W. Sauerländer durch eine Formensprache „unruhevoller Bewegtheit“ aus und verfügt dabei gleichzeitig über eine „dramatisch beseelte Erzählweise“.
Durch eine Besprechung der Skulpturen am nördlichen Querhaus soll hier erörtert werden, wodurch die Bildwerke ihre Lebendigkeit und sogleich ihre Zeitlosigkeit erhalten, da wir doch, wann immer wir ihnen gegenüber treten, etwas von uns in ihnen entdecken werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Baugeschichtlicher Hintergrund der Chartreser Kathedrale
- 1.1 Zur Frage der Planänderung und der zeitlichen Eingrenzung der Querhausskulpturen
- 2 Ikonographie der Portale des Chartreser Nordquerhauses
- 2.1 Das Marientriumphportal
- 2.2 Ikonographie des Epiphanieportals
- 2.3 Ikonographie des Hiob-Salomo-Portals
- 3 Beschreibung der Nordquerhausportale
- 3.1 Beschreibung des Marientriumphportals: Zu Tympanon und Sturz
- 3.1.1 Zur Trumeaufigur des Portals: Die Heilige Anna
- 3.1.2 Beschreibung der Gewändefiguren
- 3.2 Beschreibung des Epiphanieportals
- 3.2.1 Zu Tympanon und Sturz
- 3.2.2 Die Gewändefiguren
- 3.3 Beschreibung des Hiob-Salomo-Portals
- 3.3.1 Zu Tympanon und Sturz
- 3.3.2 Die Gewändefiguren
- 3.3.3 Die Königsköpfe des Hiob-Salomo-Portals
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung der gotischen Skulptur am Beispiel der Portale des nördlichen Querhauses der Chartreser Kathedrale. Im Fokus stehen dabei die Skulpturen des Hiob-Salomo-Portals, deren „unruhevolle Bewegtheit“ und „dramatische Erzählweise“ die besondere Entwicklung der gotischen Kunst widerspiegeln.
- Die Veränderungen der gotischen Skulptur in Bezug auf Raum, Haltung und menschliche Darstellung
- Die Bedeutung des mariologischen Themas im ikonographischen Programm des Nordquerhauses
- Die Verbindung von alttestamentarischen und neutestamentarischen Themen im Gesamtkonzept der Portale
- Die Rolle der Werkstatt aus Sens in der Gestaltung des Hiob-Salomo-Portals
- Der Einfluss der Planänderung auf die zeitliche Eingrenzung der Skulpturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung des Nordquerhauses von Chartres für die Entwicklung der gotischen Skulptur beleuchtet. Im ersten Kapitel wird der baugeschichtliche Hintergrund der Chartreser Kathedrale erläutert, mit besonderem Fokus auf die Auswirkungen des Brandes von 1194 und die Planänderungen, die sich daraus ergaben. Das zweite Kapitel widmet sich der Ikonographie der Portale des Nordquerhauses, wobei jeweils die Hauptthemen und -figuren des Marientriumphportals, des Epiphanieportals und des Hiob-Salomo-Portals vorgestellt werden.
Im dritten Kapitel werden die Portale des Nordquerhauses in detaillierter Beschreibung vorgestellt. Dabei wird zunächst das Marientriumphportal mit seinen Figuren, Tympanon und Sturz analysiert, gefolgt von einer genauen Betrachtung des Epiphanieportals und seiner Skulpturen. Abschließend erfolgt eine eingehende Analyse des Hiob-Salomo-Portals, wobei besonders die Gewändefiguren und Königsköpfe hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Gotische Skulptur, Chartreser Kathedrale, Nordquerhaus, Hiob-Salomo-Portal, Marientriumphportal, Epiphanieportal, Ikonographie, Planänderung, Werkstatt aus Sens, Skulpturen, Gewändefiguren, Königsköpfe, Tympanon, Sturz, Mariologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Nordquerhaus der Kathedrale von Chartres?
Es markiert einen Übergang in der gotischen Skulptur hin zu mehr Lebendigkeit und stellt mariologische Themen anstelle rein christologischer Traditionen in den Vordergrund.
Was charakterisiert das Hiob-Salomo-Portal?
Dieses Portal zeichnet sich durch eine Formensprache „unruhevoller Bewegtheit“ und eine dramatisch beseelte Erzählweise aus, die typisch für die Werkstatt aus Sens ist.
Wie veränderten sich die gotischen Gewändefiguren im Laufe der Zeit?
Die Figuren lösten sich zunehmend von der starren Architektur, wurden körperlich bewegter, menschlicher und traten in dialogische Beziehungen zueinander.
Warum wurden Themen des Alten und Neuen Testaments verknüpft?
Die Darstellung beider Testamente an den Portalen sollte die Einheit der biblischen Schriften im theologischen Gesamtkonzept verdeutlichen.
Welche Rolle spielte der Brand von 1194 für die Baugeschichte?
Der Brand führte zu weitreichenden Planänderungen beim Wiederaufbau, was die zeitliche Einordnung und Gestaltung der Querhausskulpturen maßgeblich beeinflusste.
- Citar trabajo
- Christina Crook (Autor), 2005, Erwachen am Chartreser Nordquerhaus - Eine Untersuchung der gotischen Portal-Skulpturen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69771