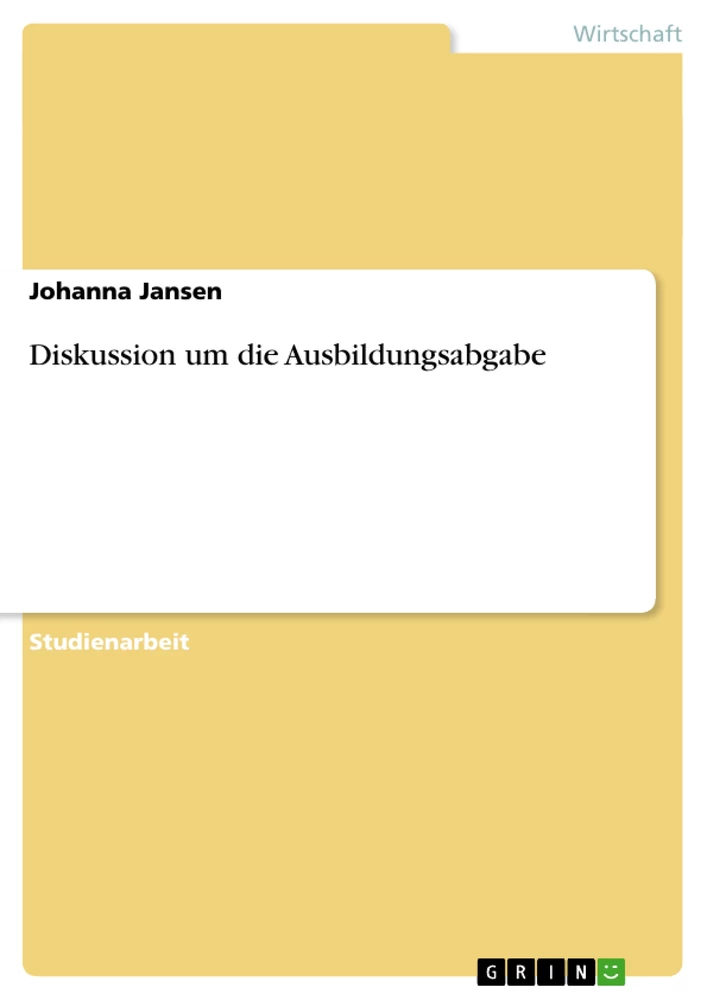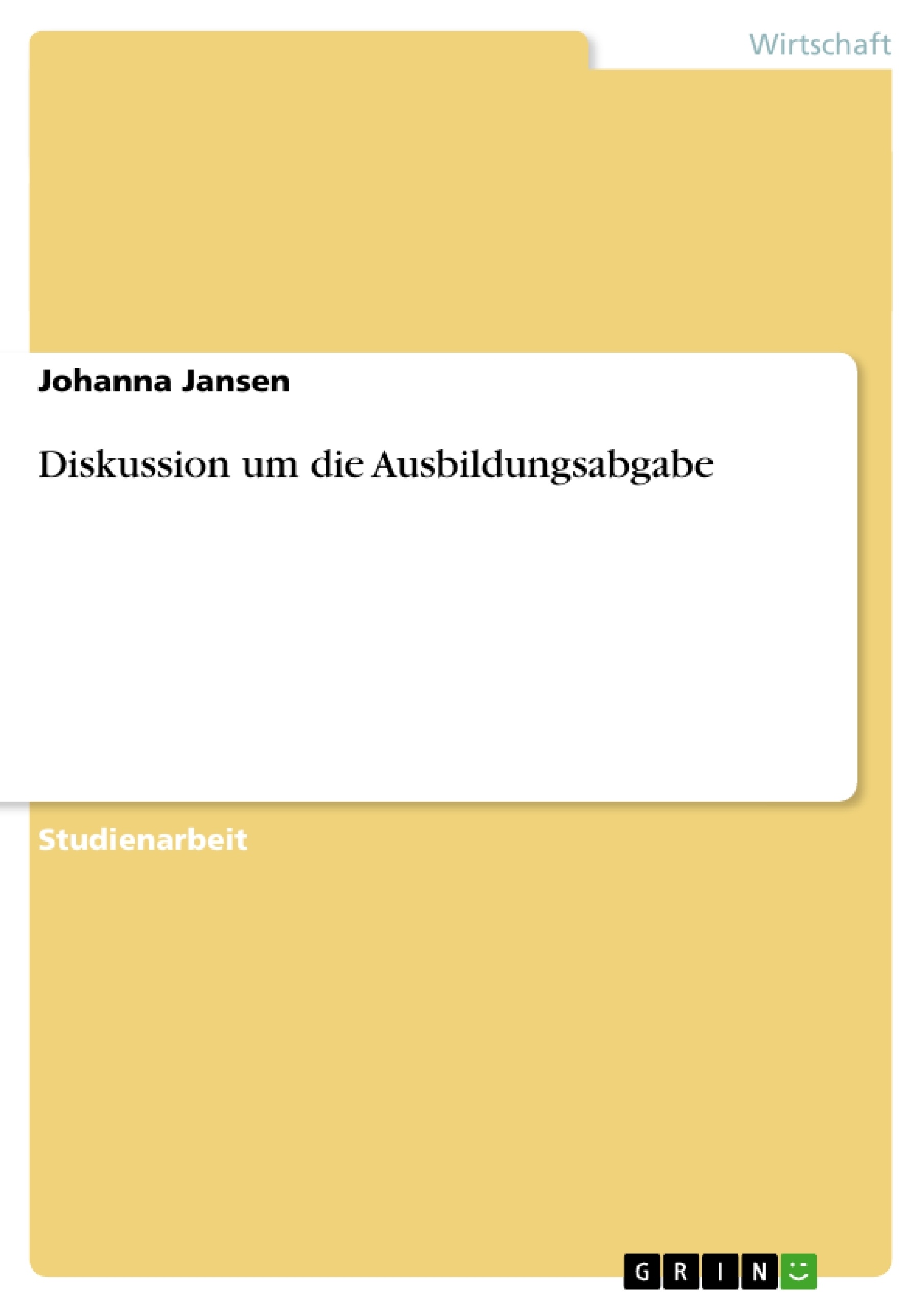„Wenn der Staat in Anerkennung dieser Aufgabenteilung den Arbeitgebern die praxisbezogene Berufsausbildung der Jugendlichen überläßt, so muß er erwarten, daß die gesellschaftliche Gruppe der Arbeitgeber diese Aufgabe nach Maßgabe ihrer objektiven Möglichkeiten und damit so erfüllt, daß grundsätzlich alle ausbildungswilligen Jugendlichen die Chance erhalten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das gilt auch dann, wenn das freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung der übernommenen Aufgabe nicht mehr ausreichen sollte“ (BVG 1980). Diese Passage stammt aus dem Urteil des BVGs zur Berufsausbildungsabgabe vom 10. Dezember 1980 und ist eines unter vielen Argumenten für die Intervention von Staat oder Politik zur Sicherung des Ausbildungsplatzangebotes seitens der Abgabe-Befürworter, das immer dann an Nachdruck gewinnt, wenn Statistiken belegen, dass sich Betriebe aus ihrer Verantwortung für die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl qualifizierter betrieblicher Ausbildungsplätze für die junge Generation zurückziehen. Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den zahlreichen Denkansätzen und konkreten Modellen in Form von Gesetzesentwürfen zur Ausbildungsabgabe, die seit den 70er Jahren entwickelt wurden um eine gerechtere und solidarischere Finanzierung der beruflichen Erstausbildung zu erreichen.
Um jedoch auch die vielen Argumente gegen die Abgabe zu hören, werden Positionen aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Wissenschaft einander gegenübergestellt.
Die jahrzehntelangen Diskussionen führten jedoch hinsichtlich einer gesetzlichen Neuregelung der Berufsbildungsfinanzierung zu keiner Einigung. Stattdessen kam es zu einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Wirtschaft und Staat, in dem sich beide Partner dazu verpflichten, in enger Zusammenarbeit allen ausbildungswilligen Jugendlichen ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten. Es wird untersucht, inwiefern dieser Pakt seine Versprechungen einhielt und gegenwärtig noch einhält.
Ein abschließendes Fazit soll klären, ob eine Ausbildungsabgabe aktuell ein wünschenswertes Instrument zur Sicherung des Ausbildungsplatzangebotes darstellt und den Nationalen Pakt für Ausbildung ersetzen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprung der Debatte in der Bundesrepublik
- Das Modell der Sachverständigenkommission „Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung“
- Kritik am Modell
- Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz (APIfG) von 1976
- Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ab 1980
- Positionen der Wissenschaft
- Prof. Dr. Ulrich van Lith
- Prof. Dr. Gerd-E. Famulla
- Position des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln: Günter Cramer und Karlheinz Müller
- Der Streit um die Ausbildungsabgabe geht weiter
- Das Berufsausbildungssicherungsgesetz (BerASichG)
- Die Positionen der Unternehmer
- Die Positionen der Arbeitgeberverbände am Beispiel der IHK und der Arbeitgeberverbände Gesamtmetall
- Die Positionen der CDU/CSU
- Die Positionen der damaligen Regierungskoalition SPD/Bündnis 90/ Die Grünen und die Reaktion des Bundesrates
- Exkurs: Die Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBIG-Reform)
- Der Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (Ausbildungspakt) vom 16. Juni 2004 und die erste Zwischenbilanz 2005
- Ausbildungspakt: Bilanz 2006
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um die Ausbildungsabgabe in Deutschland seit den 1970er Jahren. Ziel ist es, die verschiedenen Positionen von Gewerkschaften, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu analysieren und die Entwicklung der Finanzierung der beruflichen Erstausbildung nachzuzeichnen. Die Arbeit beleuchtet auch den Nationalen Pakt für Ausbildung und bewertet dessen Erfolg.
- Entwicklung der Debatte um die Ausbildungsabgabe
- Verschiedene Positionen von Interessengruppen (Gewerkschaften, Wirtschaft, Politik)
- Analyse verschiedener Modelle zur Ausbildungsfinanzierung
- Bewertung des Nationalen Pakts für Ausbildung
- Diskussion um eine gerechtere und solidarischere Finanzierung der beruflichen Erstausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ausbildungsabgabe ein und benennt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1980 als zentralen Ausgangspunkt. Sie skizziert die Forschungsfrage, die sich mit den verschiedenen Ansätzen und Modellen zur Finanzierung der beruflichen Erstausbildung auseinandersetzt, und kündigt den Vergleich verschiedener Positionen an. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Diskussion und der Bewertung des Nationalen Pakts für Ausbildung.
Ursprung der Debatte in der Bundesrepublik: Dieses Kapitel beschreibt den sozioökonomischen Wandel der 60er Jahre und den damit verbundenen Beginn der bildungspolitischen Reformbestrebungen. Es beleuchtet die Gründung der Edding-Kommission und deren Analyse der Kostenstruktur der betrieblichen Berufsausbildung. Der Mangel an Informationen über die Kosten der Berufsausbildung in der Nachkriegszeit und die öffentliche Wahrnehmung der Lehrlingsausbildung als „Ausbeutung“ werden hervorgehoben. Die einseitige Betrachtung der betrieblichen Seite des dualen Systems in den Versuchen einer Neuordnung der Berufsbildungsfinanzierung wird kritisch hinterfragt.
Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ab 1980: (Die Zusammenfassung dieses und der folgenden Kapitel muss aufgrund fehlender Informationen aus dem bereitgestellten Text ergänzt werden. Hier wäre eine detaillierte Beschreibung der Position des DGB und anderer Akteure notwendig.)
Positionen der Wissenschaft: (Die Zusammenfassung dieses Kapitels muss aufgrund fehlender Informationen aus dem bereitgestellten Text ergänzt werden. Hier wäre eine detaillierte Beschreibung der Positionen von Prof. Dr. Ulrich van Lith und Prof. Dr. Gerd-E. Famulla und deren Argumentation notwendig.)
Position des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln: Günter Cramer und Karlheinz Müller: (Die Zusammenfassung dieses Kapitels muss aufgrund fehlender Informationen aus dem bereitgestellten Text ergänzt werden. Hier wäre eine detaillierte Beschreibung der Position des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln und der Argumentation von Günter Cramer und Karlheinz Müller notwendig.)
Der Streit um die Ausbildungsabgabe geht weiter: (Die Zusammenfassung dieses Kapitels muss aufgrund fehlender Informationen aus dem bereitgestellten Text ergänzt werden. Hier wäre eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Positionen (BerASichG, Unternehmer, Arbeitgeberverbände, CDU/CSU, Regierungskoalition) und deren Argumente notwendig.)
Exkurs: Die Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBIG-Reform): (Die Zusammenfassung dieses Kapitels muss aufgrund fehlender Informationen aus dem bereitgestellten Text ergänzt werden. Hier wäre eine detaillierte Beschreibung der Reform und ihrer Relevanz für die Debatte um die Ausbildungsabgabe notwendig.)
Der Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (Ausbildungspakt) vom 16. Juni 2004 und die erste Zwischenbilanz 2005: (Die Zusammenfassung dieses Kapitels muss aufgrund fehlender Informationen aus dem bereitgestellten Text ergänzt werden. Hier wäre eine detaillierte Beschreibung des Ausbildungspakts, seiner Ziele und seiner ersten Zwischenbilanz notwendig. Die Bilanz 2006 sollte ebenfalls eingebunden werden.)
Schlüsselwörter
Ausbildungsabgabe, Berufsbildungsfinanzierung, duales System, Nationale Pakt für Ausbildung, Edding-Kommission, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Politik, Berufsausbildungssicherungsgesetz (BerASichG), BBIG-Reform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Debatte um die Ausbildungsabgabe in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Debatte um die Ausbildungsabgabe in Deutschland seit den 1970er Jahren. Sie analysiert die verschiedenen Positionen von Gewerkschaften, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und zeichnet die Entwicklung der Finanzierung der beruflichen Erstausbildung nach. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Nationalen Pakt für Ausbildung und dessen Bewertung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Debatte um die Ausbildungsabgabe, die verschiedenen Positionen von Interessengruppen (Gewerkschaften, Wirtschaft, Politik), die Analyse verschiedener Modelle zur Ausbildungsfinanzierung, die Bewertung des Nationalen Pakts für Ausbildung und die Diskussion um eine gerechtere und solidarischere Finanzierung der beruflichen Erstausbildung.
Welche Akteure werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Positionen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), verschiedener Wissenschaftler (u.a. Prof. Dr. Ulrich van Lith und Prof. Dr. Gerd-E. Famulla), des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (Günter Cramer und Karlheinz Müller), von Unternehmern, Arbeitgeberverbänden (z.B. IHK und Gesamtmetall), der CDU/CSU, der damaligen Regierungskoalition (SPD/Bündnis 90/Die Grünen) und des Bundesrates.
Welche Schlüsselereignisse und -gesetze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ursprung der Debatte in den 1960er und 70er Jahren, inklusive der Gründung der Edding-Kommission und des Ausbildungsplatzförderungsgesetzes (APIfG) von 1976. Wichtige Punkte sind das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1980, das Berufsausbildungssicherungsgesetz (BerASichG), die Reform des Berufsbildungsgesetzes (BBIG-Reform) und der Nationale Pakt für Ausbildung von 2004.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum Ursprung der Debatte, den Positionen verschiedener Akteure (Gewerkschaften, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik), einen Exkurs zur BBIG-Reform und einen Abschnitt zum Nationalen Pakt für Ausbildung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Quellen werden verwendet? (Hinweis: Diese Frage kann basierend auf dem vorliegenden Text nicht abschließend beantwortet werden.)
Die konkreten Quellen werden im vollständigen Text der Arbeit aufgeführt sein. Der hier vorliegende Auszug enthält nur eine Inhaltsangabe und Kapitelzusammenfassungen.
Was ist das Fazit der Arbeit? (Hinweis: Diese Frage kann basierend auf dem vorliegenden Text nicht abschließend beantwortet werden.)
Das Fazit der Arbeit, welches eine umfassende Bewertung der Debatte und des Nationalen Pakts für Ausbildung enthält, ist im vorliegenden Text-Auszug nicht enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik?
Schlüsselwörter sind: Ausbildungsabgabe, Berufsbildungsfinanzierung, duales System, Nationaler Pakt für Ausbildung, Edding-Kommission, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Politik, Berufsausbildungssicherungsgesetz (BerASichG), BBIG-Reform.
- Citar trabajo
- Johanna Jansen (Autor), 2005, Diskussion um die Ausbildungsabgabe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69831