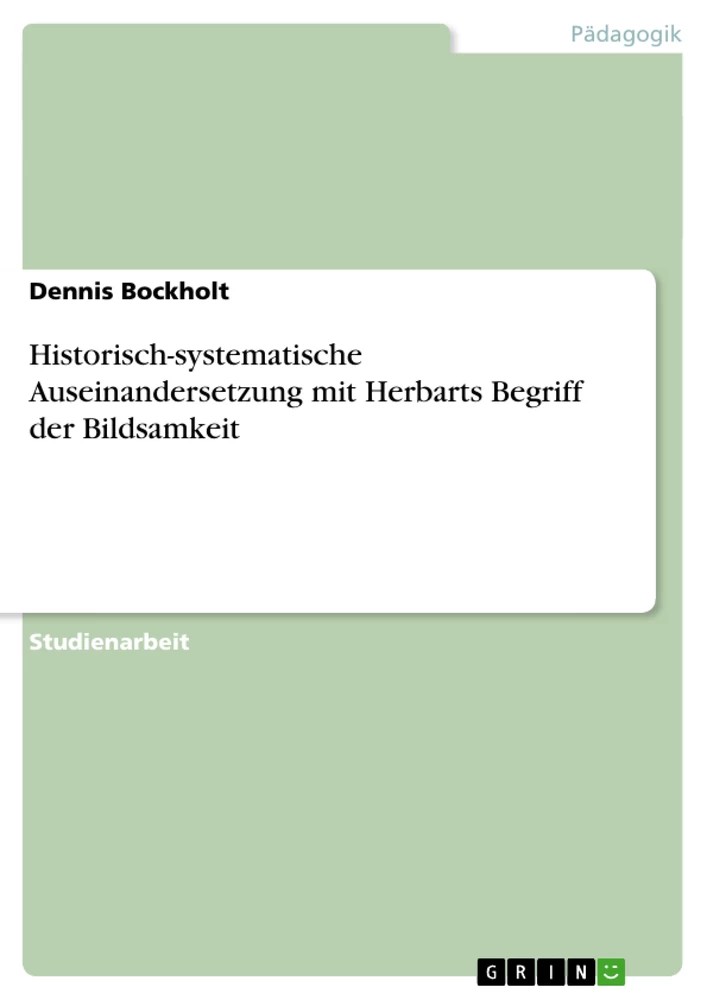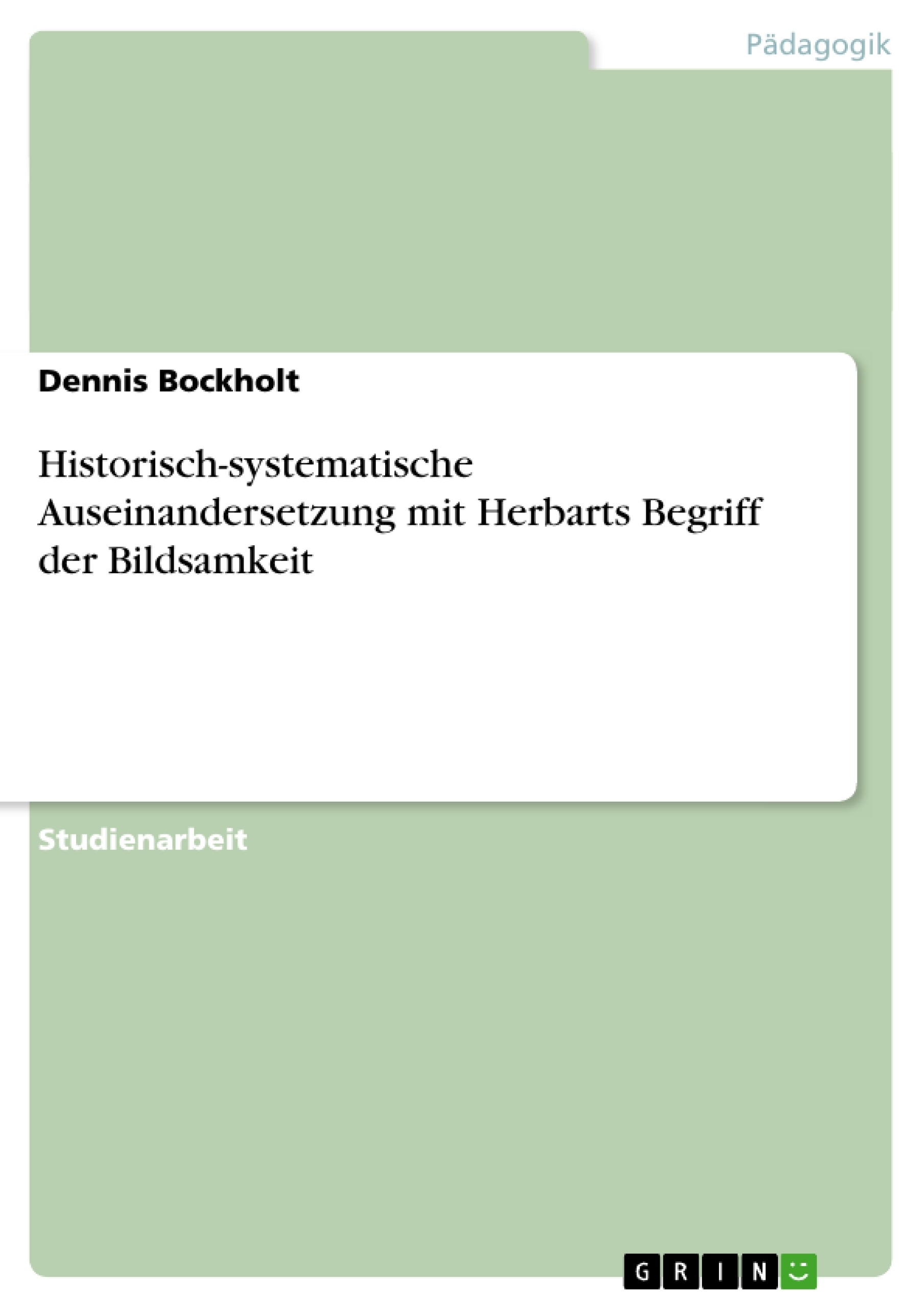Bildsamkeit wurde schon bei den klassischen Philosophen (Platon, Aristoteles) als Faktum und im Laufe der Jahrhunderte als unverzichtbares Phänomen der Menschenbildung vorausgesetzt.
Der Begriff der Bildsamkeit wurde mit wenigen Ausnahmen auch im Deutschen Idealismus (Kant, Fichte, Hegel) sowie bei den klassischen, romantischen und aufklärerischen Dichtern (Goethe, Schiller, Wieland u.a.m.) als pädagogischer Terminus gehandelt, wie Bernhard Schwenk in seiner Publikation von 1967 nachwies.
Hingegen wurde der Begriff erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den ‚pädagogischen Klassikern’ (allerdings nicht alle, z. B. Pestalozzi) weitläufig verwendet. Schließlich war es dann Johann Friedrich Herbart, der dafür verantwortlich war, dass der Terminus Bildsamkeit zum Grundbegriff der Pädagogik ausgerufen wurde.
Da dieser Terminus mittlerweile als antiquiert zählt und in den meisten deutschen Wörterbüchern nicht mehr verwendet wird und auch in aktuellen Publikationen der ‚Allgemeinen Pädagogik’ mittlerweile sehr rar geworden ist, wurde die systematische Erforschung Herbarts Verständnis von der Bildsamkeit als Grundlage seiner pädagogischen Theorie bisweilen vernachlässigt. Somit liegt die Annahme nahe, dass sich dieses Defizit auch in den bisherigen Rezeptionen und Rekonstruktionen von Herbarts pädagogischer Theorie widerspiegelt.
Diese Arbeit versucht nun, Herbarts pädagogischen Ansatz mit neueren systemtheoretischen Forschungsansätzen zu vergleichen. Entscheidend ist die Bildsamkeit in den Mittelpunkt zu stellen und hierbei die ‚Erfahrung der Bildsamkeit’ als Aktivität, also als Operation zu betrachten. Abschließend werden dann der Begriff der Bildsamkeit nach Herbart und die Kontingenzformel von Luhmann auf Gemeinsamkeiten hin überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Systemtheorien
- Systemtheoretische Ansätze
- Ansprüche und Lösungsansätze
- Die Einheit von System - Umwelt - Differenzen
- Das System
- Die Systemstruktur
- Einheit eines Systems
- Differenz zwischen System und Umwelt
- Bildsamkeit als systemischer Ansatz nach Herbart
- Der systematische Ansatz bei Herbart
- Der Edukand als System von Operationen
- Das, Gemüth' als System
- Das System der Selbsterhaltung
- Das System der Lebenskräfte
- Das Zusammenwirken von Selbsterhaltung und Lebenskraft
- Folgen für die pädagogische Theorie
- Herbarts Verständnis der Bildsamkeit im Vergleich mit der Kontingenzformel des Erziehungssystems von Luhmann
- Humane Perfektion
- Bildung
- Lernfähigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Herbarts pädagogischen Ansatz im Lichte neuerer systemtheoretischer Ansätze. Das zentrale Thema ist Herbarts Begriff der Bildsamkeit, der als Aktivität und Operation betrachtet wird. Der Vergleich mit Luhmanns Kontingenzformel soll Gemeinsamkeiten aufzeigen.
- Systemtheoretische Analyse von Herbarts Pädagogik
- Herbarts Verständnis von Bildsamkeit als zentraler pädagogischer Begriff
- Bildsamkeit als Prozess der Selbstorganisation
- Vergleich von Herbarts Bildsamkeit mit Luhmanns Systemtheorie
- Implikationen für die moderne Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die historische Bedeutung des Begriffs der Bildsamkeit in der Pädagogik. Sie hebt hervor, dass Herbart den Begriff der Bildsamkeit zu einem Grundbegriff der Pädagogik erhob, und betont, dass dieses Konzept trotz seiner historischen Bedeutung in der modernen Pädagogik oft vernachlässigt wird. Die Arbeit beabsichtigt, Herbarts Ansatz mit systemtheoretischen Ansätzen zu vergleichen und die „Erfahrung der Bildsamkeit“ als Aktivität zu betrachten. Der Vergleich mit Luhmanns Kontingenzformel bildet den Abschluss.
Systemtheorien: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene systemtheoretische Ansätze und deren Relevanz für das Verständnis von Herbarts Pädagogik. Es analysiert die Ansprüche und Lösungsansätze dieser Theorien und diskutiert die Einheit von System, Umwelt und Differenzen. Die Kapitel-Unterpunkte untersuchen detailliert die Komponenten und Strukturen systemtheoretischer Modelle, um ein umfassendes Verständnis für die Anwendung dieser Theorien auf pädagogische Konzepte zu schaffen. Die Untersuchung der Systemstruktur und der Differenz zwischen System und Umwelt ist dabei zentral für die spätere Analyse von Herbarts Bildsamkeitsbegriff.
Bildsamkeit als systemischer Ansatz nach Herbart: Dieses Kapitel analysiert Herbarts pädagogischen Ansatz systematisch. Es untersucht den Edukanden als System von Operationen, das „Gemüth“ als System, das System der Selbsterhaltung und das System der Lebenskräfte. Es wird detailliert das Zusammenwirken von Selbsterhaltung und Lebenskraft im Kontext von Herbarts Bildsamkeitstheorie erläutert. Der Fokus liegt darauf, Herbarts Konzept der Bildsamkeit als einen systemischen Ansatz zu verstehen und dessen innere Logik zu rekonstruieren. Die verschiedenen Unterkapitel tragen zu einem umfassenden Bild von Herbarts Systematik bei, ohne einzelne Aspekte isoliert zu betrachten.
Folgen für die pädagogische Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die Konsequenzen von Herbarts Bildsamkeitstheorie für die pädagogische Theorie. Es werden die Implikationen seines Ansatzes für die Praxis der Erziehung und Bildung erörtert, indem die verschiedenen Aspekte seiner Theorie in einen breiteren pädagogischen Kontext eingeordnet werden. Es geht hier um die praktische Relevanz der theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel.
Herbarts Verständnis der Bildsamkeit im Vergleich mit der Kontingenzformel des Erziehungssystems von Luhmann: Dieses Kapitel vergleicht Herbarts Verständnis von Bildsamkeit mit Luhmanns Kontingenzformel im Erziehungssystem. Es untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze und analysiert, wie beide Perspektiven das Phänomen der Bildung und Lernfähigkeit beleuchten. Die Unterkapitel zu "Humane Perfektion", "Bildung" und "Lernfähigkeit" beleuchten jeweils spezifische Aspekte dieses Vergleichs, ohne sich dabei auf einzelne Unterpunkte zu beschränken. Der Vergleich der beiden Denker zielt auf die Herausarbeitung von Schnittmengen und Differenzen ab.
Schlüsselwörter
Bildsamkeit, Herbart, Systemtheorie, Pädagogik, Selbstorganisation, Luhmann, Kontingenz, Bildung, Lernfähigkeit, Humane Perfektion, System, Umwelt, Operationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Systemtheoretische Analyse von Herbarts Pädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Johann Friedrich Herbarts pädagogischen Ansatz, insbesondere seinen Begriff der Bildsamkeit, im Kontext moderner systemtheoretischer Ansätze. Der Fokus liegt auf der Betrachtung von Bildsamkeit als Aktivität und Operation und dem Vergleich mit Niklas Luhmanns Kontingenzformel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt systemtheoretische Ansätze, Herbarts Verständnis von Bildsamkeit (als System von Operationen, Selbsterhaltung und Lebenskräften), die Folgen für die pädagogische Theorie und einen Vergleich zwischen Herbarts Bildsamkeit und Luhmanns Systemtheorie, insbesondere der Kontingenzformel. Dabei werden Aspekte wie humane Perfektion, Bildung und Lernfähigkeit beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Systemtheorien, Herbarts Bildsamkeit als systemischer Ansatz, den Folgen für die pädagogische Theorie und einem Vergleich von Herbart und Luhmann. Jedes Kapitel enthält detaillierte Analysen und Diskussionen der jeweiligen Themen.
Welche systemtheoretischen Ansätze werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene systemtheoretische Ansätze und deren Relevanz für das Verständnis von Herbarts Pädagogik. Es wird die Einheit von System, Umwelt und Differenzen analysiert, sowie die Ansprüche und Lösungsansätze dieser Theorien diskutiert.
Wie wird Herbarts Bildsamkeit konzeptualisiert?
Herbarts Bildsamkeit wird als Aktivität und Operation betrachtet, der Edukand als System von Operationen, das „Gemüth“ als System, und die Systeme der Selbsterhaltung und der Lebenskräfte werden analysiert. Das Zusammenwirken dieser Aspekte wird im Kontext von Herbarts Theorie detailliert erläutert.
Was sind die Implikationen für die moderne Pädagogik?
Die Arbeit erörtert die Konsequenzen von Herbarts Bildsamkeitstheorie für die moderne pädagogische Theorie und Praxis. Es werden die Implikationen seines Ansatzes für Erziehung und Bildung in einen breiteren Kontext eingeordnet.
Wie wird Herbart mit Luhmann verglichen?
Der Vergleich zwischen Herbarts Bildsamkeit und Luhmanns Kontingenzformel im Erziehungssystem untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze hinsichtlich Bildung und Lernfähigkeit. Die Aspekte humane Perfektion, Bildung und Lernfähigkeit werden im Detail betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bildsamkeit, Herbart, Systemtheorie, Pädagogik, Selbstorganisation, Luhmann, Kontingenz, Bildung, Lernfähigkeit, Humane Perfektion, System, Umwelt, Operationen.
- Citation du texte
- Dennis Bockholt (Auteur), 2006, Historisch-systematische Auseinandersetzung mit Herbarts Begriff der Bildsamkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69832