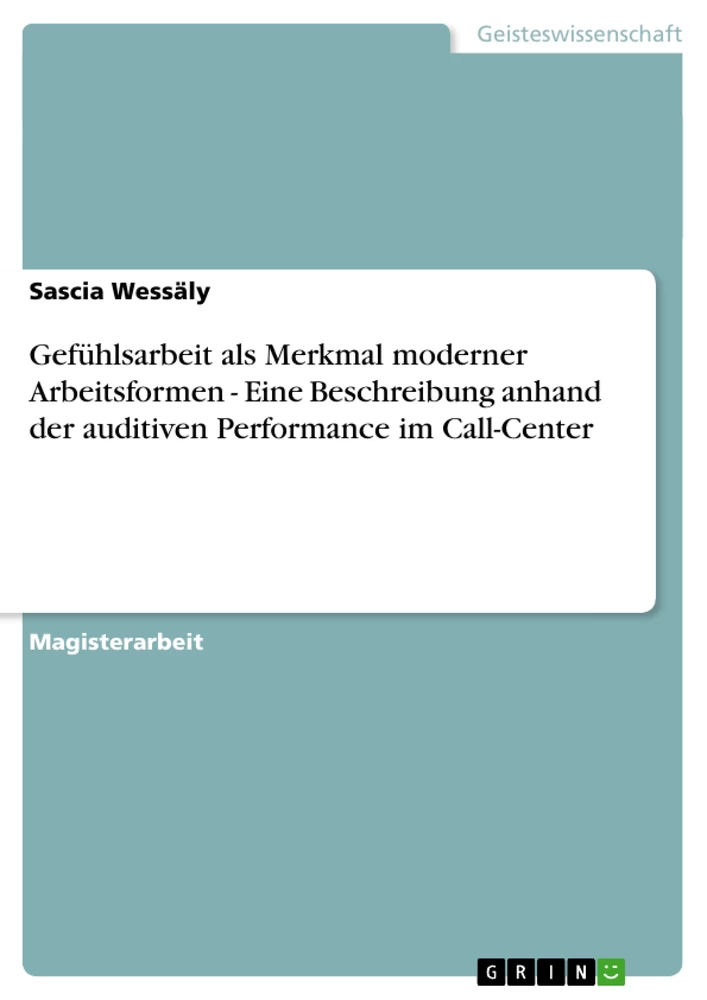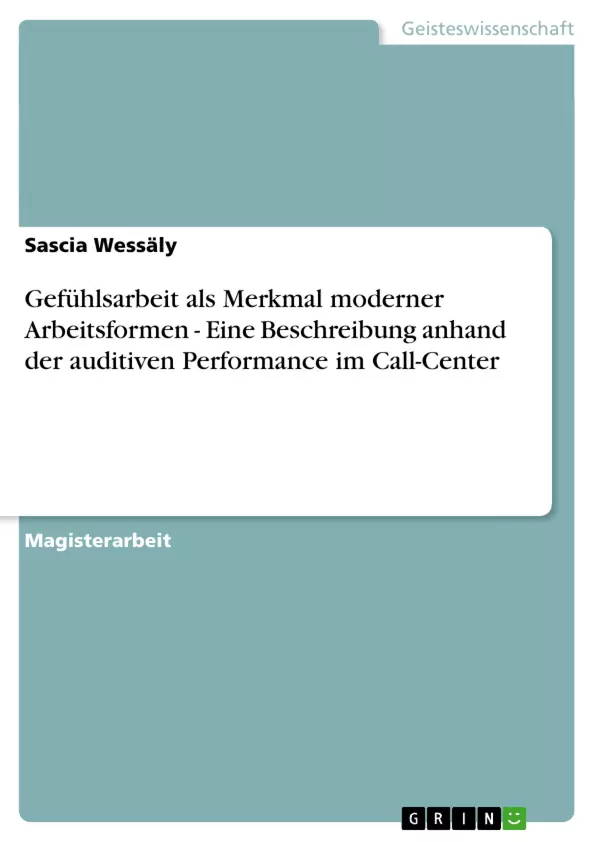Tiefgreifende Veränderungen der Erwerbsarbeit, bezogen auf den westeuropäischen Teil dieser Welt, werden in Politik, Wirtschaft und in den unterschiedlichsten Teilbereichen der Soziologie diskutiert und prognostiziert (Kocka 2001, Schweikart & Franzke 2001). Sei es in arbeits-, industrie-, organisations-, oder sei es in techniksoziologischer Ausrichtung, neue Arbeitsbegriffe entstehen aus und in jeder Richtung und werden häufig mit entsprechenden Gesellschaftsbegriffen assoziiert. Im Zuge dieser Entwicklung wurde auch der vielfach verwendete jedoch wenig konkretisierte Begriff einer ‘Dienstleistungsgesellschaft’ geprägt (Häusermann & Siebel 1995). Den etwas eingeschränkteren, dafür jedoch greifbareren Begriff der Dienstleistungsarbeit möchte ich als Rahmen nutzen, in welchem ich Tendenzen eines Arbeitswandels hin zu neuartigen Arbeitsformen der Erwerbsarbeit (Brose 2000, Dunkel 1988) anhand des Merkmals Gefühlsarbeit in von einer Gruppe von Studierenden der Technischen Universität Berlin 1 untersuchten Call Centern aufzeige. Die These lautet in diesem Kontext, dass eine soziologische Deutung moderner Arbeitsformen nicht ohne die Einbeziehung einer interaktiv geleisteten Gefühlsarbeit als ein Merkmal erfolgen sollte. Damit einhergehend muss eine zunehmende Bedeutung von „emotional labor“ 2 insbesondere für die arbeits-, industrie- und auch techniksoziologischen Ausrichtungen konstatiert werden. Da Gefühlsarbeit als ein interaktives - also genuin soziales - Phänomen theoretisch erfassbar und vor allen Dingen empirisch beobachtbar ist, sollte sie nicht länger nur in ihrer psychischen Dynamik beleuchtet werden. Aufbauend auf und ergänzend zur bereits vorliegenden psychologischen Erforschung dieses Gebietes ist es notwendig, soziologische Erklärungspotenziale einzubeziehen, um der Komplexität des Gegenstandes innerhalb prognostizierter Veränderungen von Erwerbsarbeit Rechnung zu tragen. Ich schließe mich damit an Überlegungen und Hinweise an, die schon Ende der [...]
Inhaltsverzeichnis
- Thesenvorstellung
- Bestimmung eines Arbeitsbegriffes zur Positionierung von Gefühlsarbeit
- Der marxistische Arbeitsbegriff
- Die Dichotomie von Arbeit und Interaktion nach Habermas
- Das subjektivierte Arbeitshandeln nach Böhle
- Das Untersuchungsfeld Call Center
- Verortung des Call Center Feldes Deutschland
- Call Center in der soziologischen Forschung
- Herleitung der methodischen Vorgehensweise der CALL CENTER CULTURE Studie
- Gefühlsarbeit als auditive Performance
- Gefühle aus soziologischer Perspektive
- Gegenstand, Mittel und Bedingung als Dimensionen der auditiven Performance
- Gefühle als Gegenstand
- Gefühle als Mittel
- Gefühle als Bedingung
- Interaktivität als Bedingung der auditiven Performance
- Technisches Setting
- Kundendatenbank
- Gesprächsdatenbanken
- Wissensdatenbanken
- Die "stumme Seite" des Calls
- Verbergen der Interaktivitäten
- Verborgene Interaktionen für ein ausgeglichenes Gefühlsmanagement
- Deutungsebenen für Gefühlsarbeit als Merkmal moderner Arbeitsformen
- Argumentation und Schlussfolgerungen
- Zukünftige Forschungsdesigns und Perspektiven für Gefühlsarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wandel von Erwerbsarbeit und der Bedeutung von Gefühlsarbeit im modernen Arbeitskontext, speziell im Bereich von Call Centern. Die Arbeit zielt darauf ab, einen soziologischen Arbeitsbegriff zu entwickeln, der die interaktive Natur von Gefühlsarbeit in Dienstleistungsberufen berücksichtigt. Sie untersucht die "auditive Performance" im Call Center als eine Form der Gefühlsarbeit, die durch Interaktionen mit technischen Artefakten entsteht.
- Soziologischer Arbeitsbegriff unter Einbezug von Gefühlsarbeit
- Analyse der "auditiven Performance" im Call Center als Form der Gefühlsarbeit
- Zusammenhang zwischen Interaktion und Technik bei der Gestaltung von Gefühlsarbeit
- Relevanz von Gefühlsarbeit für moderne Arbeitsformen und deren soziologische Deutung
- Entwicklung eines theoretischen Rahmens für die Untersuchung von Gefühlsarbeit im Call Center
Zusammenfassung der Kapitel
- Thesenvorstellung: Die Arbeit stellt die These auf, dass Gefühlsarbeit ein wichtiges Merkmal moderner Arbeitsformen ist und in der soziologischen Analyse von Erwerbsarbeit berücksichtigt werden sollte. Sie konzentriert sich auf die auditive Performance im Call Center als Beispiel für diese Art von Arbeit.
- Bestimmung eines Arbeitsbegriffes zur Positionierung von Gefühlsarbeit: Dieses Kapitel erörtert verschiedene Arbeitsbegriffe und ihre Relevanz für die Analyse von Gefühlsarbeit, insbesondere im Vergleich zu traditionellen marxistischen und interaktionistischen Perspektiven.
- Das Untersuchungsfeld Call Center: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung und Entwicklung des Call Center Sektors in Deutschland, sowie die bisherigen soziologischen Forschungsansätze zu diesem Thema.
- Gefühlsarbeit als auditive Performance: Dieses Kapitel definiert Gefühlsarbeit aus soziologischer Perspektive und untersucht die verschiedenen Dimensionen der "auditiven Performance" im Call Center. Es analysiert, wie Gefühle als Gegenstand, Mittel und Bedingung der Arbeit agieren und wie Interaktion mit technischen Artefakten die Gestaltung dieser Arbeitsform beeinflusst.
Schlüsselwörter
Gefühlsarbeit, auditive Performance, Call Center, Interaktion, Technik, Dienstleistungsarbeit, soziologischer Arbeitsbegriff, moderne Arbeitsformen, CALL CENTER CULTURE Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gefühlsarbeit (Emotional Labor)?
Es bezeichnet die bewusste Steuerung und Darstellung von Gefühlen während der Arbeit, um eine bestimmte Wirkung beim Kunden zu erzielen (z.B. Freundlichkeit trotz Stress).
Warum sind Call-Center ein Paradebeispiel für Gefühlsarbeit?
In Call-Centern erfolgt die Arbeit primär über die Stimme (auditive Performance). Mitarbeiter müssen ihre Emotionen kontrollieren, um professionell und kundenorientiert zu wirken.
Was bedeutet "auditive Performance"?
Es ist die Leistung, allein durch die Stimme und deren Modulation Kompetenz, Freundlichkeit und Empathie zu vermitteln, ohne visuelle Hilfsmittel.
Wie hängen Technik und Gefühlsarbeit zusammen?
Technische Systeme wie Kundendatenbanken und Wissensmanagement-Tools setzen den Rahmen für das Gespräch und können den emotionalen Druck auf die Mitarbeiter erhöhen.
Was ist die "stumme Seite" des Calls?
Damit sind die verborgenen Tätigkeiten des Mitarbeiters gemeint, wie das Tippen oder Suchen in Datenbanken, während er gleichzeitig ein flüssiges und emotional passendes Gespräch führt.
- Citar trabajo
- M.A. Sascia Wessäly (Autor), 2004, Gefühlsarbeit als Merkmal moderner Arbeitsformen - Eine Beschreibung anhand der auditiven Performance im Call-Center, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69853