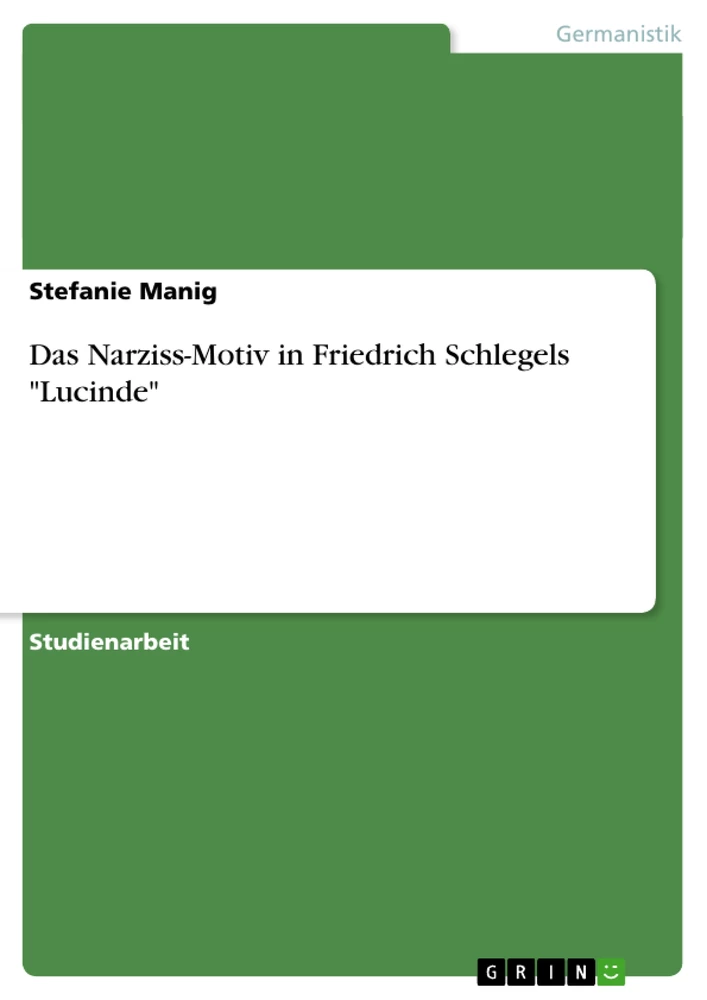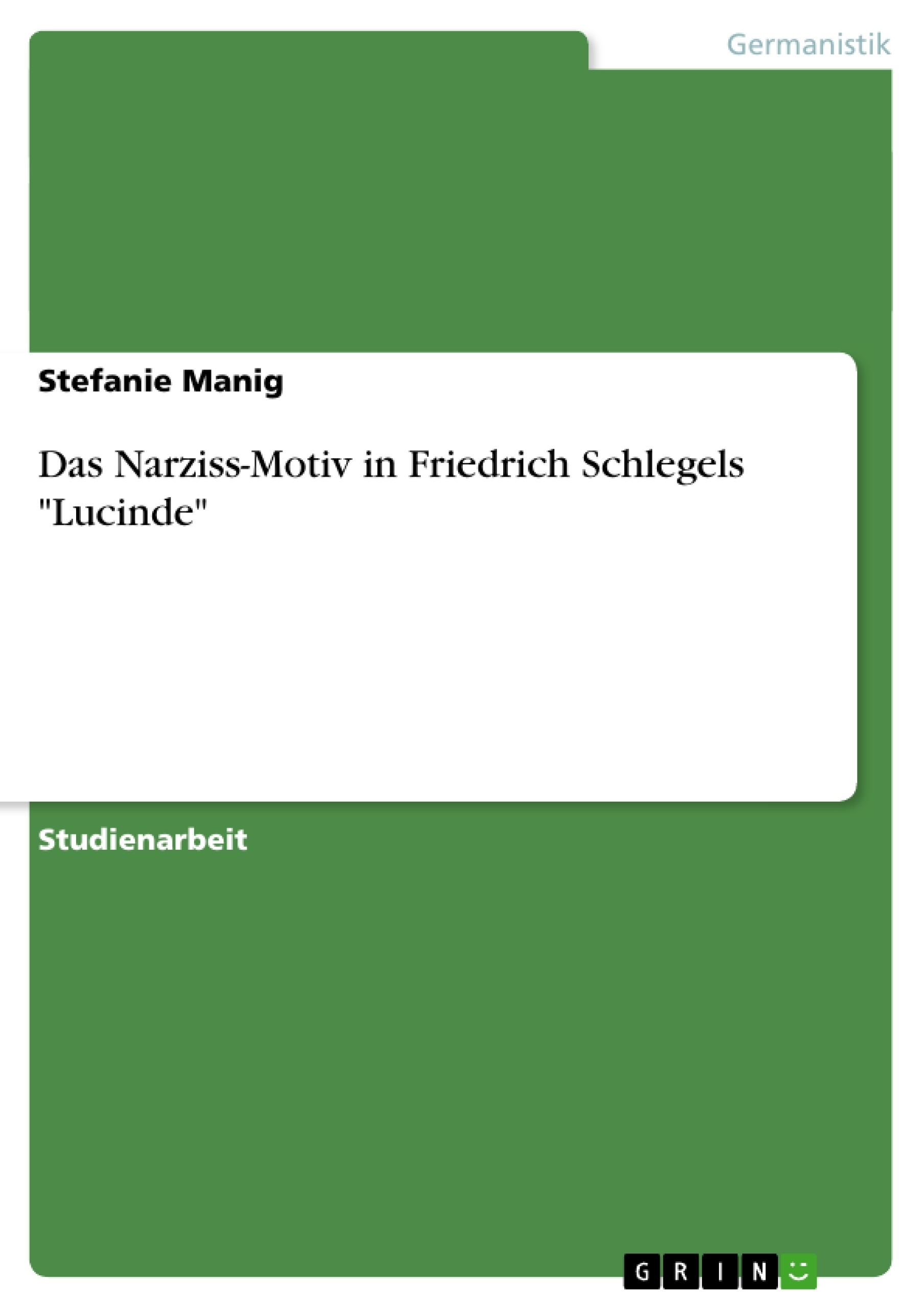Diese Hausarbeit befasst sich mit Friedrich Schlegels Roman „Lucinde“ und dem darin enthaltenen Narziss-Motiv.
Wie ist die Konzeption der Selbstliebe in Schlegels Roman angelegt, bzw. wie narzisstisch wird Julius, der männliche Protagonist des Werkes, von ihm dargestellt? Inwieweit schließt Selbstliebe alle andere Liebe in sich ein und ist sie nicht eher der Ausdruck eines hemmungslosen Egoismus, der mit Liebe zu anderen Menschen nicht viel zu tun hat? Kann ein Narziss überhaupt „richtig“ lieben?
Um dem Narzissmus an sich näher zu kommen, soll im ersten Teil der Arbeit die antike Fassung Ovids eingeführt und im zweiten Teil ein Vergleich zwischen der Vorlage des römischen Dichters und Schlegels Verarbeitung vorgenommen werden. Im dritten Teil der Hausarbeit werden verschiedene Textstellen aus dem Roman daraufhin untersucht, ob und inwieweit Julius narzisstisch ist und welche Rolle Lucinde dabei spielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Narziss-Motiv in F. Schlegels Roman „Lucinde“
- Die Narziss-Geschichte in Ovids „Metamorphosen“
- Ovid und Schlegel - ein Vergleich
- Der Narzissmus der Figur „Julius“
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Narziss-Motiv in Friedrich Schlegels Roman „Lucinde“ im Kontext der antiken Narziss-Geschichte Ovids. Ziel ist es, die Verarbeitung des Mythos durch Schlegel zu analysieren und die Darstellung des Narzissmus bei der Figur Julius zu beleuchten. Die Rolle Lucindes in diesem Zusammenhang wird ebenfalls untersucht.
- Vergleich der Narziss-Darstellung bei Ovid und Schlegel
- Analyse des Narzissmus der Figur Julius in „Lucinde“
- Bedeutung des Narziss-Motivs für die Gesamtkomposition des Romans
- Die Rolle Lucindes im Kontext des Narzissmus
- Interpretation des Narziss-Motivs als Ausdruck romantischer Selbstfindung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und benennt die zentrale Fragestellung: Inwieweit ist die Selbstliebe bei Friedrich Schlegel, dargestellt am Beispiel des Romans "Lucinde" und der Figur Julius, Ausdruck eines hemmungslosen Egoismus oder eine umfassende Form der Liebe? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die antike Narziss-Geschichte bei Ovid einführt, einen Vergleich zwischen Ovid und Schlegels Verarbeitung vornimmt und schließlich die narzisstischen Aspekte der Figur Julius analysiert. Die Einleitung verdeutlicht den Fokus auf Ovids "Metamorphosen" als Grundlage und kündigt einen Ausblick auf weitere Deutungsmöglichkeiten an.
2. Das Narziss-Motiv in F. Schlegels Roman „Lucinde“: Dieses Kapitel analysiert das Auftreten des Narziss-Motivs in Schlegels "Lucinde". Es beginnt mit einer Darstellung der Narziss-Geschichte in Ovids "Metamorphosen", die als Grundlage für alle späteren literarischen Bezüge dient. Der Vergleich zwischen Ovids Version und Schlegels Verarbeitung zeigt, wie Schlegel das Motiv aufgreift, jedoch in einen neuen Kontext romantischer Selbstfindung einbettet. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, inwieweit Julius, der männliche Protagonist, narzisstische Züge aufweist, und welche Rolle Lucinde dabei spielt. Schlegel verwendet das Narziss-Motiv nicht als reine Wiederholung des Mythos, sondern als Metapher für die komplexen Beziehungen zwischen Selbstliebe und Liebe zu anderen, ein zentrales Thema des Romans.
Schlüsselwörter
Friedrich Schlegel, Lucinde, Narziss, Narzissmus, Ovid, Metamorphosen, Romantische Liebe, Selbstliebe, Egoismus, Julius, Lucinde (Figur), romantische Selbstfindung, literarische Interpretation.
Häufig gestellte Fragen zu: Das Narziss-Motiv in Friedrich Schlegels "Lucinde"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert das Narziss-Motiv in Friedrich Schlegels Roman "Lucinde" im Kontext der antiken Narziss-Geschichte aus Ovids "Metamorphosen". Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Darstellungen und der Analyse des Narzissmus der Figur Julius. Die Rolle Lucindes und die Bedeutung des Motivs für die Gesamtkomposition des Romans werden ebenfalls untersucht. Die Arbeit beleuchtet, ob die Selbstliebe bei Schlegel Ausdruck von Egoismus oder umfassender Liebe ist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Vergleich der Narziss-Darstellung bei Ovid und Schlegel; die Analyse des Narzissmus der Figur Julius; die Bedeutung des Narziss-Motivs für die Gesamtkomposition von "Lucinde"; die Rolle Lucindes im Kontext des Narzissmus; und die Interpretation des Narziss-Motivs als Ausdruck romantischer Selbstfindung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Das Narziss-Motiv in F. Schlegels Roman „Lucinde“") und ein Schlusswort. Das Hauptkapitel beinhaltet eine Darstellung der Narziss-Geschichte bei Ovid, einen Vergleich zwischen Ovid und Schlegel, und eine Analyse des Narzissmus der Figur Julius. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungsfrage. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Selbstliebe und Egoismus bei Schlegel dar. Das Hauptkapitel analysiert das Narziss-Motiv in "Lucinde", beginnend mit Ovids Version, um dann den Vergleich mit Schlegels Interpretation vorzunehmen und den Narzissmus von Julius zu untersuchen. Die Rolle Lucindes wird dabei ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schlegel, Lucinde, Narziss, Narzissmus, Ovid, Metamorphosen, Romantische Liebe, Selbstliebe, Egoismus, Julius, Lucinde (Figur), romantische Selbstfindung, literarische Interpretation.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Verarbeitung des Narziss-Mythos durch Schlegel in "Lucinde" und die Beleuchtung der Darstellung des Narzissmus bei der Figur Julius. Die Rolle Lucindes in diesem Zusammenhang wird ebenfalls untersucht.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Manig (Autor:in), 2004, Das Narziss-Motiv in Friedrich Schlegels "Lucinde", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69882