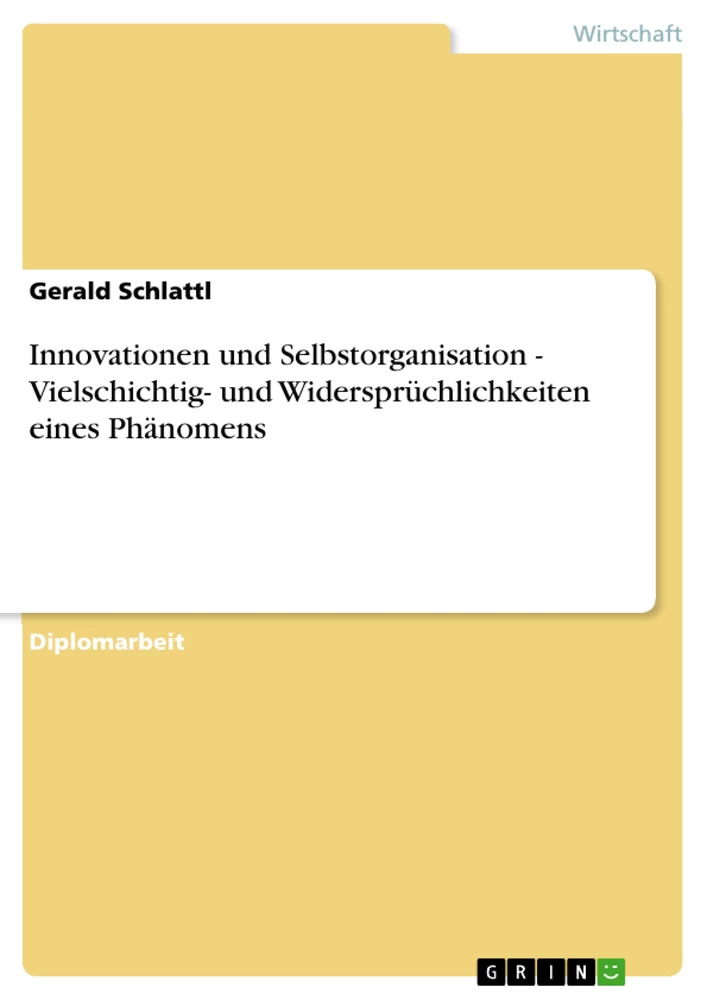Einleitung
Im Rahmen des Seminars OE (4)9 behandelten wir das Thema Innovationen und stellten uns die Frage, inwieweit Organisationen weiterzuentwickeln seien, um einen möglichst hohen Output an marktfähigen Neuerungen gewährleisten zu können. Dabei wurde über eine rein organisationsbezogene Perspektive hinaus, der Zugang über eine Art "Innovationspersönlichkeit“ ermöglichst. Gerade diesem Teilbereich galt damals mein spezielles Interesse und ich drängte sich mir die Frage auf, inwieweit dieses Thema etwas ganz besonderes mit mir persönlich zu tun hatte.
Zwangsläufig stieß ich dabei auf neue Erkenntnisse über mich selbst. Mir schoß plötzlich dieses Kindergartenfoto mit diesen hinterhältigen, leicht verbissenen Grinsen (nach dem Motto: „Und die sie dreht sich doch!“) durch den Kopf! Ich erinnerte mich plötzlich, wie ich als kleines Kind mit meinem Physikbaukasten spielte und unbedingt etwas „erfinden“ wollte. Wenn mich damals jemand fragte, was ich denn beruflich einmal werden wollte, kam es wie aus der Pistole geschossen: Erfinder!
Mir wurde somit bewußt, daß dieses Diplomarbeitsthema quasi zu einer Art Berufung wurde und sich für mich als eine Neuentdeckung bzw. Interpretation des „Erfinder-Werden-Wollens“ herausstellte.
Das Thema Innovationen kam mir wie gerufen. Die Herausforderung war nun das Innovative an Innovationen zu suchen, einen „neuen“ Zugang zu finden. Das Thema Innovationen von einer systemtheoretischen Seite her anzugehen, schien mir dabei die ideale Kombination zu sein, dieser Aufgabe – wie ich hoffe - auch gerecht zu werden. Es wurde zu MEINEM Thema, ein Thema, das mir unmittelbar auf den Leib geschneidert ist. Als logische Konsequenz auf eine rein theoretische Beschäftigung damit überlegte ich mir, wie sich das ganze nun denn auch nutzenmaximal in die Tat umsetzen ließe.
Das Studium der Angewandten Betriebswirtschaftslehre in Klagenfurt sollte und konnte nicht umsonst nur so heißen, weswegen ich mich sofort auf den Weg machte, mir einen „Mentor“ für die Umsetzung zu suchen und prompt fand.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- B. INNOVATIONSMANAGEMENT
- I. ANALYSE DES INNOVATIONSPHÄNOMENS
- 1. PROBLEMATISIERUNG
- 2. BEGRIFFLICHE KLÄRUNG
- 3. INNOVATIONSARTEN
- 3.1 Spezifikum Sozialinnovationen
- 3.2 Abgrenzung zum Kai-zen, TQM und KVP
- 3.3 Merkmalsorientierte Betrachtungsweise
- 3.3.1. Neuigkeitsgrad
- 3.3.2. Unsicherheit und Risiko
- 3.3.3. Komplexität
- 3.3.4. Konfliktgehalt
- 3.4 Sonstige Klassifizierungsversuche
- II. DISKUSSION ZENTRALER KONSTRUKTE
- 1. INNOVATIONSBEDARF
- 1.1 Dimensionen
- 1.1.1. Systemspezifischer Innovationsbedarf
- 1.1.2. Innovationsartenspezifischer Innovationsbedarf
- 1.1.3. Zeitlicher Innovationsbedarf
- 1.2 Entstehungsgründe
- 2. INNOVATIONSFÄHIGKEIT
- 2.1 Begriff
- 2.2 Einflußfaktoren
- 2.2.1. Organisationsbezogene Einflußfaktoren:
- 2.2.2. Kommunikations- und Informationsbezogene Faktoren:
- 2.2.3. Mitarbeiterbezogene Einflußfaktoren:
- 2.2.4. Unternehmenspolitische Einflußfaktoren:
- (a) Exkurs: Unternehmensleitbilder in Deutschland – eine Situationsanalyse:
- (b) Management by Objectives (MbO)
- (c) Unternehmensphilosophie und -kultur:
- 2.2.5. Situative Einflußfaktoren
- (a) technology push versus demand pull Hypothese
- (b) Wirtschaftliche Situation der Unternehmen
- (c) Marktstruktur und Wettbewerbssituation
- (d) Unternehmensgröße
- III. INNOVATIONSPROZEẞ UND METHODEN
- 1. PROZESSDARSTELLUNG
- 1.1 Ideengenerierung in den Suchfeldern
- 1.2 Entscheidungs-/Bewertungsprozeß am Beispiel der Lead – User – Methodik:
- 1.3 Realisierung - Fallbeispiel
- 1.3.1. Beispiel1: Rohrleitungsinstallationen
- 1.3.2. Beispiel 2: Behandlungsstühle für Zahnärzte
- 1.3.3. Beispiel 3: Infusionsgeräte
- IV. INNOVATIONSVERHALTEN
- 1. EINLEITUNG
- 2. KREATIVITÄT, INTUITION UND PERSÖNLICHKEIT
- 2.1 Allgemeiner Teil
- 2.2 Was ist eigentlich Kreativität?
- 2.3 Entdecken oder Erfinden: Wie läßt sich Verstehen verstehen?
- 2.4 Erkenntnistheoretische Irrtümer und Fallen
- 2.4.1. Irrtum Nummer 1:“Verwechslung von Speisekarte und Essen“:
- 2.4.2. Irrtum Nummer 2: die Idee von einer, unteilbaren Wirklichkeit und Wahrheit
- 2.4.3. Irrtum 3: Das Alles - oder Nichts - Prinzip
- 2.4.4. Irrtum 4: Die Idee der persönlichen Identität
- 2.4.5. Irrtum 5: Die Idee der Steuerung
- 2.4.6. Irrtum 6: Die Idee der Hierachie
- 2.4.7. Irrtum 7: Die Idee der Berechenbarkeit der Welt
- 2.4.8. Irrtum 8: Die Idee, man wüßte, was gut und schlecht ist
- 2.4.9. Irrtum 9: Die Verwechslung von aktiver und passiver Negation:
- 2.4.10. Irrtum 10: Die Idee der Ohnmacht und der Allmacht
- V. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
- 1. ALLGEMEIN
- 2. INNOVATIONSMANAGEMENT IST CHANGE MANAGEMENT – EINE „ABRUNDUNG”
- 3. BEDEUTUNG DER AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG ZUM THEMENKREIS
- 4. EUROPA – EINE NEUE INNOVATIONSKULTUR?
- 5. ZUKUNFTSFÄHIGE SOZIALARCHITEKTUREN UND DIE ROLLE VON PROZEẞBEGLEITERN
- C. SYSTEMTHEORIE
- I. SELBSTORGANISATION
- 1. ZUR THEORIE AUTOPOIETISCHER SYSTEME
- 1.1 Zentraler Begriffe
- 2. KOMPETENZENTWICKLUNG
- 2.1 Vom Können zum Wollen
- 2.2 Change- und Innovationskompetenz
- 2.3 Training zur Verbesserung des Selbstkonzeptmanagements
- 3. WERTEWANDEL
- D. PRAXISTEIL
- I. ALLGEMEINE EINFÜHRUNG
- II. AUSGANGSLAGE UND GRUNDLAGEN
- III. ERGEBNISSE:
- 1. MEINUNG der MitarbeiTER
- 2. DIE VISIONÄRE FÜHRUNG HAT EINE ANDERE PERSPEKTIVE
- 3. INNOVATIONEN
- EIN WIDERSPRUCH IN SICH
- E. RESÜMEE
- I. ZUSAMMENFASSUNG
- II. KRITISCHE WÜRDIGUNG
- III. KREATIVER AUSBLICK
- Analyse des Innovations-Phänomens
- Diskussion zentraler Konstrukte wie Innovationsbedarf und Innovationsfähigkeit
- Behandlung des Innovationsprozesses und verschiedener Methoden
- Untersuchung des Innovationsverhaltens im Kontext von Kreativität und Persönlichkeit
- Verknüpfung der Thematik mit der Systemtheorie und der Selbstorganisation
- A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und skizziert die Forschungsfragen.
- B. Innovationsmanagement: Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse des Innovations-Phänomens, der Definition wichtiger Begriffe, der Klassifizierung von Innovationsarten und der Diskussion zentraler Konstrukte wie Innovationsbedarf und Innovationsfähigkeit. Es werden außerdem die Einflussfaktoren auf die Innovationsfähigkeit von Organisationen und die Rolle von Unternehmenspolitik und Kultur beleuchtet.
- C. Systemtheorie: Dieses Kapitel untersucht das Konzept der Selbstorganisation im Kontext der Systemtheorie. Es beleuchtet die Theorie autopoietischer Systeme und ihre Relevanz für die Innovationsforschung. Darüber hinaus werden Themen wie Kompetenzentwicklung und Wertewandel in Bezug auf die Selbstorganisation behandelt.
- D. Praxisteil: Dieser Teil der Diplomarbeit befasst sich mit einer empirischen Untersuchung zu einem konkreten Fallbeispiel. Die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert und analysiert. Es werden die Meinungen der Mitarbeiter, die Visionäre Führung und die vielschichtigen Aspekte von Innovationen beleuchtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Innovation und dessen komplexer Beziehung zur Selbstorganisation. Sie analysiert die vielschichtigen Aspekte der Innovation, untersucht den Innovationsbedarf und die Innovationsfähigkeit von Organisationen und beleuchtet den Prozess der Innovation sowie verschiedene Methoden. Darüber hinaus werden die Rolle von Kreativität, Intuition und Persönlichkeit im Innovationsverhalten diskutiert.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Innovation, Selbstorganisation, Innovationsmanagement, Innovationsbedarf, Innovationsfähigkeit, Innovationsverhalten, Kreativität, Intuition, Persönlichkeit, Systemtheorie, Autopoiesis, Kompetenzentwicklung, Wertewandel, Praxisbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zusammenhang zwischen Innovation und Selbstorganisation?
Die Arbeit untersucht, wie Organisationen durch Prinzipien der Selbstorganisation (Autopoiesis) ihre Innovationsfähigkeit steigern können, statt sie starr zu steuern.
Was zeichnet eine "Innovationspersönlichkeit" aus?
Es geht um die Rolle von Kreativität, Intuition und dem persönlichen "Erfindergeist", die für den Erfolg von Neuerungen entscheidend sind.
Was sind Sozialinnovationen?
Sozialinnovationen sind neue soziale Praktiken und Organisationsformen, die über rein technologische Erfindungen hinausgehen.
Was bedeutet "Autopoiesis" im Kontext von Unternehmen?
Es beschreibt Systeme, die sich selbst erhalten und reproduzieren. Im Innovationsmanagement bedeutet dies, Strukturen zu schaffen, die sich organisch weiterentwickeln.
Welche Faktoren beeinflussen die Innovationsfähigkeit?
Untersucht werden organisationsbezogene, mitarbeiterbezogene, kommunikative und unternehmenspolitische Faktoren sowie die Unternehmenskultur.
Was ist die Lead-User-Methodik?
Ein Ansatz im Innovationsprozess, bei dem fortschrittliche Anwender (Lead User) frühzeitig in die Entwicklung neuer Produkte einbezogen werden.
- Citar trabajo
- Gerald Schlattl (Autor), 2001, Innovationen und Selbstorganisation - Vielschichtig- und Widersprüchlichkeiten eines Phänomens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/699