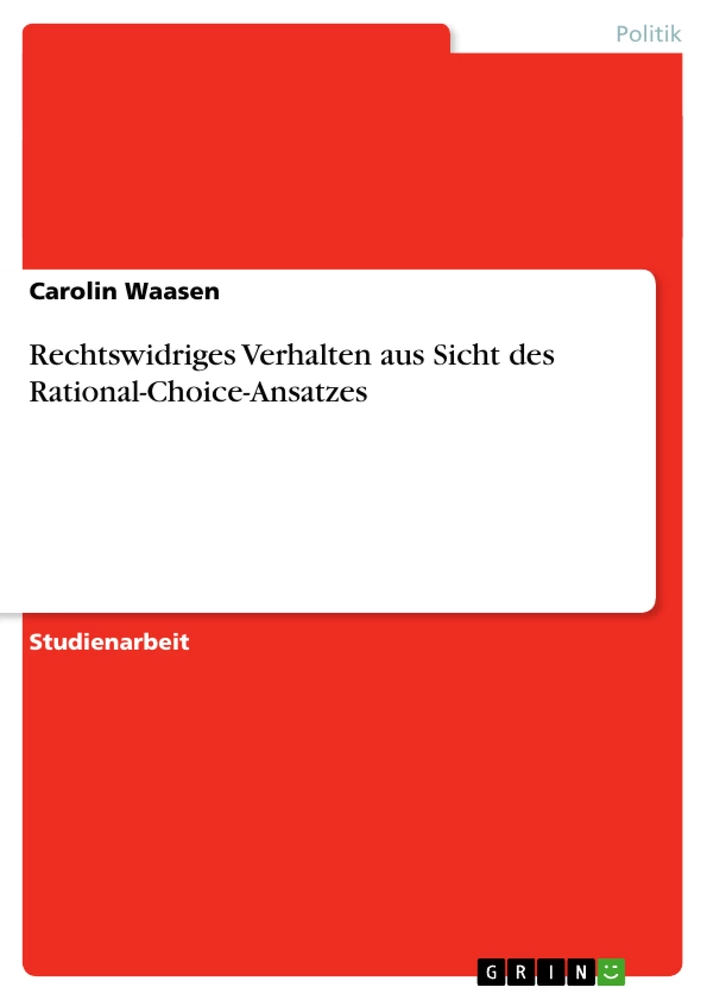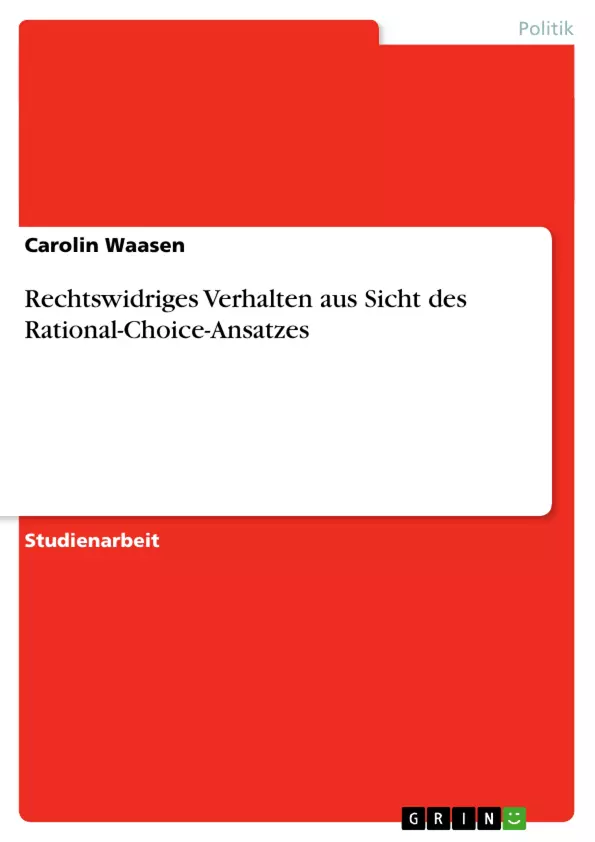Obwohl im letzten Jahrzehnt die Quote der Gesamt-Kriminalität in Deutschland leicht rückläufig ist, sind die 6 391 715 erfassten Fälle im Jahr 2005 (vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik 2005: 3) absolut gesehen nicht zu verachten. Kriminelle haben damit immerhin einen Anteil von rund 7,75 Prozent an der Gesamtgesellschaft - wobei die Dunkelziffer noch nicht berücksichtigt ist. Dies bringt einen erheblichen Schaden für den Sozialstaat, den Erhalt von Recht und Ordnung sowie die ganze Volkswirtschaft mit sich (vgl. Becker 1976: S.41). Somit ist eine Untersuchung von Täterprofil und -verhalten, die ein Teilgebiet der Kriminologie darstellt, jederzeit aktuell. In den letzten 25 Jahren lässt sich ein Gesellschaftswandel weg von traditionellen Normen hin zur sogenannten „Spätmoderne“ feststellen. Ausgelöst wurde dieser Wandel durch die sich ständig ändernden Arbeits- und Lebensbedingungen, die wiederum zu einem nicht unwesentlichen Teil durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt hervorgerufen wurden (vgl. Kunz 2001). In der Folge löst sich der Mensch immer mehr aus seinem sozialen Umfeld und mutiert zum Einzelkämpfer: „Die Gesellschaft kennt keine allseits verbindlichen Normalitätsvorstellungen mehr und zerspaltet sich in eine Vielfalt schier unbegrenzter Variationen von nebeneinander existierenden Lebenswelten.“ (Kunz 2001: 192). Diesen äußeren Umständen musste sich auch die Sozialwissenschaft anpassen und ihr Augenmerk verstärkt aufs Individuum richten. Des Weiteren war es unabdingbar, sich nun mehr den ökonomischen als den soziologischen gesellschaftlichen Aspekten zu widmen. In der Folge ergibt sich die Relevanz für eine mikroanalytisch arbeitende, sich an der Ökonomie orientierende Forschungsrichtung wie den Rational-Choice-Ansatz zur Bewertung und Analyse krimineller Vorgehensweisen. Erste Grundlagen lassen sich bereits im 18. und 19. Jahrhundert manifestieren, beispielsweise wenn Bentham zu der Erkenntnis kommt: „Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do.” (Bentham 1996: 11). Sich auf Überlegungen von Bentham stützend entwickelt Gary S. Becker in seinem umfassenden Werk „The Economic Approach to Human Behavior“ unter anderem eine für den Rational-Choice-Ansatz fundamentale Theorie über Delinquenz: „Crime and Punishment: An economic approach“ (1968).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretisches Konstrukt
- Gliederung
- Das Grundmodell zur Theorie des rational handelnden Verbrechers
- Empirische Erklärungskraft des Modells
- Erklärungskraft in Abhängigkeit von unterschiedlichen Situationen
- Empirisches Beispiel aus dem Bereich des Trittbrettfahrens: Das Schwarzfahren
- Erklärungskraft für die Delikte Ladendiebstahl und Steuerbetrug sowie Erweiterung um Ergebnisse des Zusammenhangs zwischen Schichtzugehörigkeit und Delikttyp
- Empirisches Beispiel aus dem Bereich der Jugendkriminalität: Der Straßenraub
- Kritische Stellungnahme zum theoretischen Modell
- Fazit
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des Rational-Choice-Ansatzes auf rechtswidriges Verhalten. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, ob kriminelle Handlungen tatsächlich rational begründet werden können und inwiefern das theoretische Modell zur Erklärung unterschiedlicher Delikte geeignet ist.
- Das Grundmodell des rational handelnden Verbrechers nach Gary S. Becker
- Empirische Überprüfung der Erklärungskraft des Modells in verschiedenen Situationen
- Kritische Analyse des Rational-Choice-Ansatzes
- Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Delikttyp
- Bedeutung von Nutzen- und Kostenkalkulation für kriminelle Handlungsweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Hypothese der Arbeit vor. Kapitel 2 erklärt das Grundmodell des rational handelnden Verbrechers nach Gary S. Becker und definiert den Begriff Kriminalität. Kapitel 3 befasst sich mit der empirischen Erklärungskraft des Modells und beleuchtet die Anwendbarkeit des Rational-Choice-Ansatzes auf verschiedene Delikte. Kapitel 4 widmet sich der kritischen Stellungnahme zum theoretischen Modell, wobei insbesondere die Grenzen des Ansatzes und die Bedeutung weiterer Erklärungsfaktoren beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Rational-Choice-Ansatz, Kriminalität, Delinquenz, Nutzen-Kosten-Kalkulation, Empirie, Jugendkriminalität, Schichtzugehörigkeit, Steuerbetrug, Ladendiebstahl, Straßenraub, Trittbrettfahren, Schwarzfahren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Rational-Choice-Ansatz in der Kriminologie?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass kriminelle Handlungen das Ergebnis einer rationalen Abwägung von Kosten und Nutzen durch den Täter sind.
Wer entwickelte das Grundmodell des rational handelnden Verbrechers?
Gary S. Becker legte mit seinem Werk „Crime and Punishment: An economic approach“ (1968) das Fundament für diese Theorie.
Wie erklärt das Modell Delikte wie Schwarzfahren oder Ladendiebstahl?
Der Täter wägt den Nutzen (z.B. kostenlose Fahrt) gegen das Risiko und die Kosten einer Entdeckung (z.B. Bußgeld) ab. Ist der erwartete Nutzen höher, wird die Tat begangen.
Welchen Einfluss hat die Schichtzugehörigkeit auf den Delikttyp?
Die Arbeit untersucht, wie unterschiedliche soziale Schichten verschiedene Kosten-Nutzen-Kalkulationen anstellen, was zu unterschiedlichen kriminellen Schwerpunkten (z.B. Steuerbetrug vs. Straßenraub) führt.
Gibt es Kritik am Rational-Choice-Ansatz?
Ja, Kritiker bemängeln, dass emotionale Faktoren, Affekttaten oder mangelnde Informationen oft nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Was bedeutet „Pleasure and Pain“ nach Bentham?
Jeremy Bentham erkannte bereits früh, dass menschliches Handeln durch das Streben nach Lust und die Vermeidung von Schmerz gesteuert wird, was die Basis für ökonomische Verhaltenstheorien bildet.
- Quote paper
- Carolin Waasen (Author), 2006, Rechtswidriges Verhalten aus Sicht des Rational-Choice-Ansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70059