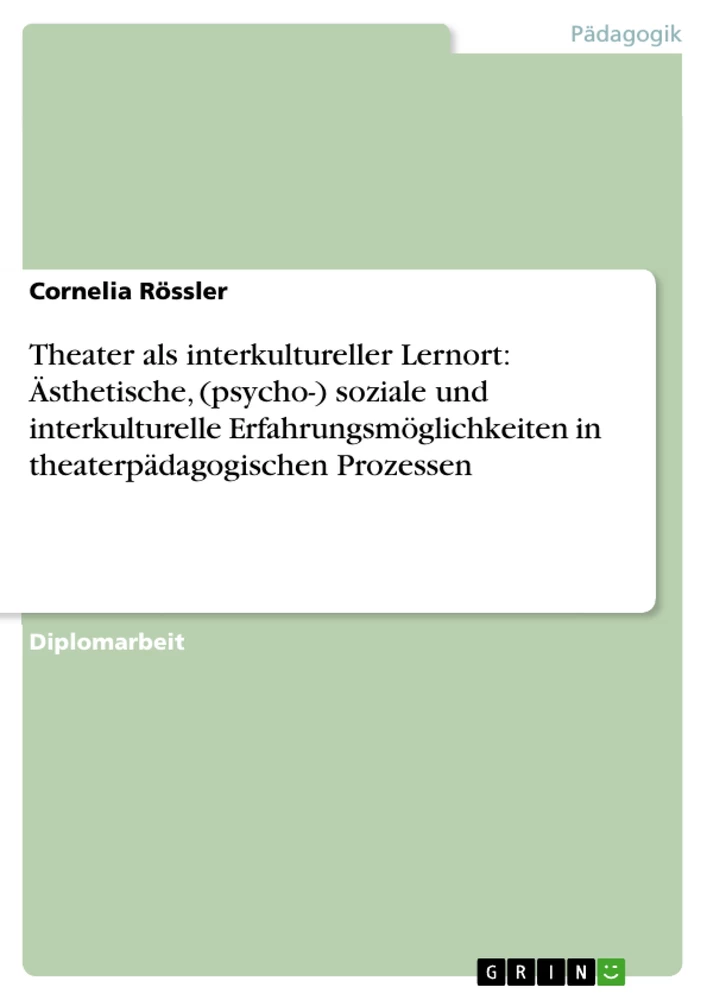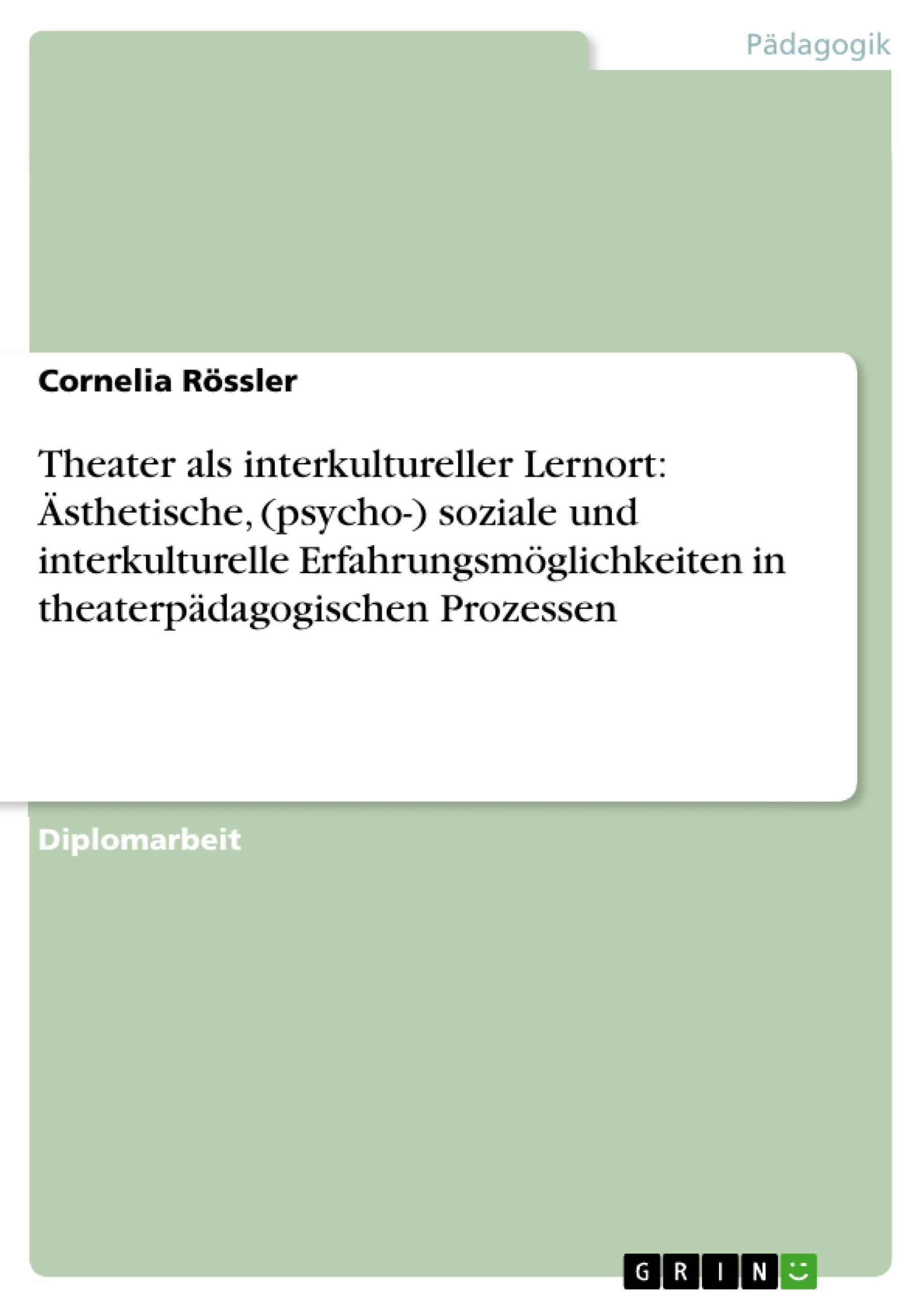In einer pluralen Gesellschaft, die durch das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Norm- und Wert-vorstellungen geprägt ist, 1 stellt sich die Frage: Wie ist dieses Zusammenleben zu optimieren, d.h. wie können Wege der Verständigung und des Vorurteilsabbaus gefunden werden, um ein friedliches Miteinander zu garantieren? Mit diesen Aufgaben befaßt sich die Pädagogik intensiv seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts, angefangen bei der „Ausländerpädagogik“ bis hin zu aktuellen Konzepten interkultureller Erziehung. Letztere lassen sich zwei Grundrichtungen zuordnen: der Konfliktpädagogik und der Begegnungspädagogik. In der Ausei-nandersetzung mit diesen beiden Positionen stößt man schnell auf die immer wieder aktuelle Relativismus-Universalismus-Debatte, in der Kulturen entweder als einzigartig und somit unvergleichbar angesehen werden, oder allen Kulturen universalistische Gemeinsamkeiten unterstellt werden, die es hervorzubringen gilt. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ich werde in Anlehnung an Wimmer (1997) und Schaller (1978) bzw. Ostertag (2001) einen Vorschlag wagen und auf die Wichtigkeit interkultureller Kommunikation bzw. des interkulturellen Dialogs aufmerksam machen. Da ich mich berufsbedingt seit längerem mit theaterpädagogischen Methoden und Projekten befasse, möchte ich in der vorliegenden Arbeit untersuchen, ob das Theater als Kommunikations- und Erfahrungsmedium einen Beitrag zum interkulturellen Lernen bzw. zum interkulturellen Dialog zu leisten vermag und wo seine Grenzen diesbezüglich liegen. Mit „Dialog“ ist in diesem Zusammenhang nicht allein der verbale Austausch von Zeichen zwischen zwei Kommunikationspartnern gemeint, sondern auch - bzw. besonders - der Austausch über (gemeinsame) emotionale, sinnliche und ästhetische Erfahrungen auf einer nonverbalen Ebene. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Kultur
- 2.2 Kulturelle Identität
- 2.3 Multikulturelle Gesellschaft
- 3. Interkulturelles Lernen
- 3.1 Interkulturelles Lernen als Teil sozialen Lernens
- 3.2 Die Entstehung der Konzeptionen
- 3.3 Zwei Grundrichtungen: Begegnungspädagogik und Konfliktpädagogik
- 3.3.1 Universalismus vs. Relativismus
- 3.3.2 Zur Annäherung an eine Lösung der Universalismus-Relativismus-Debatte
- 3.4 Die Ziele interkulturellen Lernens
- 3.4.1 Entdecken des Fremden im Eigenen und des Eigenen im Fremden
- 3.4.1.1 Das Fremde
- 3.4.1.2 Selbstbild und Fremdbild
- 3.4.1.3 Umgang mit dem Fremden
- 3.4.2 Aufgeklärter Ethnozentrismus
- 3.4.3 Erkennen von Vorurteilen und Stereotypen
- 3.4.3.1 Was sind Vorurteile?
- 3.4.3.2 Erklärungsansätze für die Entstehung von Vorurteilen
- 3.4.4 (Interkulturelle) Kommunikationsfähigkeit
- 3.4.4.1 Kommunikation als soziale Situation
- 3.4.4.2 Nonverbale Kommunikation
- 3.4.4.3 Verständnisprobleme
- 3.4.4.4 Metakommunikation
- 3.4.5 Konfliktfähigkeit
- 3.4.1 Entdecken des Fremden im Eigenen und des Eigenen im Fremden
- 3.5 Die Grenzen interkulturellen Lernens
- 4. Theater als interkultureller Lernort
- 4.1 Theater
- 4.1.1 Spiel und Realität
- 4.1.2 Der Symbolcharakter des Theaters
- 4.2 Theaterpädagogik im Spannungsfeld von Pädagogik und Kunst
- 4.2.1 Theater und Pädagogik: Eine positive Dialektik?
- 4.2.2 Theaterpädagogik als Teil der Kulturarbeit
- 4.3 Erfahrungsmöglichkeiten in der (interkulturellen) Theaterarbeit
- 4.3.1 Theater als ästhetisches Erfahrungsfeld
- 4.3.1.1 Zur Bestimmung einer „ästhetischen Bildung“
- 4.3.1.2 Theaterspiel als ästhetische Praxis
- 4.3.2 Theater als (psycho-)soziales Erfahrungsfeld
- 4.3.2.1 Erfahrung des Subjekts mit sich selbst
- 4.3.2.2 Erfahrungen des Subjekts mit der Gruppe
- 4.3.2.3 Erfahrungen des Subjekts mit seiner Lebenswelt
- 4.3.3 Zusammenspiel der Dimensionen
- 4.3.1 Theater als ästhetisches Erfahrungsfeld
- 4.4 Zusammenfassend: Ästhetische Erfahrungen, (psycho-)soziale Erfahrungen und interkulturelle Lernprozesse durch Theaterarbeit
- 4.1 Theater
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag des Theaters zum interkulturellen Lernen in Projekten mit LaienschauspielerInnen aus verschiedenen Kulturkreisen. Es wird analysiert, wie ästhetische und (psycho-)soziale Erfahrungen im theaterpädagogischen Prozess Lernprozesse im Sinne interkultureller Erziehung ermöglichen können.
- Interkulturelles Lernen und seine Konzeptionen
- Theater als Kommunikations- und Erfahrungsmedium
- Ästhetische Erfahrungsmöglichkeiten im Theaterspiel
- (Psycho-)soziale Erfahrungsprozesse in der Theaterarbeit
- Vergleich der Ziele interkulturellen Lernens mit den Möglichkeiten der Theaterarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des interkulturellen Lernens in einer pluralen Gesellschaft ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Beitrag des Theaters zum interkulturellen Dialog. Die Arbeit fokussiert auf die pädagogische Arbeit mit LaienschauspielerInnen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und untersucht, ob das gemeinsame Entwickeln und Spielen eines Theaterstücks interkulturelle Lernprozesse fördert. Die zentrale These lautet, dass in interkulturellen Theaterprojekten ästhetische Beschäftigung mit theatralem Material (psycho-)soziale Erfahrungen in Gang setzt, die interkulturelle Lernprozesse ermöglichen. Der methodische Ansatz beinhaltet den Vergleich der Ziele interkulturellen Lernens mit den Erfahrungsmöglichkeiten im theaterpädagogischen Prozess.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie Kultur, kulturelle Identität und multikulturelle Gesellschaft. Es legt die Grundlage für das Verständnis des interkulturellen Lernprozesses, indem es verschiedene Perspektiven auf Kultur und die Herausforderungen des Zusammenlebens in einer multikulturellen Gesellschaft beleuchtet. Die Definitionen bilden den Rahmen für die spätere Analyse der interkulturellen Aspekte im Kontext der Theaterarbeit.
3. Interkulturelles Lernen: Das Kapitel erörtert das Konzept des interkulturellen Lernens, seine Entstehung und die verschiedenen pädagogischen Ansätze (Begegnungspädagogik und Konfliktpädagogik). Es analysiert die Universalismus-Relativismus-Debatte und beschreibt die Ziele interkulturellen Lernens, wie das Entdecken des Fremden im Eigenen und des Eigenen im Fremden, den Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen sowie die Entwicklung interkultureller Kommunikationsfähigkeit. Die Grenzen des interkulturellen Lernens werden ebenfalls beleuchtet. Diese umfassende Darstellung der Theorie des interkulturellen Lernens dient als Referenzrahmen für die spätere Analyse der Theaterarbeit.
4. Theater als interkultureller Lernort: Dieses Kapitel behandelt Theater als interkulturellen Lernort. Es untersucht den Zusammenhang von Spiel und Realität, den Symbolcharakter des Theaters und die Rolle der Theaterpädagogik. Es wird eingehend auf die verschiedenen Erfahrungsmöglichkeiten in der interkulturellen Theaterarbeit eingegangen, wobei die ästhetische und die (psycho-)soziale Ebene unterschieden werden. Der Fokus liegt auf den Erfahrungen des Subjekts mit sich selbst, der Gruppe und seiner Lebenswelt, um zu zeigen, wie Theater Lernprozesse anregen und interkulturellen Dialog fördern kann. Die verschiedenen Ebenen der Erfahrung (ästhetisch, (psycho-)sozial) werden im Kontext des interkulturellen Lernens analysiert und in ihrem Zusammenspiel betrachtet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interkulturelles Lernen im Theater
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie Theater zum interkulturellen Lernen in Projekten mit Laienschauspielern aus verschiedenen Kulturkreisen beiträgt. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie ästhetische und (psycho-)soziale Erfahrungen im theaterpädagogischen Prozess interkulturelle Lernprozesse ermöglichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Interkulturelles Lernen und seine Konzeptionen, Theater als Kommunikations- und Erfahrungsmedium, ästhetische Erfahrungsmöglichkeiten im Theaterspiel, (psycho-)soziale Erfahrungsprozesse in der Theaterarbeit und einen Vergleich der Ziele interkulturellen Lernens mit den Möglichkeiten der Theaterarbeit.
Welche Begriffe werden im Text geklärt?
Zentrale Begriffe wie Kultur, kulturelle Identität und multikulturelle Gesellschaft werden definiert und bilden die Grundlage für das Verständnis des interkulturellen Lernprozesses.
Was ist das Konzept des interkulturellen Lernens nach dieser Arbeit?
Der Text erörtert das Konzept des interkulturellen Lernens, seine Entstehung und verschiedene pädagogische Ansätze (Begegnungspädagogik und Konfliktpädagogik). Er analysiert die Universalismus-Relativismus-Debatte und beschreibt Ziele wie das Entdecken des Fremden im Eigenen, den Umgang mit Vorurteilen und die Entwicklung interkultureller Kommunikationsfähigkeit. Die Grenzen des interkulturellen Lernens werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird Theater als interkultureller Lernort betrachtet?
Der Text untersucht Theater als interkulturellen Lernort, den Zusammenhang von Spiel und Realität, den Symbolcharakter des Theaters und die Rolle der Theaterpädagogik. Es werden die ästhetischen und (psycho-)sozialen Erfahrungsmöglichkeiten in der interkulturellen Theaterarbeit analysiert, mit Fokus auf die Erfahrungen des Subjekts mit sich selbst, der Gruppe und seiner Lebenswelt.
Welche Arten von Erfahrungen werden im Kontext der Theaterarbeit betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen ästhetischen und (psycho-)sozialen Erfahrungen im Theaterspiel. Die ästhetische Ebene bezieht sich auf die Beschäftigung mit theatralem Material, während die (psycho-)soziale Ebene die Erfahrungen des Subjekts mit sich selbst, der Gruppe und seiner Lebenswelt umfasst.
Wie werden die Ziele des interkulturellen Lernens mit den Möglichkeiten der Theaterarbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ziele des interkulturellen Lernens mit den Erfahrungsmöglichkeiten im theaterpädagogischen Prozess, um aufzuzeigen, wie Theater Lernprozesse anregen und interkulturellen Dialog fördern kann.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Der methodische Ansatz beinhaltet den Vergleich der Ziele interkulturellen Lernens mit den Erfahrungsmöglichkeiten im theaterpädagogischen Prozess.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These lautet, dass in interkulturellen Theaterprojekten ästhetische Beschäftigung mit theatralem Material (psycho-)soziale Erfahrungen in Gang setzt, die interkulturelle Lernprozesse ermöglichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsklärung, Interkulturellem Lernen und Theater als interkultureller Lernort, jedes mit detaillierten Unterkapiteln.
- Citation du texte
- Dipl.-Päd. Cornelia Rössler (Auteur), 2005, Theater als interkultureller Lernort: Ästhetische, (psycho-) soziale und interkulturelle Erfahrungsmöglichkeiten in theaterpädagogischen Prozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70155