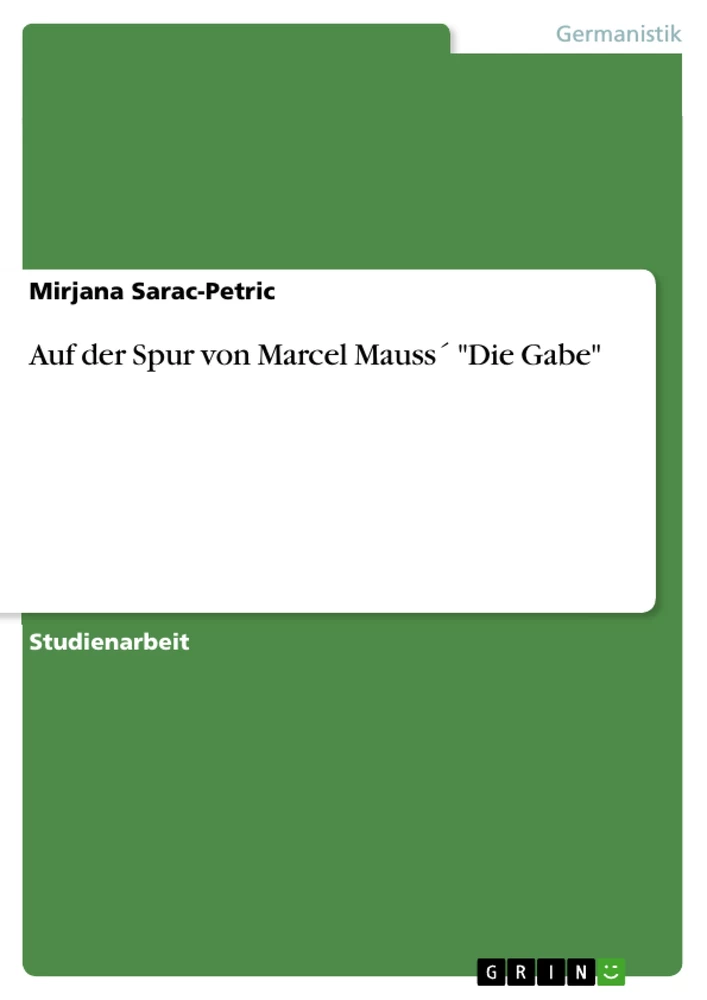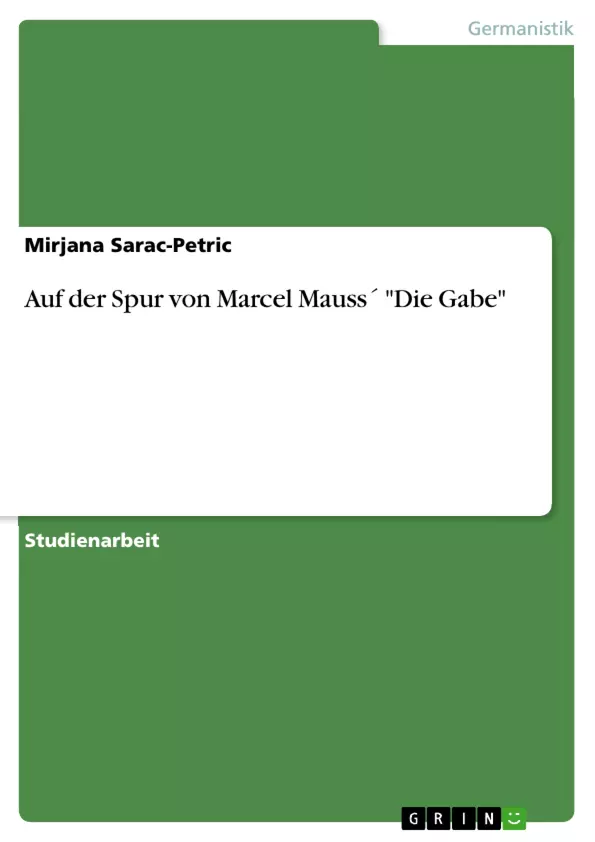In § 516 I heißt es „Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt“ 1 . Das Schenken, das der Gesetzgeber so nüchtern definiert, gehört zu den angenehmsten Seiten unseres Lebens, denn jeder von uns freut sich, wenn er ein Geschenk bekommt. Ebenso suchen wir in der Regel mit großer Sorgfalt nach etwas Passendem, wenn wir jemandem, der uns lieb und teuer ist, ein Geschenk machen wollen 2 . Zudem gibt es in unserer Gesellschaft unzählige Gelegenheiten, zu denen geschenkt wird - man denke nur einmal an Weihnachten, Geburtstag, Valentinstag oder Muttertag, um nur einige von ihnen zu nennen. Der moderne Geschenkaustausch, wie er in unserer Zeit praktiziert wird, weist nach Meinung von Gerhard Schmied „die zunehmend schärfere Trennung der öffentlichen und der privaten Sphäre“ 3 auf. Während in der öffentlichen Sphäre der Austausch von Gütern durch Kauf erfolgt, bedient man sich in der privaten Sphäre der Geschenke. Mit ihrer Hilfe sollen Bindungen in der Familie und im Freundeskreis freiwillig betont und verstärkt werden. Und doch, in dem eben Gesagten offenbart sich ein Widerspruch, der gerade in dieser Weise in unserer Gesellschaft akzeptiert wird. Während das Gesetz die Schenkung als einseitigen Akt betont, bei dem der Gebende dem Nehmenden freiwillig und kostenlos etwas zukommen lässt, wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung, dass wir dieses Geschenk nicht annehmen können, ohne uns verpflichtet zu fühlen, das Geschenk zu erwidern. Es zeigt sich in diesem Kontext, dass die Freiwilligkeit des Schenken, obwohl das Gegengeschenk juristisch nicht eingefordert werden kann, sehr relativ ist. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass es oft nur das erste Geschenk ist, das freiwillig gegeben wird; man selbst bestimmt frei, ohne Zwang, den Anlass, den Zeitpunkt und das Ambiente der Geschenkübergabe. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- System der "totalen Leistungen" versus Potlach
- Etzels Werbung um Krimhild u. Giselhers Werbung um Rüdigers Tochter
- Siegfrieds Werbung um Krimhild
- Gunthers Werbung um Brünhild
- Hoffeste
- Das "hau" einer Sache
- Balmung, Siegfrieds Schwert
- Rüdigers Geschenke
- Das Hochzeitsfest am Wormser Hof
- Pflicht zu geben und zu nehmen
- Hoffeste
- Botenempfang
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht anhand ausgewählter Textpassagen des Nibelungenlieds die Anwendbarkeit der von Marcel Mauss in seinem Werk „Die Gabe" entwickelten Theorien zum Geschenkaustausch in archaischen Gesellschaften auf die Welt der Nibelungen. Dabei werden die spezifischen Gegebenheiten des mittelalterlichen Werkes berücksichtigt und die Frage untersucht, inwieweit die im Nibelungenlied dargestellten Schenkrituale mit Mauss' Konzepten des "Systems der totalen Leistungen" und des Potlach übereinstimmen.
- Das Prinzip der Gegenseitigkeit von Geben und Nehmen im Nibelungenlied
- Vergleich der Geschenkrituale im Nibelungenlied mit Mauss' Beobachtungen
- Analyse der Brautwerbungen im Nibelungenlied im Kontext des Systems der "totalen Leistungen"
- Die Rolle von Hoffesten und Gastlichkeit als Mittel der politischen und sozialen Verbindung
- Die Bedeutung von Geschenken als Ausdruck von Macht, Status und Loyalität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung des Schenkens in der modernen Gesellschaft und die damit verbundenen Ambivalenzen. Zudem wird die Relevanz von Marcel Mauss' Werk "Die Gabe" für die Analyse des Geschenkaustauschs im Nibelungenlied erläutert. Kapitel 2 beleuchtet das System der "totalen Leistungen" und den Potlach als zwei wesentliche Formen des Geschenkaustauschs in archaischen Gesellschaften. Anhand der Brautwerbungen im Nibelungenlied wird untersucht, ob und inwieweit diese beiden Konzepte auf die Welt der Nibelungen übertragen werden können. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem "hau" einer Sache, also mit dem spezifischen Wert von Gegenständen, die als Geschenke ausgetauscht werden. Anhand des Schwertes Balmung und Rüdigers Geschenken werden die Bedeutung von Geschenken als Ausdruck von Macht und Status sowie die damit verbundenen Verpflichtungen verdeutlicht. Kapitel 4 beleuchtet die Rolle von Hoffesten und dem Botenempfang als rituelle Formen des Geschenkaustauschs und deren Bedeutung für die Stabilität des höfischen Gefüges.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Marcel Mauss, Die Gabe, System der totalen Leistungen, Potlach, Schenkung, Gegenseitigkeit, Brautwerbung, Hoffeste, Gastlichkeit, Macht, Status, Loyalität, Balmung, Rüdiger, Gunther, Krimhild, Siegfried.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Marcel Mauss' Werk „Die Gabe“?
Mauss beschreibt Schenken als ein System von „totalen Leistungen“, bei dem die Pflichten zu Geben, Nehmen und Erwidern soziale Bindungen und Machtverhältnisse in archaischen Gesellschaften festigen.
Wie wird Mauss' Theorie auf das Nibelungenlied angewendet?
Die Arbeit analysiert Schenkrituale wie Brautwerbungen und Hoffeste im Nibelungenlied und zeigt, dass Geschenke dort keine freiwilligen Gaben, sondern Akte politischer Loyalität und sozialer Verpflichtung sind.
Was bedeutet das „hau“ einer Sache?
Der Begriff „hau“ stammt aus der Maori-Kultur und bezeichnet die „Seele“ oder Kraft eines Geschenks, die den Empfänger dazu drängt, die Gabe zu erwidern, um das soziale Gleichgewicht zu wahren.
Warum sind Hoffeste im Nibelungenlied so wichtig?
Hoffeste dienen als Bühne für den Austausch von Gaben (Potlach-Elemente), durch die Herrscher ihre Macht demonstrieren und die Treue ihrer Gefolgsleute sichern.
Ist Schenken laut Mauss wirklich freiwillig?
Nein, Mauss argumentiert, dass Schenken zwar formal freiwillig erscheint, in Wirklichkeit aber unter einem starken sozialen Zwang zur Erwiderung steht.
- Citar trabajo
- M.A. Mirjana Sarac-Petric (Autor), 2001, Auf der Spur von Marcel Mauss´ "Die Gabe", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70249