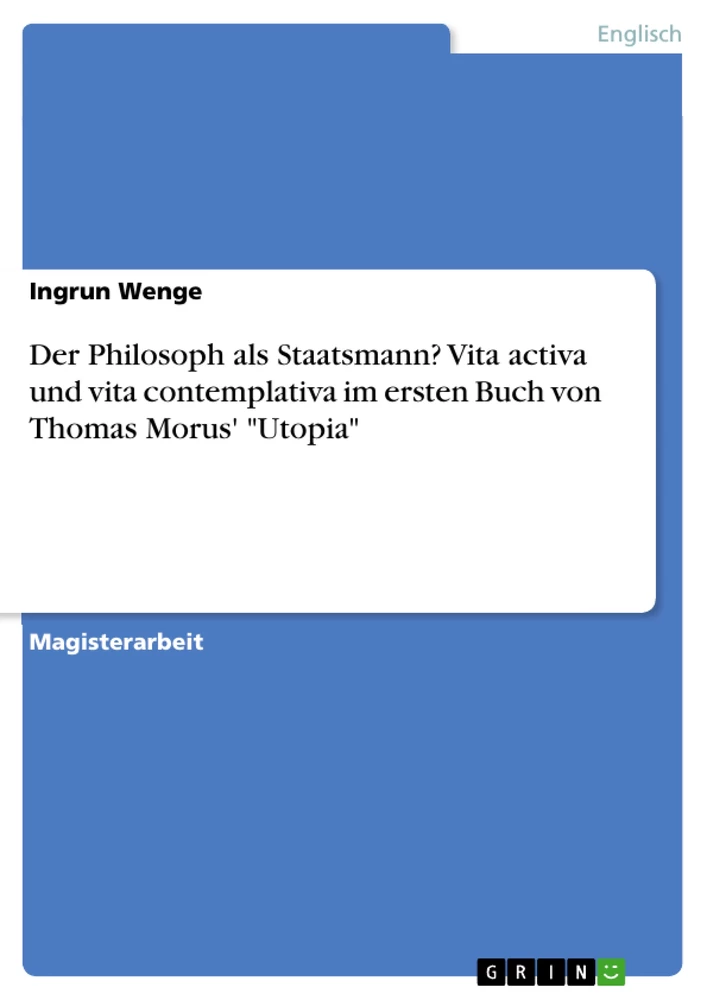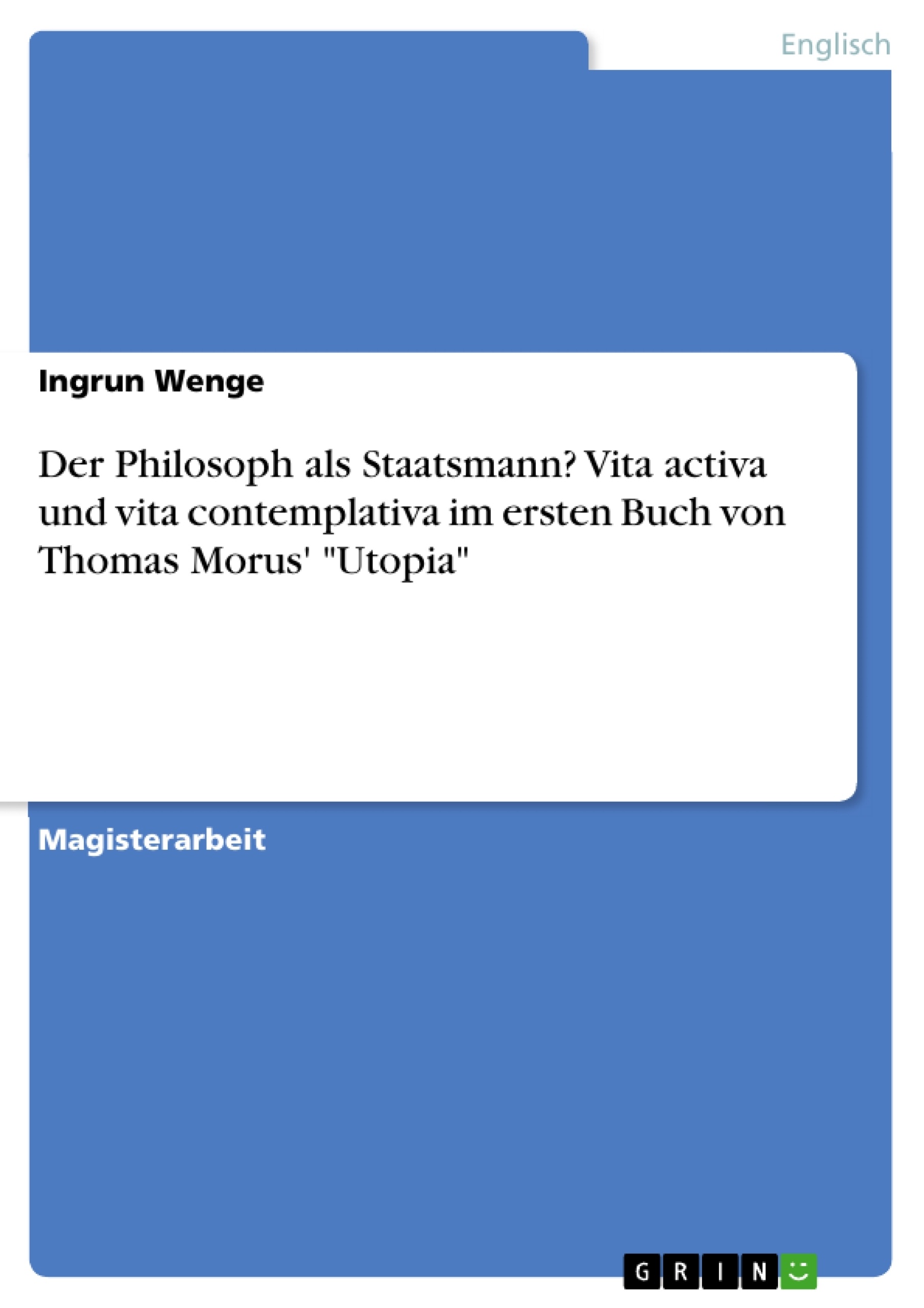Das Thema der vorliegenden Arbeit hat eine geistesgeschichtliche Tradition, die sich auf zweieinhalb Jahrtausende beläuft. Das Begriffspaar, verstanden als qualitative Unterscheidung zwischen einander ausschließenden und sich doch komplementär ergänzenden Lebensentwürfen, beinhaltet weitere begriffliche Dualismen, so etwa die Gegenüberstellung von Einsamkeit und Gesellschaft, von Arbeit und Muße, von Denken und Handeln und von Theorie und Praxis.
Ein Standardthema der humanistischen Literatur des 16. Jahrhunderts bildet die Fragestellung, ob die neue Bildungselite der Humanisten ihre Gelehrsamkeit in den Dienst eines Fürsten stellen sollte. Diese Frage behandelt auch der englische Humanist Thomas Morus mit seinem "Dialogue of Counsel" im ersten Buch seiner Utopia (1516). Von besonderem Interesse ist sein Beitrag deshalb, weil es ihm gelingt, das Problem vita activa/vita contemplativa differenziert und in seiner ganzen Bandbreite zu diskutieren, ohne je in eine gemeinplätzliche Behandlung des Themas zu verfallen. Den Konflikt zwischen politischer Aktion und gelehrter Kontemplation dramatisiert Morus dabei anhand der Morus-Persona und der Figur Raphael Hythlodaeus.
Ausgehend von der Hypothese, dass Morus im ersten Buch der Utopia den zeitlosen Widerstreit zwischen vita activa und vita contemplativa problematisiert, ergibt sich die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Zu welchem Schluss gelangt Morus mit seinem Dialogue of Counsel hinsichtlich der Frage, ob und warum Philosophen in den Staatsdienst treten bzw. aus welchen Gründen sie dies unterlassen sollten? Von besonderem Interesse ist hierbei auch, welches Bild vom Philosophen im ersten Buch der Utopia vermittelt wird. Dabei wird die These vertreten, dass Morus angesichts der Unvereinbarkeit von Philosophie und Realpolitik die Dialogpartner bewusst keine Einigung erlangen lässt und im Dialogue of Counsel keine endgültige Stellung bezieht, sondern vielmehr ein moralisches Dilemma konstatiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thomas Morus und der englische Humanismus
- Zum Begriff des Humanismus: Schwierigkeiten einer Definition
- Der englische Humanismus im europäischen Kontext
- Thomas Morus: „The king's good servant, but God's first”
- Zur Geistesgeschichte von vita activa und vita contemplativa
- Platon: Die Untrennbarkeit von Theorie und Praxis
- Aristoteles: Das Primat der Kontemplation
- Cicero: Philosophie als Bildungsgut
- Augustinus: Handeln als Notwendigkeit
- Vita activa und vita contemplativa im ersten Buch von Thomas Morus' Utopia
- Die Utopie der Neuzeit: Kritik und Gegenbild
- Die Figuren Thomas Morus und Petrus Aegidius
- Die Figur Raphael Hythlodaeus
- Der Dialogue of Counsel als Problematisierung des Konflikts zwischen vita activa und vita contemplativa
- Im Dienste des Königs: These und Antithese
- Die Morton-Episode: Ein zweifelhaftes Exemplum
- Der Philosoph als Staatsmann: Platon versus Platon
- Die rhetorische Strategie der Dialogpartner
- Die Fremdheit des Philosophen in der Welt
- Die Unvereinbarkeit von vita activa und vita contemplativa
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Thomas Morus' Auseinandersetzung mit dem Gegensatz von vita activa und vita contemplativa im ersten Buch seiner Utopia (1516). Ziel ist es, Morus' Schlussfolgerung bezüglich des Eintritts von Philosophen in den Staatsdienst zu analysieren und seine Bewertung der beiden Lebensformen zu beleuchten. Dabei wird das im Werk vermittelte Bild des Philosophen im Kontext der europäischen Geistesgeschichte untersucht.
- Der Konflikt zwischen vita activa und vita contemplativa in der Renaissance
- Die Rolle des englischen Humanismus in der Debatte um Theorie und Praxis
- Die Darstellung des Philosophen in Morus' Utopia
- Die Argumentationsstrategie im "Dialogue of Counsel"
- Morus' Positionierung zum Verhältnis von Philosophie und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die geistesgeschichtliche Tradition des Gegensatzes von vita activa und vita contemplativa und untersucht dessen Relevanz in Thomas Morus' Utopia. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach Morus' Schlussfolgerung bezüglich des Eintritts von Philosophen in den Staatsdienst und seiner Bewertung der beiden Lebensformen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Forschungsansatz.
Thomas Morus und der englische Humanismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Humanismus und beschreibt den englischen Humanismus im europäischen Kontext. Es analysiert die Lebensgeschichte und die philosophischen Positionen von Thomas Morus, insbesondere sein Verhältnis zur Krone und seinen Glauben. Der Fokus liegt auf der Positionierung Morus' innerhalb des humanistischen Diskurses und seiner Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen individueller Lebensführung und öffentlichem Dienst.
Zur Geistesgeschichte von vita activa und vita contemplativa: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung des Konfliktes zwischen vita activa und vita contemplativa von der Antike bis zur Renaissance. Es beleuchtet die Positionen von Platon, Aristoteles, Cicero und Augustinus und zeigt die unterschiedlichen Wertungen von Theorie und Praxis auf. Dieses Kapitel bildet die historische Grundlage für das Verständnis von Morus' Auseinandersetzung mit diesem Thema im Kontext seiner Zeit.
Vita activa und vita contemplativa im ersten Buch von Thomas Morus' Utopia: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Konflikts zwischen vita activa und vita contemplativa im ersten Buch von Morus' Utopia. Es untersucht die Figuren Morus, Petrus Aegidius und Raphael Hythlodaeus und deren unterschiedliche Positionen. Der "Dialogue of Counsel" wird als zentrale Textstelle betrachtet, in der der Konflikt zwischen Theorie und Praxis ausgetragen wird. Die Analyse fokussiert auf die rhetorischen Strategien der Dialogpartner und die letztlich nicht erreichte Einigung.
Schlüsselwörter
Thomas Morus, Utopia, vita activa, vita contemplativa, Humanismus, englischer Humanismus, Philosoph, Staatsmann, Politik, Theorie, Praxis, Dialogue of Counsel, Renaissance, Ideengeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu: Thomas Morus' Utopia und der Konflikt zwischen Vita Activa und Vita Contemplativa
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Thomas Morus' Auseinandersetzung mit dem Gegensatz zwischen aktivem (vita activa) und kontemplativem Leben (vita contemplativa) im ersten Buch seiner Utopia (1516). Der Fokus liegt auf Morus' Schlussfolgerung zum Thema des Eintritts von Philosophen in den Staatsdienst und seiner Bewertung beider Lebensformen im Kontext der europäischen Geistesgeschichte.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Morus' Schlussfolgerung bezüglich des Eintritts von Philosophen in den Staatsdienst und beleuchtet seine Bewertung der vita activa und vita contemplativa. Sie analysiert das in Utopia vermittelte Bild des Philosophen im Kontext der europäischen Geistesgeschichte und untersucht den Konflikt zwischen Theorie und Praxis in der Renaissance.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Konflikt zwischen vita activa und vita contemplativa in der Renaissance, die Rolle des englischen Humanismus in der Debatte um Theorie und Praxis, die Darstellung des Philosophen in Morus' Utopia, die Argumentationsstrategie im "Dialogue of Counsel" und Morus' Positionierung zum Verhältnis von Philosophie und Politik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Thomas Morus und dem englischen Humanismus, ein Kapitel zur Geistesgeschichte von vita activa und vita contemplativa, ein Kapitel zur Analyse dieser Thematik in Utopias erstem Buch (mit Fokus auf dem "Dialogue of Counsel") und abschließende Schlussfolgerungen.
Wie wird der "Dialogue of Counsel" in der Arbeit behandelt?
Der "Dialogue of Counsel" wird als zentrale Textstelle analysiert, in der der Konflikt zwischen Theorie und Praxis im Werk ausgetragen wird. Die Analyse konzentriert sich auf die rhetorischen Strategien der Dialogpartner und das letztlich ausbleibende Übereinkommen.
Welche historischen Figuren werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Positionen von Platon, Aristoteles, Cicero und Augustinus zur vita activa und vita contemplativa, um den historischen Kontext von Morus' Auseinandersetzung mit dem Thema zu beleuchten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Thomas Morus, Utopia, vita activa, vita contemplativa, Humanismus, englischer Humanismus, Philosoph, Staatsmann, Politik, Theorie, Praxis, Dialogue of Counsel, Renaissance und Ideengeschichte.
Wie ist der Humanismus in der Arbeit eingebunden?
Die Arbeit definiert den Begriff des Humanismus und beschreibt den englischen Humanismus im europäischen Kontext. Sie analysiert Morus' Positionierung innerhalb des humanistischen Diskurses und seine Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen individueller Lebensführung und öffentlichem Dienst.
Welche Figuren in Utopie werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Figuren Thomas Morus, Petrus Aegidius und Raphael Hythlodaeus und deren unterschiedliche Positionen zum Verhältnis von vita activa und vita contemplativa.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen bezüglich Morus' Bewertung der vita activa und vita contemplativa und seiner Position zum Einbringen von Philosophen in den Staatsdienst. Die genauen Schlussfolgerungen werden im letzten Kapitel der Arbeit dargelegt.
- Citation du texte
- Ingrun Wenge (Auteur), 2005, Der Philosoph als Staatsmann? Vita activa und vita contemplativa im ersten Buch von Thomas Morus' "Utopia", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70271