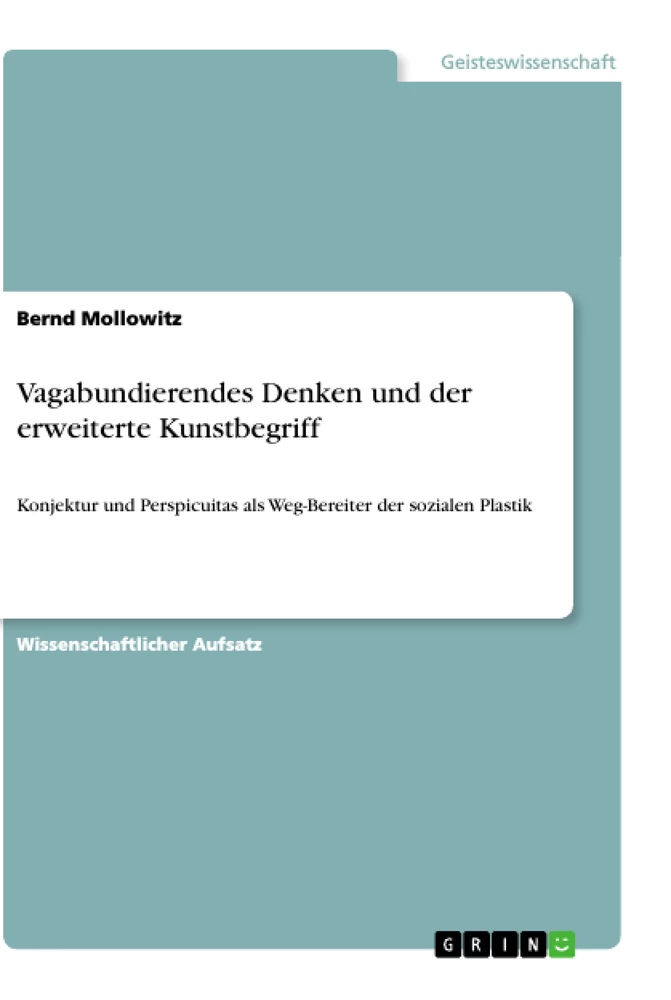Das vagabundierende Denken ist zielgerichtet offen, betont perspektivistisch und herrschaftsfrei. Es wird in Beziehung gesetzt zum erweiterten Kunstbegriff von Beuys unter der leitenden Frage, wie wir - unter Berücksichtigung unserer unübersteigbaren "docta ignorantia" - uns der Aufgabe stellen können, mit Überzeugung ein gesellschaftliches Gesamtkunstwerk (soziale Plastik) zu errichten. Unverzichtbar ist, dass wir der vertu Rousseaus folgen, unsere individuellen Anschauungen offen ins Gespräch einbringen und ebenso offen auf die Ansichten unserer Gesprächspartner eingehen. Als Hilfsmittel auf diesem Weg finden die Konjektur und die Perspicuitas Anwendung.
Für Beuys gilt die Reihung "Freiheit - Selbstbestimmung - Kreativität - Kunst - Mensch"; sein erweiterter Kunstbegriff ist daher nicht bloße Theorie, sondern Lebensvollzug, auf den wir uns permanent vorbereiten müssen, bei jeder Handlung, die wir alltäglich vollziehen. Die Konsequenz ist eine entsprechend permanente Veränderung unserer selbst, eine plastische Durchbildung ("Denken = Plastik"). Zu dieser Einsicht mit allen ihren Konsequenzen muss, wenn nötig, erzogen werden: "Der Mensch muß richtig gebildet, d.h. durchgeknetet werden." Auf dem Weg zur sozialen Plastik gilt, um die lebendige Bewegung aufrechtzuerhalten und zu fördern: "Alles, was Menschen also herausstellen (...), muß wie eine Frage in der Welt stehen, die nach Ergänzung und nach Verbesserung und nach Erhöhung strebt". Dazu bedarf es des Bemühens um Selbsterkenntnis einerseits und einer "permanenten Konferenz" (Wilfried Heidt) mit dem Anderen andererseits.
INHALT
1. Erkenntnistheorie - ein unwegsames Gelände
2. Wahr-Nehmung als wechselseitige Interpretation in einem herrschaftsfreien Diskurs
3. Der eigene Weg der Kunst
4. Die Ästhetik des erweiterten Kunstbegriffs
5. Unterwegs zur sozialen Plastik
6. Die Spur des Weges : einsam oder gemeinsam?
7. Rousseau und das Glück der „rêveries du Promeneur Solitaire“
8. Selbst-Liebe und Selbst-Sucht
9. Der Citoyen als être rélatif
10. „Das offene Tor am anderen Ende“. Konjektur und Perspicuitas
Vagabundierendes Denken und der erweiterte Kunstbegriff.
(Konjektur und Perspicuitas als Weg-Bereiter der sozialen Plastik)
Autor : Bernd Mollowitz
www.philosophersonly.de
Kein Philosoph und kein Heiliger ist jemals seinen Weg bis zu Ende gegangen. An irgend- einem Punkte seiner Wanderung, ob er nun müde oder mutlos geworden, ruht er aus, baut mert, geht jenseits des Altars weiter und verschwindet in dem Dämmern der Unendlichkeit.
(Arthur Schnitzler; aus : "Ohne Maske. Aphorismen und Notate“. Frankfurt/Main 1967, 43)
I. Erkenntnistheorie – ein unwegsames Gelände
Grundlage allen Philosophierens ist Erkenntnistheorie. Bevor sie nicht ihre Arbeit verrichtet hat, ist alles weitere Reflektieren müßig. Der "Freund der Weisheit" sieht sich also mit der ersten der vier Fragen Kants konfrontiert : "Was kann ich wissen ?"1 Nun ist "wissen" ein schillernder Begriff, der inhaltlich über die Jahrtausende vielfältigen Gebrauch erfahren hat. Ähnlich steht es um den Begriff der "Wahrheit", jenen korrespondierenden Begriff also, der schlechthin Maß und Ziel des philosophischen Bestrebens bedeutet. "Wahrheit" beansprucht das hinsichtlich seiner Richtigkeit gesicherte Erfassen dessen, was an sich = von sich her (ohne unser Zutun) ist.
Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass dieses Ziel eine uneinholbare Idee ist, um die sich zu bemühen (studere) der Philosophierende unterwegs ist. "Unterwegs-Sein" meint ein "vagabundierendes" Vor-Gehen auf diesem Weg (der sich als ein der Potenz nach vielgestaltiger herausstellen wird). Gr. "méthodos" meint diesen Weg, und so ist die Methode der vorliegenden Arbeit als "vagabundierendes Denken" zu bezeichnen. Ich habe mich an mehreren Stellen bemüht, die Reichweite dieser Methode auszuarbeiten und verweise auf die entsprechenden Texte2. Hier werde ich nur die für unser Vorhaben notwendigen Überlegungen einbringen.
Wenn es richtig ist, dass die Vorstellung von Wahrheit nur eine uneinholbare Idee ist, stehen wir alle, wenn wir uns um Erkenntnis bemühen, vor der gleichen Aufgabe : zum einen einzuse- hen, dass keiner von uns die Wahrheit gepachtet hat, und zum anderen, dass wir, da das Fragen nach der Wahrheit zu unserem Wesen gehört, ja, dieses eigentlich erst begründet und damit unabweisbar ist, uns selbst (= unserem Wesen) gegenüber die Verpflichtung haben, den Weg zu dieser "Wahrheit" - nach bestem Wissen und Gewissen - zu beschreiten.
Das Problem, das sich uns dabei stellt, hat Arthur Kiesel in seinem 1933 erschienenen Buch mit dem Titel "Wir sehen nur Schatten"3 anhand etlicher Beispiele illustriert. „Schatten“ sind (vom Standpunkt der Wahrheit aus gesehen) nur unzureichende Ab- oder Nachbildungen. Die bekannteste Illustration zu diesem Thema hat Platon mit seinem "Höhlengleichnis" gegeben4, indem er (wie in einem Gleichnis üblich) einen unsinnlichen, damit schwer fassbaren Inhalt in ein be-greifbares, anschauliches Bild kleidet. Wenn Kiesel grundsätzlich von nicht hinreichender Wahrnehmung spricht, so zeichnet Platon ein vierstufiges Bild des Innerhalb und des Außerhalb der Höhle, wobei jede dieser Stufen ein anderes Verständnis von Wahrnehmung repräsentiert.
Die beiden Stufen innerhalb der Höhle (in die wir hineingeboren werden und die wir nur durch Er-Ziehung verlassen können) beschreiben den auf die täuschende Arbeit der Sinnesorgane sich verlassenden Teil unserer Wahrnehmung (der uns nur Schatten = Abbildungen zu „sehen“ er- laubt), während die beiden Stufen außerhalb der Höhle für das Denken stehen (mit Verstand bzw. mit Vernunft) und für den Weg zum Licht der Wahrheit. Ob nach Platon diese Wahrheit schließlich wirklich erreicht werden kann, wird von den Exegeten unterschiedlich interpretiert. Im Gleichnis heißt es, dass die Seele "zuletzt und nur mit Mühe" die Sonne - deren Licht als 'Licht der Wahrheit' verstanden - sehen könne (am Ausgang der Höhle wird die Seele zunächst von der Helligkeit geblendet; am vermeintlichen Ziel steht das Problem, in die intensive Strahlung der Sonne selbst sehen zu müssen). Der vagabundierende Denker verweist auf Platons Formulierung "mit Mühe" und sieht sich in seinem 'Bemühen' um den Weg bestärkt.
Francis Bacon (1561 - 1626) greift das Bild der Höhle in seiner "Idolenlehre"5 auf als eines der Vor-Bilder, die uns daran hindern, das Licht der Wahrheit zu erfassen. Solche entstellenden Vor-Bilder verdanken wir (als Repräsentanten der Gattung 'Mensch') nicht nur unseren uns täu- schenden Sinnesorganen, sondern in erheblichem Maße auch unseren individuellen, uns vererb- ten Eigenheiten und unseren ebenso individuellen Lebenserfahrungen. Stellt man dies in Rech- nung, so ist die Basis unseres Erkennens, die Wahrnehmung, nur eine Wahr-Nehmung : Jeder nimmt das wahr, was seine individuelle Prägung erlaubt (ganz zu schweigen von der bewussten utilitaristischen Einstellung : "Ich will das so sehen, weil es mir nützt.").
In dieser Reduktion auf die individuelle Wahr-Nehmung eine Enttäuschung angesichts der erhofften Reichweite menschlicher Fähigkeiten zu sehen, übersieht das Potential einer Ent-Täuschung. Es ist ja keineswegs so, dass diese Wahr-Nehmungen nur Hindernisse darstellen - sie vertreten und eröffnen im Gegenteil eine Vielfalt der Meinungen, die in ein förderliches Streit-Gespräch (Eristik) münden können, in dem jeder Gesprächsteilnehmer (= Partner) aus seiner Perspektive einen Beitrag zur Urteilsfindung geben kann. "Perspektivismus" meint nicht "Relativismus". Jede Perspektive ist wichtig, solange sie sich ihrer eigenen individuellen Be-schränkungen bewusst ist und solange sie bemüht ist, in ein offenes Gespräch einzusteigen mit der Einstellung "der andere könnte ja recht haben und mir mit seiner An-Sicht neue Perspektiven eröffnen". Im Verständnis der vagabundierenden Methode kann also festgehalten werden, dass jegliche vermeintliche Erkenntnis immer schon individuelle Interpretation (= Auslegung) ist, die Voraus-Setzung ist für einen offenen Dialog gesprächsbereiter Kommunikations-Partner.
2. Wahr-Nehmung als wechselseitige Interpretation in einem herrschaftsfreien Diskurs
Wenn das Bild des in seiner je eigenen Höhle sitzenden, um Erkenntnis bemühten Individu- ums stimmig ist, können wir Menschen nicht anders, als aus unserer je eigenen Perspektive Urteile zu fällen. In seinen 1795 aufgeschriebenen Notizen, die der Herausgeber seiner Werke unter dem Titel "Urtheil und Seyn" zusammengefasst hat, zieht Hölderlin die etymologisch sicher fragwürdige, von der Sache her aber zutreffende Konsequenz, dass wir, wenn wir urteilen wollen, uns als individuelles Subjekt einem Objekt gegenüberstellen und damit eine Ur-Theilung in das Seyn bringen.6
Was ist gemeint ? Zunächst einmal, dass ich als Subjekt es bin, der ur-teilt; ich bin aktiv und suche mir aus der Fülle möglicher Objekte dasjenige aus, um das ich mich zu diesem Zeitpunkt in besonderem Maße bemühen möchte. Ich bringe - nach Hölderlin - damit in das Gesamtgefüge dessen, was ist (= Seyn), eine Teilung hinein, insofern ich mich um einen Teil, um das von mir ausgewählte Objekt, kümmere. Die Gesamtheit selbst kann ich mir nicht zum Objekt machen, da sie einerseits zu komplex ist und da andererseits ich als Erkennender, der dem Objekt gegenüber (und damit außerhalb des zur Erkenntnis anstehenden Objektbereichs) steht , niemals mit erfasst werden kann. Der Versuch, mich mit einzuberechnen, bedürfte eines neuen Erkenntnisvorgangs, bei dem wiederum das erkennende Subjekt aus dem Objektbereich ausgeschlossen wäre.
Halten wir fest : Wenn ich mich um die Erkenntnis eines Objekts bemühe, kann ich immer nur Teilbereiche anvisieren und reiße so mein von mir gewähltes Objekt aus dem sinngebenden Gesamtzusammenhang. Hinzu kommt, dass ich nicht "neutral" an dieses Objekt herangehen kann, sondern aus meiner individuellen Situation, aus meiner nur mir eigenen Höhle immer schon Vor-Strukturierungen mitbringe, in die hinein ich meine jeweiligen Wahr-Nehmungen setze.
Diesen meinen individuellen Vorstrukturierungen korrespondiert meine mir eigene Sprache, die aus meiner ‚Bildung‘ resultiert, aus dem also, was ich selbst aus mir gemacht habe. Wir sprechen also, streng genommen, untereinander nicht die gleiche Sprache. Dieses Problem zieht sogleich das nächste nach sich : um verstanden werden zu können, müssen wir uns bemühen, die nur uns eigene Sprache zu verallgemeinern; d.h. wir müssen mit begrifflichen Setzungen arbei- ten, die das, worum es geht, nur ge“normt“ erfassen können. Diese Art von Sprache ist von der individuellen Sichtweise eines jeden und zugleich von der ‚Wahrheit‘ weit entfernt.
Ich stehe also der Welt der von mir potentiell zu erkennenden Objekte mit sehr problema-tischen Voraussetzungen gegenüber. Ich habe nichts als meine je eigene Interpretation, und die ist, wenn ich mich sprachlich äußere (von anderen Äußerungsmöglichkeiten wird später noch zu reden sein) an die Sprache mit all ihren Problemen gebunden.
Das Problem kann nicht überstiegen werden, aber es kann versuchsweise abgemildert werden dadurch, dass ich mich Impulsen von außen öffne (meine eigene Interpretation also in Frage stelle und in der Folge durch diese Haltung verändere und ausdifferenziere). Hier kommt "der Andere" ins Spiel, das andere Subjekt, das unter den gleichen Bedingungen antritt und vor die gleichen Schwierigkeiten gestellt ist. Er ist mein Kommunikations-Partner, ein Teil-Haber an diesem Prozess der Mit-Teilung; durch seine ihm eigene Interpretation fordert er mich heraus und fördert in eins damit gleichzeitig die Ansichts-Vielfalt. Was wir auf diese Weise einander sind, sind wir wechselseitig.7
Ein jeder von uns hat seine eigene Perspektive, und die bietet er sozusagen den Gesprächs-Partnern an. Um diesen Prozess gelingen zu lassen, bedarf es auf beiden Seiten einer "Tugend", wie Rousseau herausgearbeitet hat8, die zum einen darin besteht, dass ich offen meine Perspek-tive anbiete, dass ich andererseits aber auch bereit bin, mir etwas sagen zu lassen und mich eben- so offen mit der Perspektive des anderen auseinanderzusetzen, so dass wir in ein Gespräch ein- treten, an dessen Ende (das immer nur ein vorläufiges sein kann) eine zwar immer noch partielle (auf uns als Partner zugeschnittene) An-Sicht als Ergebnis herauskommt, die für uns aber - in dieser unserer Situation - Gültigkeit besitzt. Nichts anderes meint die Idee von einem "herr-schaftsfreien Diskurs".
3. Der eigene Weg der Kunst
Der sprachliche Weg zur Welt der Objekte ist - wie behauptet – problematisch, da Begriffe (unvermeidlich individuell geprägt und doch notwendig verallgemeinernd) im Hinblick auf eine gesicherte Erfassung vergebens fest-zu-stellen versuchen. Die Frage drängt sich auf, ob es denn einen außer-sprachlichen Weg gebe, z.B. den anschaulichen der Kunst. So behauptet Willi Baumeister 1947 in seinem Buch Das Unbekannte in der Kunst:
Vom Standpunkt des Malers aus ist Malerei die Kunst des Sichtbarmachens von etwas, das durch ihn erst sichtbar wird und vordem nicht vorhanden war, dem Unbekannten angehörte. 9 Um das zu erreichen, gilt es, den bloß positivistischen Weg der (Alltags-) Erfahrung und der ihr entsprechenden prosaisch-geregelten Sprache zu verlassen : Kunst besteht nie in Regeln, sondern immer in Ausnahmen vom Standpunkt des Erfahrungsmäßigen. Erfahrung kann, was das zum Schöpferischen Bezügliche anlangt, nie auf Kunst angewandt werden. Das Unbekannte bildet den Gegensatz zu jeder Erfahrung. Kunst sollte als Metamorphose betrachtet werden, als beständige Umwandlung.10 Bekanntes zu geben, ist keine Kunst. Bekanntes zu geben ist Wieder-holung. Die künstlerische Leistung ist, dem Unbekannten entgegenzugehen. 11
Das aus philosophischer Sicht Unbekannte ist die Wahrheit; um die Tauglichkeit der Behaup-tungen Baumeisters zu prüfen, die (einschränkend) vom Standpunkt des Malers aus (und noch dazu e i n e s Malers) gegeben werden, ist es nun an uns, nach der möglichen Reichweite der Kunst zu fragen. Gehen wir also grundsätzlich vor und be-fragen den Begriff der „Kunst“.
Begriffe haben eine Geschichte, und deren Darstellung findet man in der Regel im „Deutschen Wörterbuch“ der Brüder Grimm. Dem Begriff der „Kunst“ sind hier 19 Spalten gewidmet. Als lateinische Äquivalent-Begriffe werden „scientia“, „ars“, „artificium“ und „machina“ genannt.
An wesentlichen Bedeutungsebenen werden unterschieden : zuerst ein „Können“ (abgeleitet von kunnen), in der Folge daraus „Fertigkeit, Geschicklichkeit“ und schließlich der heutige „erhöhte“ Sinn von Kunst.12
Im Zusammenhang mit „scientia“ sind „Fertigkeit und Geschicklichkeit“ schon einem Bereich zuzuordnen, der über bloße manuelle Fähigkeiten hinausgeht. Das könnte auf einen Weg der Kunst im Bereich des Geistes verweisen, der uns bei unserem philosophischen Problem der Wahrheits-Findung weiterhilft. Verstärkt wird diese Vermutung durch den Hinweis auf den „erhöhten Sinn von Kunst“. Fragt man, was darunter zu verstehen sei, wird man zur Begriffs- klärung auf die zu diesem Zeitpunkt („heutig“ meint das Editionsjahr des Wörterbuchs) in der philosophischen Forschung geläufige transzendentale Methode Kants zurückgreifen dürfen.
Mit ihrer Hilfe wird der Gegenstand der Untersuchung überstiegen (von lat. ‚transcendere‘) auf die Bedingungen seiner Möglichkeit (und in eins damit auf sein Verständnis) hin.
Friedrich Schiller wählt diesen Weg in seinen ästhetischen Schriften. „Ästhetik“ meint hier den Bereich der Kunst, zeitbedingt (in der Nachfolge von Alexander Gottlieb Baumgarten) speziell den Bereich der „Schönheit“.13 Er knüpft an Überlegungen Kants aus dessen Kritik der Urteilskraft an, in denen dieser die Bedingungen der Möglichkeit eines allgemeingültigen ästhetischen Urteils geprüft hat mit dem Ergebnis, dieses habe zur Grundlage ein interesse- loses Wohlgefallen14. Zur Begründung ist anzuführen, dass der Mensch nach Kant ein Bürger zweier Welten ist, der sensiblen und der intelligiblen. Grob vereinfachend gesagt, bin ich als Bürger der sensiblen Welt (dank meines Angewiesenseins auf die Arbeit der Sinnesorgane und meine Abhängigkeit von meinen Neigungen) rezeptiv, heteronom und damit passiv, während ich als Bürger der intelligiblen Welt (dank der Arbeit von Verstand und Vernunft) spontan, autonom und damit aktiv bin. Jede dieser beiden Welten strebt in mir unnachgiebig nach Durchsetzung und beansprucht den Primat ihrer Interessen. Die ästhetische Anschauung nun hebt den Kampf beider menschlicher Naturen auf durch das Gefühl des interesselosen Wohlgefallens, das der Mensch (nach Kant in subjektiver Notwendigkeit15 und das bedeutet : auf alle Menschen zutreffend) bei der Betrachtung eines schönen Gegenstandes hat. Weder der Reiz des Angeneh-men (auf der Basis der Neigungen) noch der Reiz des Guten (auf der Basis der Vernunft) erheben dominierend ihre Stimme. Das führt Kant zu der Feststellung : Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird. 16 Damit ist die Wahrnehmung des Schönen im eigentlichen Wortsinne zweck-los. Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt. 17 Ohne Begriff aber ist diese Wahrnehmung erkenntnistheoretisch eine Nullnummer.
Für die Nachfolger Kants ist sie dennoch von erheblicher Bedeutung, ist hier doch der Keim für deren Versuche gelegt, auf der Basis der Philosophie Kants seine Zwei-Welten-Theorie zu überwinden. Schiller ist nur einer von ihnen, und wenn es auch übertrieben ist, in ihm, wie Rüdiger Safranski in seinem Buch behauptet, den „Erfinder des deutschen Idealismus“18 zu sehen, so soll er für uns als Beispiel dienen für eine mögliche Erläuterung des o.a. Begriffs einer „erhöhten Kunst“. Schiller ist eigenständiger Kantianer, und so modifiziert er die Theorie seines Lehrers. Als (Sprach-) Künstler kann er sich mit dem bloß subjektiven, d.h. im Gefühl des Betrachters liegenden Prinzip des Schönen nicht zufrieden geben; er sucht nach einem objekti-ven Prinzip, nach etwas, das uns veranlasst, von etwas zu sagen, es sei schön. Er findet es in dem Verhältnis von Einzelnem und Ganzem : An jeder großen Komposition ist es nötig, daß sich das Einzelne einschränke, um das Ganze zum Effekt kommen zu lassen. Ist diese Einschränkung des Einzelnen zugleich eine Wirkung seiner Freiheit, d.i. setzt es sich diese Grenze selbst, so ist die Komposition schön. Schönheit ist durch sich selbst gebändigte Kraft; Beschränkung aus Kraft. 19
Diese objektive Eigenschaft des schönen Gegenstandes überträgt sich auf den Betrachter; in der Freiheit des Spiels mit dem Schönen wird er erst im vollen anthropologischen Sinne Mensch, da er seine beiden Naturen (siehe Kant) in dieses freie Spiel einbringt20 und sich zum Bürger des ästhetischen Staates entwickelt, dessen Grundsatz lautet : Freiheit zu geben aus Freiheit. 21 Ein edler Geist begnügt sich nicht damit, selbst frei zu sein, er muß alles andere um sich her, auch das Leblose in Freiheit setzen. 22
Dem Einwand, dass es in der Geschichte einen solchen staatlichen Zustand noch nicht gege-ben habe, begegnet Schiller mit dem Hinweis, dass die Erfahrung der Richterstuhl für eine solche Idee nicht sei. Ideen werden auf transzendentalem Wege gerechtfertigt, und so geht auch Schiller vor, indem er den argumentativen Nachweis erbringt, dass etwas, das unabdingbare Voraussetzung für etwas seinerseits unabdingbar Gewisses sei, damit transzendental gerecht- fertigt sei. Und da die Schönheit, wie gezeigt, Bedingung für das vollständige Menschsein ist, dieses aber seinerseits ein unabdingbares Postulat darstellt, ist die Idee der Schönheit in der Form, in der Schiller sie entwirft, (in seinem Verständnis) gerechtfertigt.23
Folgt man dieser Argumentation, kann man guten Gewissens von einem „erhöhten Sinn von Kunst“ sprechen. Es ist die Kunst, deren Begegnung den Menschen erst in vollem Sinne zum Menschen macht. Hatte Baumeister also Recht, wenn er davon sprach, dass Kunst als Meta-morphose betrachtet werden sollte, als Umwandlung ? Offensichtlich, und zwar, wie Baumeister betont, als „beständige“, dynamische. Schiller deutet diese fortwährende Dynamik des Prozesses vor allem in den Briefen 18 – 23 an, in denen er seine Überlegungen erkenntnistheoretisch absichert24. Aufgegriffen und betont ausgeführt hat diesen Aspekt Friedrich Hölderlin.
Hölderlin steht in einem ähnlichen Schüler-Verhältnis zu seinem Lehrer Schiller wie dieser zu Kant. Schiller war Vorbild für ihn; an ihm hat er sich abgearbeitet und seine eigene Theorie entwickelt. In Abgrenzung zu ihm hat er den Plan entworfen, „neue ästhetische Briefe“ zu schreiben (und damit Schillers Arbeit zu „ergänzen“, wie Schiller es bei Kant vorhatte); schließ- lich hat er sich in seiner selbst gestellten Aufgabe als Schriftsteller auf das Schreiben seines Ro- mans, des Hyperion, konzentriert, dessen über mehrere Jahre entstandene Fassungen auch Höl-derlins ästhetische Theorie (vor allem in den jeweiligen Vorreden) entwickeln 25 In der Nachfolge Schillers wird Kunst hier als „Schönheit“ thematisiert. Diese wird nach einem Wort des Vorsokratikers Heraklit als hen diapheron heauto gefasst, als das Eine in sich selber Unterschiedene 26. Auf sie trifft zunächst das zu, was auf S. 6 dieser Arbeit in einem Schiller-Zitat über die „Komposition“ gesagt worden ist. Das Ganze als Einheit und das Einzelne als Differenz stehen in einem freien Verhältnis (ohne Dominanz) zueinander. Dieses freie Ver- hältnis wird von Hölderlin wiederum als Einheit gesehen, so dass die Figur des Einen in sich selber Unterschiedenen als „Einheit von Einheit und Differenz“ aufzufassen ist. Diese gedank- liche Figur findet nun Anwendung auf das Leben des Menschen.
Laut „Vorrede zur vorletzten Fassung“ des Hyperion 27 wird die Existenz des Menschen als eine ex- zentrische Bahn gesehen, auf der er im Verlaufe seines Lebens seine Bewusstseins- entwicklung immer weiter ausdifferenziert. Dank unseres Bewusstseins sind wir aus dem Zentrum, dem Seyn, also aus dem, was von sich her ist ohne jede Spiegelung durch ein Bewusst- sein, herausgefallen („ex“) und haben durch unsere Urteile eine Ur-Theilung hineingebracht (vgl. S. 3 der Arbeit). Das Seyn als Ganzes bleibt uns bewusstseinsmäßig verschlossen; alle unsere Bemühungen verbleiben in einem defizienten Modus. Aber selbst in dieser Form leisten wir dem Seyn, das von sich her bewusstlos ist, einen Dienst, indem wir Welt-Bilder entwerfen und somit einen Spiegel des Ganzen zu geben versuchen. In diesem Sinne haben die Romantiker den Menschen als „Priester des Seins“ gesehen.
Zentrifugale Kräfte (mit der Ziel-Setzung der Bewusstseins-Erweiterung) bringen den Men-schen dazu, das Zentrum zu verlassen, zentripetale sorgen in der Gegenbewegung dafür, dass er auf seiner Bahn immer wieder Haltepunkte sucht, etwas, woran er sich bewusstseinsmäßig fest-halten kann, bevor er wieder auszubrechen veranlasst wird (aus der Einsicht in die Unzuläng-lichkeit der jeweiligen Haltepunkte heraus). So ist die exzentrische Lebensbahn als ganze (als„Einheit von Einheit und Differenz“) unterteilt in viele einzelne Teil-Bahnen, die fort-schreitend ein immer differenzierteres Bild entwerfen. Wohin der Weg letztlich führt, ist unklar; Baumeister nennt es „das Unbekannte“. Hölderlin und seine Zeitgenossen haben ein ganzheit-liches Ziel gesucht, eine Vollendung 28, eine Auflösung der Dissonanzen in einem gewissen Charakter 29. Dies nun ist dem Menschen nicht vergönnt : Aber weder unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgendeiner Periode des Daseins dahin, wo aller Widerstreit aufhört, wo alles eins ist; die bestimmte Linie vereiniget sich mit der unbestimmten nur in unendlicher Annäherung. 30
Hölderlins Denkmodell ist ein dialektisches; die Schritte auf der exzentrischen Bahn sind als Position, Negation und Synthese (durch bestimmte Negation31 ) zu erkennen. Dadurch, dass der Prozess unabschließbar ist, kann von einer „offenen Dialektik“ gesprochen werden. Um diese zu ermöglichen, kommt bei Hölderlin die Schönheit ins Spiel : Wir hätten auch keine Ahndung von jenem unendlichen Frieden, von jenem Sein, im einzigen Sinne des Worts, wir strebten gar nicht, die Natur mit uns zu vereinigen, wir dächten und wir handelten nicht, es wäre überhaupt gar nichts (für uns), wir wären selbst nichts (für uns), wenn nicht dennoch jene unendliche Vereinigung, jenes Sein, im einzigen Sinne des Worts vorhanden wäre. Es ist vorhanden – als Schönheit. 32 Kunst, so hatte Baumeister gesagt, sollte als Metamorphose betrachtet werden, als beständige Umwandlung. Hier, bei Hölderlin, zeigt die Kunst qua Schönheit (im Sinne des Einen in sich selber Unterschiedenen) die Rolle der Kunst für den in beständiger Wandlung sich befindenden Menschen. In diesem Sinne darf von „erhöhter Kunst“ gesprochen werden.
4. Die Ästhetik des erweiterten Kunstbegriffs
Gerade der offene Dialog einer philosophischen Untersuchung (vgl. S. 2) ist auf eine vor- gängige Klärung von Begriffen angewiesen, will die individuelle Vielfalt der An-Sichten über- haupt fruchtbar gemacht werden können. Der Begriff der „Kunst“ ist in seinen mannigfaltigen Variationen oben angesprochen worden; der Begriff der „Schönheit“, dem „Kunst“-Begriff nicht notwendig inhärent, ist, wie gesehen, bei Schiller und Hölderlin hinzugekommen als ‚differentia specifica‘ zu anderen Kunst-Auffassungen. Dank seiner haben wir uns ein Bild machen können von dem, was unter „erhöhter Kunst“ verstanden werden kann. Dabei sollte bewusst bleiben, dass es sich hier nur um historisch gewachsene und damit auch in ihrer Geltung begrenzte Bei-spiele eines Kunst-Verständnisses handelt, denen andere gegenüberstehen. Darauf deutet schon der Terminus des „erweiterten Kunstbegriffs“ hin, den Joseph Beuys propagiert hat, dem wir uns jetzt zuwenden wollen.
Das Attribut „erweitert“ hat zunächst einmal Bedeutung im Hinblick auf den Bezug des Beuysschen Kunstverständnisses zu anderen Theoretikern, z.B. zu den eben angeführten Ansätzen von Schiller und Hölderlin. Das zeigt beispielhaft der Titel einer Vorlesung, die Volker Harlan im Schiller-Jahr 2005 gehalten hat („Joseph Beuys aktualisiert Schiller – Ideen zur Evolution der Gesellschaft“)33, das zeigt aber auch die ausgezeichnete Arbeit von Doro Franck („‚Vaterländische Gesänge‘ : Joseph Beuys und Friedrich Hölderlin“34 ), die einen anspruchs-vollen Einstieg in die Gedankenwelt beider ermöglicht. Das Attribut „erweitert“ hat in anderer Hinsicht aber noch eine viel bedeutsamere Funktion : es ist der Kunstbegriff selbst, der hier zur Erweiterung ansteht.
Im Verständnis des „erhöhten Sinns“ des Kunstbegriffs geht dieser bei Joseph Beuys auf ein volles, nicht partiell abgetötetes, ein aus dem Bezug zum Urwort kreatives Mensch-Sein in permanenter ‚Vorbereitung‘. Was das heißt, soll im Folgenden untersucht und versuchsweise erläutert werden. Dem Hölderlinschen Ansatz ähnlich, geht Beuys‘ Intention auf etwas „volles“, was bedeutet, dass das Ziel offensichtlich noch nicht erfasst ist. Wir haben die Kunst noch nicht erreicht. 35
„Kunst“ ist wie bei Schiller wesentlich für das Menschsein, aber nicht als Werkzeug, nicht als Vermittlungsinstanz, sondern Kunst ist Leben : Freiheit – Selbstbestimmung – Kreativität – Kunst – Mensch (...) Auf diese Formel beziehe ich mich, wenn ich sage : jeder Mensch ist ein Künstler – weil ich mich dann beziehe auf den Freiheitspunkt, der in jedem freien Menschen existiert. 36 Das bedeutet, der Objektcharakter von Kunst wird radikal aufgehoben. Kunst ist Lebensvollzug.37 Das hat erkenntnistheoretische Konsequenzen : Ja, daß man sie (gemeint ist die Substanz) nicht rational oder analytisch erklären kann, ja daran bin ich nicht interessiert, sondern daß man in der Sache selbst sich befindet, in der Substanz sich befindet. 38 Wer hin-gegen nur am Objektcharakter interessiert ist, hat, wie oben erwähnt, ein „partiell abgetötetes“ Verhältnis zu dem bei Beuys intendierten vollen Menschsein und in eins damit zur Welt der möglichen Objekte überhaupt. Das erinnert an das eindimensionale Denken der Naturwissen- schaften, solange dieses streng materialistisch orientiert ist : Wird dieser eingeschränkte Wissenschaftsbegriff als Kulturbegriff verbindlich für die gesamte Kultur, so geht die Kultur unter, weil er das Prinzip des Todes ist. Der Materialismus hat das Prinzip des Todes heraus- gearbeitet. 39
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ – dies ist das klassische Beuys-Zitat schlechthin. Jeder ist nach Beuys also prinzipiell in der Lage, diesen Kunstbegriff zu leben. Allerdings – und hier wird man an die Theorie der sozialen Anarchisten mit ihrem hohen Anspruch an die Autonomie erinnert, die not-wendig ist, um dem Leitsatz gerecht zu werden : „Selbstbeherrschung ohne Fremdbeherrschung“ – verläuft die Aktualisierung dieser Potenz nicht von sich her, nicht automatisch. Zur Umsetzung dieses Kunstbegriffs muss allererst erzogen werden : Der Mensch muß richtig gebildet, d.h. durchgeknetet werden. (...) Er ist bildsam, plastisch formbar. 40 Der Terminus „durchkneten“ spricht Bände und zeigt den üblichen Widerstand der Probanden. Beuys weist die Aufgabe von sich, alleiniger Erzieher in diesem Sinne zu sein : Ich zeige doch nur ein technisches Modell, ich weise einen Weg. Dieser Weg wird umso differenzierter und richtiger sein, je mehr Menschen mit verschiedenen Qualitäten hinzutreten, zum Beispiel der Jurist, der Arzt, der Erzieher und so fort. Solange ich allein bin, kann ich lediglich über meinen Gedanken reden, und ich kann ihn so sehr differenzieren, er wird niemals ein Bestandteil der Wirklichkeit werden. 41
Über die plastische Formbarkeit des Menschen kann von einer plastischen Theorie gespro- chen werden (Man braucht sich nur vorzustellen, daß bei der Entwicklung des menschlichen Bewußtseins das Gehirn, die menschlichen Organe, eine plastische Verformung annehmen, die zwar sehr fein ist und die man vielleicht nicht grob anatomisch beurteilen kann, die aber fest-zustellen ist. 42 ), die, konsequent weitergedacht, in die Theorie der Sozialen Plastik einmündet:
Die moderne Kunstdisziplin Soziale Plastik, Soziale Architektur wird erst dann in vollkommener Weise in Erscheinung treten, wenn der letzte lebende Mensch auf dieser Erde zu einem Mit- gestalter, einem Plastiker oder Architekten am sozialen Organismus geworden ist. Dann erst würden die Forderungen der Aktionskunst von Fluxus und Happening nach Mitspiel ihre Erfüllung finden, dann erst wäre Demokratie voll verwirklicht. 43
Plastik in diesem Sinne, das dürfte klargeworden sein, ist nichts Festes, Dauerhaftes, sondern etwas Bewegliches, Wechselhaftes, sich ständig Veränderndes. Dafür haben die beteiligten Menschen qua Künstler zu sorgen. Da der aus der Kreativität der einzelnen Mitglieder heraus- gebildete Gedanke schon ein Kunstwerk, eine Plastik ist, kommt Beuys zu der knappen For- mulierung Denken ist Plastik 44, den er immer wieder und ausführlich begründet. Im Einleitungs-kapitel der Textsammlung „Die unsichtbare Skulptur“ verweisen die Herausgeber darauf, dass der Gedanke das erste Produkt menschlicher Kreativität sei und dass von daher es beim erweiterten Kunstbegriff „nicht um kunsttherapeutische Beiläufigkeiten, nicht um ein Nebenbei- kurieren an den Symptomen“ gehe, „sondern darum, zuerst das ‚Tragende‘ zu befreien.“ Das Tragende aber sei die Arbeit des Menschen.45 Hiltrud Oman geht in ihrer Arbeit ausführlich auf diesen Aspekt ein und fasst zusammen : „Die Plastische Theorie schildert den prozessualen Fortschritt von der Intuition zur Erkenntnis und berücksichtigt dabei selbst die kommunikative Verbreitung der Erkenntnis (Soziale Plastik).“ 46 Das ist näher zu erläutern.
Wenn an dieser Stelle von „Arbeit“ die Rede ist, wird der philosophisch geschulte Leser sofort an den Arbeitsbegriff bei Karl Marx in seinen „Pariser Manuskripten“ denken, den er wiederum von seinem Lehrer Hegel entliehen hat. Der Mensch hat die Aufgabe, über seine Kultur (abgeleitet von lat. „colere = bebauen, pflegen) die zunächst menschenfeindlich aus- gerichtete Natur so zu bearbeiten, d.h. umzuformen, dass ein menschliches Überleben möglich ist. Für Beuys geht es um mehr als um das Überleben – ihm geht es um die Sinnhaftigkeit, so dass in seinem „erweiterten Kunstbegriff“ keine Stilrevolution, sondern eine Sinnrevolution zu erkennen ist.47
Oben ist von „Intuition“ die Rede; wer die philosophischen Gedankenmodelle durchdacht hat, weiß, dass ein „Sinn“ grundsätzlich nicht festgestellt werden kann; das ist Grundthese dieser Arbeit (vgl. S. 1) und wird es bei allen noch anstehenden Überlegungen bleiben. Wenn Fest-Stellungen als gesetztes Wissen nicht im Bereich unserer Möglichkeiten liegen, bleiben als Weg (wir sind ja hier immer noch im Bereich des vagabundierenden Denkens) nur die Intuition und die Imagination. Beide setzen beim noch Ungeformten an oder, wie Beuys es ausdrückt, beim Chaos, das in seinen Augen außerordentliche, produktive Potentiale bereithält (die „werden gesehen als Reservoir von Kräften, Empfindungen, Phantasien, Gedanken, unartikuliert, ungeformt, ungelenk zunächst“ 48 ). Doro Franck verweist darauf, dass es um ein Spüren, nicht um ein Wissen gehe (nur gehen könne), und sie legt Wert auf den Hinweis, dass „Gespür“ etwas ganz anderes sei als (bloßes) „Gefühl“. 49 Aber dieses Gespür (in den erkenntnistheoretischen Überlegungen der Philosophie-Hardliner arg verpönt) kennt in seiner phantasiegeleiteten Offenheit nur Berichte von verschiedenen Wegen, auch vom Irregehen, „nie von der eigentlichen Ankunft. (...) Ankunft bleibt notwendig in der Zukunft“50. Antje Oltmann weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Löcher auf Beuys-Zeichnungen hin : „Das Loch kann Sammelstelle für verstreute spirituelle Schwingungen sein. Es kann Energiequelle, Sender oder Empfänger sein : Transporteur für Qualitäten, die über das rein Stoffliche hinausgehen. Hier ist der Ort, an dem der Mensch die ‚Neuschaffung von Weltstoff‘ vollzieht. Hier ist für unseren Geist ein Sprungbrett.“51 Der erweiterte Kunstbegriff bei Beuys geht, so kann man zusammenfassen, über unser her- kömmliches, begrenztes Kunstverständnis hinaus. Seine Offenheit birgt Lebensqualität pur und wird, so ist zu vermuten, zu der „Werdelust“ führen, die den Wegen des vagabundierenden Denkens zu eigen ist.52 In ihm liegen für den Menschen Chance und Aufgabe zugleich. Die Aufgaben sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Eingangs-Zitat auf Seite 10 dieser Arbeit hat Beuys von „permanenter Vorbereitung“ als Forderung gesprochen. Dies soll ob seiner Bedeutung in einem längeren Zitat erläutert werden : Das heißt ganz einfach, ich muß mich immer wieder vorbereiten, immer wieder vorbereiten und muß mich in meinem ganzen Leben so verhalten, daß kein einziger Augenblick nicht der Vorbereitung angehört. Also ob ich nun den Garten bearbeite, ob ich mit Menschen spreche, ob ich mich im Straßenverkehr bewege, ob ich ein Buch lese, ob ich unterrichte oder in welchem Arbeitsfeld und in welchem Tätigkeitsfeld ich auch zu Hause bin, ich muß immer die Geistesgegenwart, das heißt den Rundblick haben für die gesamte Kräftekonstellation. (...) Ich muß aber auch andere Menschen an die Sache heran-führen, also ich muß sofort in ein Gespräch mit anderen Menschen kommen und deren Argumen- te hören, denn ich kann nicht behaupten, das kann ich nie, daß das, was ich herausgestellt habe, etwas ist, was objektiv und nach allen Seiten hin richtig ist. Ich kann nur sagen, das, was ich hier herausgebracht habe, ist das Ergebnis meiner Arbeit und bitte jetzt weitergehende Argumente, denn ich bin ja in der Entwicklung. Ich kann ja nicht sagen, daß irgendeiner an meine Sache zu glauben hat, ganz im Gegenteil, alles, was Menschen also herausstellen - das sollte auch der neue Kulturbegriff sein - muß wie eine Frage in der Welt stehen, die nach Ergänzung und nach Verbesserung und nach Erhöhung strebt. 53
Thema dieser Arbeit ist die wechselseitige gedankliche Befruchtung von vagabundierendem Denken und erweitertem Kunstbegriff. Das Beuys-Zitat spricht die Verbindung in aller Deut-lichkeit aus. Beide Theorien (den erweiterten Kunstbegriff mal als eine solche genommen) for- dern die Offenheit der Imagination des Einzelnen und zugleich seine Bereitschaft, in den Dialog einzutreten, zuzuhören, sich etwas sagen zu lassen und dazu Stellung zu beziehen. Auf diese Weise werden beide Seiten gefördert. Wilfried Heidt spricht in seinem Text „Die Umstülpung des demiurgisches Prinzips“ von der Not-Wendigkeit (also dem, was die Not wendet) einer permanenten Konferenz54 und auch vom „Gemeinwillen“55, einer Vorstellung, die auf Rousseaus „Contrat social“ zurückgeht und in der dieser sein basisdemokratisches Modell entwickelt, mit dessen Hilfe jeder Bürger zugleich Untertan und Souverän ist. U.a. Schiller (in seiner Unter-scheidung von „Brotgelehrtem“ und „philosophischem Kopf“) und Gadamer (in seiner Herme-neutik) gehen argumentativ in die Richtung.
Doro Franck versucht an Gedanken Hölderlins und Beuys‘ aufzuweisen, inwiefern der Einzelne aus sich herausgehen muss hin zum Anderen, um rückkehrend bereichert zu Eigenem zu kommen. Auf der Suche nach dem Eigen-Sinn (Hesse !) bedarf es der Begegnung mit dem Anderen, des Durchgangs durch den Anderen, und das ist ein wechselseitiger Prozess : „Diese Mechanik des Wunders, daß Kunst uns erlaubt, den verschlungenen Wegen im Eigenen eines anderen zu folgen, macht Kunst zu etwas ganz anderem als bloßes Vergnügen oder Belehrung. Sie ist eine Wette auf eine tiefere Gemeinsamkeit, die nur jenseits des Konventionellen bestätigt werden kann. Sie prüft und schafft eine geistige Gemeinschaft, indem sie mutig voraussetzt, was erst noch und immer wieder neu geschaffen werden muß. (...) In einem erweiterten Kunstbegriff bezieht sich ‚Kunst‘ nicht auf die Kunst als bestehende Institution, sondern auf jedes Schaffen eines stimmenden inneren Bildes, das dann zur Begegnungsstätte werden kann, sei es in der Sprache, in Handlungen oder Bild-Gegenständen. Kunst ist die Schaffung von Realitäten; Künstler ist der, der frei das Notwendige (das was uns not tut) schafft.“56 Es geht also um eine Not-Wendigkeit, um das, was die defizitären gesellschaftlichen Zustände aufzuheben hilft. Man wird erinnert an die paradox klingende Formel, die Friedrich Engels in die politische Diskussion eingebracht hat : „Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit“.
„Kunst geht mit dem, was für die Sinne wahrnehmbar wird, so um, daß für den Wahrnehmen-den zugleich neue Qualitäten erschlossen werden, d.h. mit den in der Welt wirkenden Wesen erste oder neue Begegnungen ermöglicht werden. (…) In diesem Sinne ist Kunst in jedem Be- reich menschlichen Wahrnehmens und Tuns möglich. Und wenn die Aufmerksamkeit neue Wahrnehmungsräume entdeckt, wird sich gerade dadurch erweisen, ob der Aufmerkende sich voll in sie einzulassen vermochte, daß er ihre Elemente handhaben lernt, mit ihnen spielt, zum Künstler wird, d.h. Erscheinungen erfindet, die die Weise ihres Erscheinen nicht verhüllen, son- dern den Anschauenden selbst auf den Weg zur Erfindung weiterer Gestaltung leitet. Gelingt dies für den Schaffenden wie für den Nachvollziehenden, so entsteht Souveränität – jene Frei- heit aus künstlerischem Spiel, die Schiller enthusiastisch beschreibt. (…) Seit Schiller besteht der fragende Ausblick auf den Zusammenhang von Kunst und Gesellschaft ganz ausdrücklich.“57
5. Unterwegs zur sozialen Plastik
„Vagabundierendes Denken“ und der „erweiterte Kunstbegriff“ stehen hier für zwei theoreti- sche Modelle, die in ihrer Offenheit und Multiperspektivität als heilsam für die in ihrem utilita- ristischen Eigennutz in eine offensichtliche Sackgasse geratene Gesellschaft angesehen werden können. Das „Können“ verweist auf die Möglichkeit, die in ihren Ansätzen liegt. Aber sie haben nur Modellcharakter, und „ein Modell sagt nicht, es sei so, sondern es veranschaulicht nur einen bestimmten Betrachtungsmodus“ (C.G. Jung)58, und dem stehen andere Modelle anderer Be- trachtungsmodi mit zunächst gleichem Anspruch gegenüber. Hegel, der in seiner „Phänomeno- logie des Geistes“ vor einem entsprechenden Problem steht, will er seinen Ansatz als den über- zeugenden erweisen, weiß, dass es nicht hinreicht, einfach zu behaupten, der eigene Ansatz sei der richtige : e i n trockenes Versichern gilt aber gerade soviel als ein anderes . 59 Hinzu kommt, dass beide Modelle in ihrer Offenheit einen hohen Anspruch stellen, was Beuys (im Hinblick auf seine Theorie) bewusst ist : Ich sage, daß man durch einen erweiterten Kunstbegriff viel tun kann. Aber man muß nicht erwarten, daß das für den Menschen leicht aufzunehmen ist. Denn das ist nicht ein Kunstwerk in Holz oder Metall, sondern ein geistiger Zusammenhang, der einen hohen Anspruch an die Menschen stellt. “60
Ein Aus-Weg, der überzeugend wirkt, kann eigentlich nur eine gelingende Praxis sein, die eine Art Probierstein darstellt. Die philosophische Fachliteratur stellt eine Fülle an Praxis- Beispielen zur Verfügung, die allesamt behaupten, in der Lage zu sein, den geforderten hohen Anspruch zu erfüllen. Wenn wir aus dieser Fülle das Werk Jean-Jacques Rousseaus beispielhaft auswählen, so deshalb, weil sein Weg kein gerader war, weil er Wege und Umwege (und leider auch Flucht-Wege) wählen musste, weil er die Schranken der Realität hart an sich zu spüren bekam. Ein echter Probierstein also.
Wir setzen bei der dem vagabundierenden Denken grund-legenden Art des sich Fortbewe-gens, dem Gehen, an mit dem Verweis auf ein Rousseau-Zitat :
La vie ambulante est celle qu’il me faut.61 Rousseau braucht, so seine Worte, den Spazier-gang und erhebt ihn sogar zum Erzählmodell seiner Autobiographien. „Wie der Spaziergänger immer wieder von seinem Weg abschweift, um die Schönheiten der Natur zu betrachten, so unterbricht der Autobiograph seine lineare Erzählung, um sich an scheinbar Beiläufigem, an Anekdoten und Erinnerungen zu ergötzen.“62 Das Gehen fügt sich nicht dem linearen Denken, es schweift umher, es vagabundiert, es probiert aus. Gang-Metaphern weisen auf eine Entsprechung von Denken und Bewegung : „Gedankengang“, „Gedankensprung“, „Vorgehensweise“. Letz-teren Terminus hebt auch Beuys hervor : Der erweiterte Kunstbegriff ist (…) eine Vorgehens-weise. Wir müssen da die Sprache ernst nehmen. Ich hole aus dieser Vorgehensweise vor allem das Gehen heraus. Es ist ein Gang, das ist eine Bewegung. Sie sagt, daß das innere Auge sehr viel entscheidender ist als die dann sowieso entstehenden äußeren Bilder. 63
Diese Bewegung transzendiert über das „innere Auge“, über die ästhetische Einbildungskraft, das lineare, eindimensionale, neuzeitliche, physikalisch ausgerichtete Denken, das auf Natur-beherrschung bedacht ist.64 Natur soll nicht mehr „buchstabiert“65 werden. Vagabundierendes Denken und der erweiterte Kunstbegriff loten66 Räume an Vorstellungsmöglichkeiten aus.
6. Die Spur des Weges ; Einsam oder gemeinsam ?
Um den persönlichen Raum meiner Vorstellungsmöglichkeiten ausloten zu können, brauche ich Kenntnisse über mich selbst, über die Höhle, in der ich aufgewachsen bin und meine Erfah-rungen gesammelt habe, die sich dann zu einem ganz persönlichen Welt-Bild verdichtet haben. Das ist ein conditio sine qua non für den Versuch, eine soziale Plastik anstreben zu können. Wie komme ich dahin, einsam oder gemeinsam ? Zunächst einmal sieht es so aus, als ob der Weg als gemeinsamer bestimmt sei (Solidarität); zugleich habe ich, hat jeder für sich, an seiner Selbster-kenntnis zu arbeiten. So bietet die Tiefenpsychologie C.G. Jungs den Weg der Individuation an, der Selbst-Werdung67 ; es geht darum, die eigene „Persona“ (die Maske gesellschaftlicher An-Anpassung, die oft genug ins Selbstbild übernommen wird) zu durchschauen auf sein Selbst hin.
Allerdings sollte man auf die fachliche Begleitung durch einen Therapeuten nicht verzichten, und da zeigt sich schon die Bedeutung des Anderen bei der Selbstfindung, wie sie auch Doro Franck in ihrem Zitat (vgl. S. 14) entwickelt hat. Um den Weg genauer nachzeichnen zu können, bedarf es offensichtlich noch einiger Überlegungen, bevor wir zu Rousseau zurückkehren und seine Gedanken zu Hilfe nehmen können.
In seiner Novelle „Jonas oder der Künstler bei der Arbeit“ zeigt Albert Camus das Beispiel eines Künstlers, der nach ersten Erfolgen mit den sein Selbstverständnis bedrohenden Problemen der künstlerischen Schaffenskraft zu kämpfen hat. Er ist der Selbstaufgabe nahe, zieht sich dann aber in sein Atelier zurück mit der Behauptung, ein neues Werk zu schaffen. Man findet ihn, als man sich Zutritt zum Atelier verschafft, besinnungslos vor einer weißen Leinwand (entièrement blanche) liegend, au centre de laquelle Jonas avait seulement écrit, en très petits caractères, un mot qu’on pouvait déchriffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire.
Camus hat für sich die Bezeichnung „Existentialist“ immer abgelehnt, als einen Humanisten wird man ihn bezeichnen dürfen : „Die Würde des Menschen ruht in ihm selber. Er allein ist Hüter über sie. Seine letzte schreckliche Freiheit besteht darin, daß er sie im Selbstmord ablegen kann. Will er sie bewahren, so bleibt ihm nur, sich für die Solidarität zu entscheiden. (…) Die menschliche Existenz kann sich selbst verfehlen, indem sie sich absolut, d.h. losgelöst von der Solidarität, setzt und auf ihre Würde, die Verantwortlichkeit für die Solidarität, verzichtet.“68
Solidarität ist einer der wesentlichen Grundpfeiler der sozialen Plastik; der Versuch, sich selbst „absolut“ (losgelöst) zu setzen, steht dem im Wege. Darin sieht auch Camus Landsmann Rousseau das Hauptproblem bei der Frage, warum der Mensch sich so schwer tut, Verhältnisse (wie die soziale Plastik) zu schaffen, die unseren menschlichen Möglichkeit (Stichwort : Humanität) entsprächen. Wir werden uns mit seinen Erklärungen und auch mit seiner Lösung des Problems beschäftigen. Sein Werk steht, zwiegespalten, wie es ist, im Licht der Antithese, die durch die Begriffe einsam / gemeinsam geprägt wird. Antithesen dieser Art, die auf einen Dualismus hindeuten, sollten durch eine wechselseitige polare Zuwendung aufgehoben werden.
Zunächst einmal ist aber der Weg der Antithese, der immer ein Weg des Kampfes ist, zu unter- suchen. Wir beginnen bei der These der Einsamkeit.
7. Rousseau und das Glück der „rêveries du Promeneur Solitaire“
Folgt man den Ausführungen Heinrich Meiers („Über das Glück des philosophischen Lebens.
Reflexionen zu Rousseaus rêveries,“, München 2011), stehen Rousseaus rêveries nicht nur am Ende der Skala seiner Werke, sondern - von ihrer Absicht und Grundüberzeugung her - auch außerhalb des Rousseauschen Gesamtwerkes. Die Träumereien eines einsamen Spaziergängers tragen im Titel schon die Betonung einer wesentlichen Voraussetzung : der Einsamkeit. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. (zweiter Spaziergang, 1. Absatz) Diese einsamen Stunden der Betrachtung sind die einzige Zeit des Tages, wo ich völlig ich selbst bin und mir ganz ohne Ablenkung, ohne Hindernis gehöre und wo ich in Wahrheit sagen kann, ich sei das, was die Natur aus mir machen wollte. 69 „Die rêveries bezeichnen die Aktivität, die sich bei Rousseau, in und für Rousseau, von selbst einstellt, sobald sein Kopf ganz frei ist und er seiner Neigung folgen kann. Sie erfaßt ihn und erfüllt seine einsamen Spaziergänge, wenn er seinen Ideen ohne Hinderung und ohne Beschränkung nachzugehen vermag; sofern er keinem Gesetz unterliegt, niemandem Gehorsam schuldet, durch keine Pflicht gebunden und durch keinen Auftrag festgelegt ist, weder nach dem Urteil anderer Fragt noch Ansehen bei ihnen zu erwerben sucht oder sich um seine Wirkung auf Öffentlichkeit und Nachwelt sorgt.“70 Der fünfte Spaziergang in seinem kurzen Refugium am Bieler See zeigt besonders eindringlich, wie er sich in das Studium der Botanik verliert und sich dabei zugleich gewinnt. Un état, où l ’ame trouve une assiete assez solide pour s’y reposer tout entiére et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeller le passé ni d’enjamber sur l’avenir. (Ein Zustand, in dem die Seele eine hinlänglich feste Lage findet, um sich darin ganz auszuruhen, ohne in die Vergangenheit zurückblicken oder in die Zukunft vorgreifen zu müssen).71
Dieser Zustand erinnert an Schillers Formulierung „die Zeit in der Zeit aufheben“, eine Art Kontemplation oder Meditation, in der die Realität so konzentriert betrachtet wird, dass der Realitätsbezug unbedeutend wird und sich schließlich ganz verliert zugunsten der Ganzheit der Person, die so unterwegs ist.
Diese meditative Phase führt den Betrachter also offensichtlich auf sich selbst zurück, wird aber nicht in der Lage sein, die Selbstfindungsarbeit in dem Sinne zu leisten, dass das erkennen wollende Subjekt seine ganz persönlichen Vorbedingungen, seine „Höhle“, beleuchten kann.
Dieses erkennen wollende Subjekt wird sich mit der Vergangenheit und der möglichen Zukunft auseinandersetzen müssen. Um zu verstehen, warum Rousseau in diesem oben beschriebenen Zustand dennoch ein mögliches Ideal sieht, werden wir uns mit einem Begriffspaar beschäftigen müssen, das sein ganzes Werk durchzieht und das uns auch bei der Frage nach dem Weg zum Ziel der sozialen Plastik weiterhelfen wird. Es geht um „amour de soi“ und „amour-propre“, von Meier mit „Selbstliebe“ und „Eigenliebe“ übersetzt. Eine deutlichere Sprache sprechen die Begriffe„Selbst-Liebe“ und „Selbst-Sucht“. Mit ihnen will ich arbeiten.
8. Selbst-Liebe und Selbst-Sucht
Es ist keine leichte Aufgabe, das vielfältige Gedankengebäude Rousseaus mit wenigen Federstrichen zu zeichnen.72 Wir müssen uns auf die Grundgedanken beschränken, die für unsere Arbeit zielführend sind. Rousseaus Anthropologie unterscheidet zwei grundsätzliche mensch-liche Einstellungen, die Selbstliebe (amour de soi) und die Selbstsucht (amour-propre) und in geschichtsphilosophischer Hinsicht drei Entwicklungszustände : den Naturzustand, den gesell- schaftlichen Zustand und – als konkrete Utopie - den Gemeinwillen (die volonté générale). Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten – L’homme est né libre, et partout il est dans les fers – mit diesen oft zitierten Worten beginnt des erste Kapitel des politischen Hauptwerkes Der Gesellschaftsvertrag (Du contrat social). Als im Naturzustand frei Geborener ist der Mensch – von der Selbstliebe geprägt - von Natur aus gut und ist in der Lage, Mitleid zu empfinden (wir würden heute eher von Empathie sprechen). Diese Gutheit (bonté) ist allerdings unbewusst. Das Bewusstsein in Form des Verstandes (ratio) entwickelt sich erst mit Problem-stellungen (Naturkatastrophen, Überbevölkerung etc.), die zwecks einer Lösung nach gesell- schaftlichen Strukturen verlangen, und mit der Ratio verändert sich die natürliche Selbstliebe (amour de soi) zur unnatürlichen Selbstsucht (amour- propre). Der Mensch, vorher in die natürliche Ordnung eingebettet, beginnt, auf seinen eigenen Vorteil hin aktiv zu werden, und das ist die Grundlage des Konkurrenzkampfes der bürgerlichen Gesellschaft. Rousseaus Hoffnung, dieses Schlachtfeld verlassen zu können, liegt auf dem Potential der Vernunft (intellectus), die über die Einsicht in die Chancen, die in der Solidarität liegen, zu einem gemeinsamen Handeln führt, das vergleichbar mit der Zielsetzung der sozialen Plastik bei Beuys ist.
Rousseau entwirft einen Weg dorthin, doch bevor wir uns dem zuwenden, klären wir erst die Frage, warum der späte Rousseau erst über die Einsamkeit der Spaziergänge (solitaire) zu sich selbst findet. Rousseau ist zeitlebens wegen seiner Schriften (wegen seiner pädagogischen und politischen Ansichten, vor allem aber wegen seines Verhältnisses der Religion gegenüber) ver- folgt worden und befand sich ständig auf der Flucht, und je mehr er sich seinen Gegnern gegen- über zu erklären versuchte, desto heftiger wurden die Anfeindungen. Der letztliche Rückzug in die Einsamkeit von Kontemplation und Meditation ist also die Folge des Ausweichen-Wollens vor diesen seinen aggressiven Gegnern.
Rousseau versteht sich selbst als l’homme de la nature éclairé par la raison, was Heinrich Meier zu der Feststellung veranlasst : „Er stellt die größte Annäherung des Menschen an die Natur dar, die unter den Bedingungen der Soziabilität möglich ist.“73 Rousseau muss sich aber eingestehen, dass unter den Bedingungen des Existenz-Kampfes, in dem er sich befindet, er selbst Formen des amour-propre ausbildet. Hierin liegt der Grund für seinen Rückzug in die bezaubernden Kontemplationen 74 seiner vom Konkurrenzkampf entbundenen Selbstverwirk- lichung. Ich hatte nie einen sonderlichen Hang zur Selbstsucht, allein, diese erkünstelte Leidenschaft hatte sich bei mir im Umgang mit der Welt und hauptsächlich , seit ich Autor war, vermehrt, und ich hatte vielleicht immer noch weniger als andere, aber ich hatte immerhin genug. Die schrecklichen Lehren, die ich erhielt, schränkten sie bald wieder in ihre früheren Grenzen ein; zuerst empörte sie sich gegen die Ungerechtigkeit, und schließlich verachtete sie sie. Als sie sich in meine Seele zurückschmiegte und alle äußeren Beziehungen abschnitt, die sie anspruchsvoll machen, allen Vergleichen und Vorzügen entsagte, begnügte sie sich mit dem Bewußtsein meiner inneren Güte, und als sie dann wieder Selbstliebe wurde, kehrte sie in die natürliche Ordnung zurück und hat mich von dem Joch der Meinungen befreit.75
Diese Art der Befreiung vom „Joch der Meinungen“ führt zu einer selbstgenügsamen Einkehr in sich selbst. Diese kann aber im Hinblick auf die gewünschte Erarbeitung einer sozialen Plastik nicht zielführend sein; dazu bedarf es einer Vielfalt an individuellen Meinungen, die miteinander ins Gespräch kommen (wie noch zu zeigen sein wird). Wir werden einen anderen Weg suchen müssen, um über die geforderte Selbsterkenntnis, d.h. über die Klärung der ganz persönlichen Voraus-Setzungen, zu einer tragfähigen gemeinsamen Lösung zu kommen. Einen solchen Weg hat Rousseau in seinem Hauptwerk paradigmatisch entwickelt, bevor er sich am Ende seines Lebens in die Einsamkeit des kontemplativen Spaziergängers zurückgezogen hat.
Halten wir fest : Es bedarf der Selbstreflexion auf den bisherigen eigenen Weg, aber nicht im Sinne eines kontemplativen Rückzugs aus der Gesellschaft, sondern im Sinne einer Basis für die weiteren Erkenntnisschritte. Der einsame Spaziergänger muss sich der harten gesellschaftlichen Realität stellen.
9. Der Citoyen als être rélatif
Oben (S. 16) ist davon gesprochen worden, dass derjenige, der seine Existenz als absolut zu setzen versucht, gegen die Menschenwürde verstößt, da unter diesen Bedingungen Solidarität nicht möglich sei. Das ist, was die inhaltliche Füllung des Begriffs „Menschenwürde“ angeht, eine Setzung, und Rousseau hat sie vollzogen. Und er hat eine Begründung geliefert : Hinter dem Bestreben, sich absolut zu setzen, steht der Antrieb des amour-propre, des großen Motors der bürgerlichen Gesellschaft. Diese ist egoistisch-utilitaristisch ausgerichtet, d.h. am Eigeninteresse und dem Nutzen orientiert (geleitet von der Ratio, dem berechnenden Verstand). Deren Aufhe- bung geht nur über ein übergeordnetes Kontrollorgan, und das ist für Rousseau (wie für viele andere Philosophen) die Vernunft (der Intellectus). Auch wenn Rousseau diese exakte begriff-liche Differenzierung dem Buchstaben nach nicht durchführt, sondern in beiden Fällen von Raison spricht, kann man diese Unterscheidung dem Sinne nach zu Hilfe nehmen, deren Über- lieferung aus dem Bereich der Theologie Allgemeinplatz war.76
Die „Selbstliebe“ hat bei Rousseau zwei Dimensionen : zunächst die physische und in der Folge die geistige; zur Bescheidenheit der ersteren, natürlichen führt kein Weg zurück (weshalb die Zuordnung der Devise „Zurück zur Natur“ auf Rousseau nicht zutrifft77 ), zur konkreten Utopie der zweiten führt die Hoffnung. „Während die physische Selbstliebe durch die mit dem Zusammenleben auftretenden Hindernisse abgebogen und in die ‚böse‘ Selbstsucht (amour-propre) pervertiert wird, entsteht die andere Art der Selbtliebe erst mit dem Erwachen eines geistigen Selbst(-bewußtseins) im Menschen.“78
Was haben die in Anmerkung 77 erwähnten „Einsichten“ und „Tugenden“ mit der Erschaffung einer „Sozialen Plastik“ zu tun, und was heißt es, sie zu „lehren“ ? Eine erste Einsicht ist die der Beuyssche Plastik von 1979 : Mensch, du hast die Kraft zu deiner Selbstbestimmung, und das schließt „Selbstverwaltung“79 mit ein. Kann man das, was mit dem „Selbst“ zu tun hat, „lehren“ ? Man kann es beispielhaft vor-leben, und das haben Beuys und seine Anhänger mit der Aktion „Direkte Demokratie“ versucht mit einem Info-Büro in Düsseldorf, mit eingestanden nicht zufriedenstellendem Erfolg : Wir haben leider nicht genügend Leute gefunden, die den Ort, an dem das stattfindet, mit richtigem Leben füllen. (…) Wir sind ja nicht entmutigt. Wir haben auch nicht resigniert. Wir stellen nur fest, daß in absehbarer Zeit an dieser Stelle etwas anderes getan werden muß. 80
Was getan werden muss / sollte, zeigt Rousseau in seinem Contrat Social beispielhaft auf. Zielt der Mensch auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung, so hat er das, was in der Gesellschaft seiner Wahl zu tun ist, in einem ersten Schritt als Souverän selbst zu entscheiden und in einem zweiten Schritt als Sujet, als Untertan sozusagen, in die Praxis umzusetzen. Der Mensch ist Souverän und Sujet in einer Person. Er verzichtet darauf, seine Person und ihre Ansprüche absolut zu setzen, und gliedert sich sowohl bei der Beschlussfassung wie bei deren Umsetzung als être rélatif - als unverzichtbares Element - in das Ganze der Gemeinschaft und deren Gemeinwillen (volonté générale) ein. Der in der Mehrheitsdemokratie bloß quantitativ gewichtete Wille aller (volonté de tous) wird transzendiert. „Aus einer durch agrégation geschaffenen multitude von absoluten physischen Einzelwesen ist durch association (durch Vergemeinschaftung, würde ich sagen) ein peuple geworden, das aus ‚moralischen‘ Citoyens besteht, deren relative Existenz nur in der und durch die Teilhabe am Ganzen besteht. Die so geschaffene Republik (oder Cité) heißt als ‚aktive‘ Souverän und als ‚passive‘ Staat.“81
Es wird also diskutiert mit dem Ziel, zu einer gemeinsamen Überzeugung zu kommen, die unter den gegenwärtigen Umständen die akzeptierteste ist – jenseits aller Partikularwillen und deren utilitaristischer Zusammenrottung in Parteiinteressen in der Mehrheitsdemokratie. Es geht also nicht um eine „Debatte“ (fr. debattre = kämpfen), sondern um einen nach allen Seiten hin offenen Diskurs. Die „Tugend“ (vertu) besteht nach Rousseau darin, es zu wagen, seine eigene Meinung offen auszusprechen (die Vielfalt gerade abweichender Meinungen ist hier besonders fruchtbar) und zugleich zuzuhören, zu versuchen, den anderen zu verstehen, denn – wie die Hermeneutiker nicht aufhören zusagen – „er könnte ja recht haben“. Das impliziert, dass man sich zuvor um die Erforschung des eigenen Selbst bemüht hat, um die eigene Beschränktheit (die jedem Individuum in seiner Höhle zu eigen ist) zu durchschauen. Das impliziert auch, dass man eine andere als die auf das Sich-Durchsetzen ausgerichtete Sprache spricht. Dazu bedarf es von vornherein des Anderen, über den ich zu mir selbst komme. Rousseaus einsamer Spazier-gänger, der eine ganz andere Intention hat, ist hier nicht gefragt. Selbst-Erkenntnis und Erarbei-tung des Diskurses sind von ihrem Wesen her auf Kommunikation angelegt.
„Diese Suche nach dem Eigenen, nach der eigenen Sprache, der eigenen Wahrheit, führt zunächst in die Fremde, d.h. sie führt über das Verstehen anderer. Das Eigene zeigt sich zuerst ex negativo, im Fremden. Doch in dieser - noch so schönen - Fremde sollen wir nicht bleiben.
(…) Eine leichtgebauete Brücke (Hölderlin) zwischen den Menschen (…) könnte ja die Sprache, das Wort sein. Verstehen heißt, sich hinüber, an die Stelle des anderen begeben; es ist auch ein Hinübergehen und Wiederkehren. Nicht ein jedes Sprechen ist aber eine solche Brücke : Nur die Verständigung, die des Abgrundes (über den Abgrund weg – Hölderlin) zwischen dem Sprechenden und dem Hörenden gewahr ist, die das Getrenntsein, das je Eigene nicht leugnet, baut jene leichten Brücken, über die zu gehen Mut erfordert. (…) Beuys hatte diesen Mut.“82
Hölderlin nennt das nicht einen ‚Diskurs‘, sondern ‚Gespräch‘. Es stellt in seiner Fragilität noch höhere Ansprüche an die Gesprächs-Teilhaber; beide Formen aber beanspruchen den Verzicht auf jeden Ansatz von Herrschaft und Knechtschaft. So treffen der erweiterte Kunst-begriff und das um vielseitige Offenheit bemühte vagabundierende Denken erfolgreich zusammen.
10. „Das offene Tor am anderen Ende“. Konjektur und Perspicuitas.
Die präferierten Modelle sind ausgewählt und vorgestellt worden : in der theoretischen Grundlegung das vagabundierende Denken und der erweiterte Kunstbegriff, in der praktischen Ausprägung Rousseaus Ansatz bei der volonté générale. Innerhalb dieses Bereichs, so der beispielgebende Vorschlag dieser Arbeit, kann erfolgreich an die Erarbeitung einer gesellschafts- verändernden „sozialen Plastik“ gegangen werden. Ob diese Arbeitshypothese zutreffend ist, sollte der Probierstein der Praxis erweisen.
Das Wie der praktischen Bewältigung der Aufgabe hält aber noch Fragen zu dem geforderten Diskurs (oder sogar Gespräch) bereit. Wenn es stimmt, dass a) jede vermeintliche einzelne Er- kenntnis nur individuelle Interpretation ist (vgl. S. 2) und b) jeder Versuch, das Gesamtgefüge dessen, was ist, zu erfassen, scheitern muss (vgl. S. 3), wie können die Gesprächspartner, selbst wenn sie zum offenen Gespräch bereit sind (vertu), das Problem „abzumildern“ versuchen, indem sie sich Impulsen von außen öffnen (vgl. S. 4) ? Mit diesen Fragen sind wir im einem Bereich, in dem es keine fertigen Antworten oder gar Rezepte gibt. Hier ist Einfühlungsvermö- gen gefragt derart, dass man vorsichtig, aber eben doch zielstrebig verfährt. Es geht hier um Ein-Sichten, die in der Praxis auf die Probe gestellt werden oder bereits gestellt worden sind.
Auf sie dürfen wir uns nach der Vorgehensweise des vagabundierenden Denkens verlassen.
Es gibt ein erprobtes Mittel, das Anwendung findet, wenn das Ziel nicht letztgültig erreich- bar ist, aber viele Quellen, die gebraucht werden können, vorhanden sind : die Konjektur. Wir kennen diese Methode aus der Editionspraxis von Texten, die vom Autor nicht autorisiert wor-den sind, nicht fertiggestellt wurden oder in verschiedenen Fassungen vorliegen. Dann wird der Herausgeber gezwungen sein, (mit Begründung) die seiner Ansicht nach mutmaßlich „richtige“ Version zu erstellen (coniectura = Vermutung, Deutung). Die Konjektur folgt einer begründeten Mutmaßung.83 Bekannter Vertreter dieser Methode ist gegen Ende des 15. Jahrhunderts der Kardinal Niko-laus von Kues („De coniecturis“ 1440). Er spricht von der „Ars coniecturalis“, der „Kunst der Vermutung“. Wir folgen für einen Moment der sehr gut strukturierten Erläuterung des Werkes durch Ekkehart Meffert84: Cusanus begründet „aus der Einsicht in die ‚konjekturale Natur‘ des menschlichen Erkennens als einer ‚progressiven Annäherung‘ an die unendliche Wahrheit die ‚Erkenntnisdynamik‘. Gerade weil das Erkennen Annäherung ist, ist es auch einer ‚unaufhörlichen Steigerung‘ fähig. Nur der menschliche Geist hat das Besondere und Einzig-artige für sich, daß er sich nie genug ist, daß er ständig weiter strebt, ewig in Bewegung begriffen ist, von einer Vermutung zur nächst genaueren Vermutung fortschreitet. Erkennen ist für Cusanus daher niemals statisch-dogmatisch, sondern immer progressiv-dynamisch, d.h. eine sich stets steigernde Vermutung, die keine Erkenntnisgrenzen kennt.“ Das Zitat könnte einem Lehrbuch für das „vagabundierende Denken“ entnommen sein, wenn es auch eine gewagte Setzung ist, gleich von einer „konjekturalen Natur“ des Menschen zu sprechen. Wichtig ist, dass der Prozess der sich steigernden Vermutung „keineswegs richtungslos“ ist, „denn in all unseren Vermutungen lebt auf jeder Stufe etwas vom Geistigen, vom Unendlichen, von der Wahrheit selbst“.
Diese Ausführungen zeigen, dass der Versuch, über eine Konjektur in ein vorläufiges Ziel zu kommen, keine harmlose Abendunterhaltung, sondern Arbeit ist (im Sinne Hegels) und dass wir gefordert sind, uns zu bemühen, gemeinsam zu „studieren“ (studere = sich bemühen). Was wir zur Basis haben, sind Phänomene, die wir als Reize von außen vorfinden, die unser individuelles Höhlen-Bewusstsein erhellen könnten. Rechnen wir sie hoch und vergleichen wir sie mit anderen Bewohnern ihrer ebenfalls je eigenen Höhle, können wir zu einer gemeinsamen Mutmaßung kommen, die - wird sie z.B. in einer Volksversammlung als vorläufiges gemeinsames Ergebnis akzeptiert – so lange Gültigkeit besitzt, bis die Vermutung, sich stetig steigernd (s.o.), zu einer erweiterten Mutmaßung Anlaß gibt. Wichtig ist die Einsicht in die grundsätzliche Fehlbarkeit menschlichen Wissens gegenüber dem, was wir in einer langen philosophiegeschichtlichen Überlieferung „Wahrheit“ nennen.
Mit diesem reduzierten und dennoch anspruchsvollen Wollen treffen die Gesprächspartner aufeinander, wohl wissend : „Die Konjektur enthält explizit einen internen Bruch. Im Hinblick auf Geltungsansprüche riskiert die sprachliche Auffälligkeit Äußerungen, d.h. versieht sie mit Indikatoren eines Geltungsanspruchs durch einen Sprecher und schränkt diesen Anspruch zu- nächst auf diesen Sprecher ein; der Rezipient (hier der Gesprächspartner) wird auf diese Weise von vorne herein in Selbständigkeit und potentiell kritischer Distanz gehalten, die die Bedingung der Möglichkeit von Konsens ist.“85 Dank der Vorgehensweise der Konjektur ist es möglich, sowohl im Bereich des empirisch Wahrnehmbaren wie im Bereich des unsere Sinneserfahrung transzendierenden und damit für uns ungreifbaren, meta-physischen Feldes zu gültigen Ergebnissen zu kommen – unter dem Vorbehalt, dass es eine vorübergehende Gültigkeit ist und auf die Zahl derer, die an der Kon- jektur mitgewirkt haben, beschränkt bleibt. Im dezentralen Denken Rousseaus können die für eine Gruppe gültigen „Erkenntnisse“ über einen netzwerkartigen Austausch mit anderen Gruppen zu einem neuen Gespräch der Gruppen untereinander führen – je besser dies gelingt, desto weniger Aggression wird gezüchtet, desto weniger besteht die Gefahr eines wachsenden amour-propre. Karl Popper : „Wir müssen lernen, unsere Theorien umzubringen statt uns selbst.“
Die Anwendung der Konjektur will geübt sein, und die um eine Lösung der anstehenden Fragen Bemühten werden auf bewährte Vorgehensweisen, Hilfsmittel, Methoden zurückgreifen müssen. Die Beschreibung eines dieser möglichen Hilfsmittel soll diese Arbeit abschließen; ich nenne es die Perspicuitas. Aber meine Auffassung dieses Begriffs steht in einem gewissen Widerspruch zur üblichen Verwendung. Übersetzt wird der Begriff fast durchgehend mit „Klarheit“, während ich, auf die lateinischen Wurzeln zurückgreifen, von „durch-schauen“ sprechen möchte. Die Gleichung Perspicuitas = Klarheit stammt aus dem Bereich der Rhetorik und meint eines der vier Stilideale, die der erfolgreiche Redner zu beachten habe, wolle er „die sprachliche Realisierung der zuvor in der ‚inventio‘ gefundenen und in der ‚dispositio‘ geordne- ten Gedanken“ „vollbringen“.86 Die Wortwahl macht mich nach-denklich : nichts gegen ‚inventio‘ (wenn darunter das Aufsuchen und Finden der zur Darstellung kommenden Möglich- keiten verstanden wird), auch nichts gegen die ‚dispositio‘ (wenn damit die der Sache und dem Verständnis des Empfängers dienende Anordnung der Gedanken gemeint ist – solange eine Vielzahl an Dispositionen erlaubt ist) – doch was meint ‚vollbringen‘? Ich fürchte, damit ist das erfolgreich gesteuerte An-den-Mann-Bringen einer Botschaft allein im Sinne der Interessen des Senders intendiert. Diese Befürchtung wird sogleich bestätigt, wenn es wenige Zeilen später heißt, das Gegenteil der geschätzten Perspicuitas sei die ‚Obscuritas‘ im Sinne der Dunkelheit, die sich einstelle, wenn der Text nicht nur eine, sondern mehrere Auslegungsmöglichkeiten zulasse. Damit wird ein Vertreter des vagabundierenden Denkens nichts anfangen können, im Gegenteil. Daher geht die Perspicuitas bei ihm nicht auf Ein-Deutigkeit, sondern ganz im Sinne unserer Begrenztheit angesichts des von uns niemals endgültig auszulotenden (s.o.) Labyrinths potentieller Wahr-Nehmungen auf einen Aspekt, meinen Aspekt, also auf meine individuelle Hin-Sicht im Rahmen viel-fältiger und damit viel-deutiger Möglichkeiten.
In unserem Verständnis meint die Perspicuitas das Durchsichtig- und damit Sichtbar-Machen von etwas, was eben gerade nicht so ein-deutig vor Augen liegt. Auf diese Weise bemüht man sich, etwas aufzuhellen und versuchsweise im „Licht der Wahrheit“ zu sehen – und zwar als individuellen Versuch, den man dann im Gespräch mit den Anderen zur Konjektur stellt. Die Perspicuitas durchdringt und durchschaut also das, was immer schon vor Augen liegt, auf das hin, was zunächst unsichtbar ist, bei näherem, intensiverem Wahr-Nehmen aber das Sichtbare erst im eigentlichen Sinne sichtbar macht. Ja, das so verstandene Unsichtbare bringt erst die Einsicht einer möglichen Gesamtordnung hervor.
Jean-Luc Marion wählt in seinem Aufsatz „Das Überkreuzen des Sichtbaren und des Unsicht-baren“ aus seinem Buch „Die Öffnung des Sichtbaren“87 den Terminus „perspektivischer Blick“, der uns in dieser Arbeit schon begegnet ist : „Der perspektivische Blick spaltet als ein alltäg-licher Samson das Sichtbare durch die gleichwertige Kraft des Unsichtbaren, so dass er es uns weiträumig, bewohnbar macht, organisiert. Der perspektivische Blick höhlt das Sichtbare aus, um darin die unsichtbare Distanz einzuführen, die es anvisierbar (visable) und vor allem einfach sichtbar macht. Der Blick flößt dem Sichtbaren das Unsichtbare ein, sicherlich nicht, um es weniger sichtbar, sondern im Gegenteil, um es sichtbarer zu machen : anstatt chaotisch unför-mige Impressionen zu empfinden, sehen wir darin die Sichtbarkeit der Dinge selbst. Das Unsichtbare und nur dieses macht folglich das Sichtbare real.“88
Das klingt alles sehr abgehoben und theoretisch; daher soll es an einem konkreten Beispiel illustriert werden (ein solches Beispiel individueller Art ist erforderlich, da wir uns nunmehr im Bereich individueller Höhlenerfahrungen bewegen). Nehmen wir an, ich sitze in meinem Garten mittlerer Größe, an sich also überschaubar, der sich im Laufe der letzten 40 Jahre von einer puren Rasenfläche zu einer mit vielfältigen Pflanzen dicht bewachsenen und damit auf den ersten Blick unübersichtlichen Oase mit mehreren Ruheplätzen entwickelt hat. Je nach Perspektive des Ruheplatzes bietet der Garten einen vollständig anderen Anblick. Wenn ich jetzt zum Platz unter dem Mispelbaum in der Nähe des Teiches gehe und von dort aus meine Umgebung zu erfassen und zu bestimmen versuche, bieten sich mir verschiedene Denk-Wege, basierend auf unter-schiedlichen Denk-Modellen, an. Die von Marion am weitesten entfernte Erkenntnistheorie ist die des strengen Empirikers, der sich auf das beschränkt (und verlässt), was er mit seinen Sinnesorganen fest-stellt. Deshalb sprechen wir in den Zusammenhang auch von einem Positivisten. Was er fest-stellen kann, ist eine ungeordnete, chaotische Ansammlung von Daten (Marion : chaotisch unförmige Impressionen), vergleichbar einem auf einem Tisch ausgeschüt-teten Haufen von Puzzle-Teilen ohne erkennbaren Sinn. Der strenge Empiriker kann nun nur additiv vorgehen – aber nach welchem Muster ? „weiträumig, bewohnbar und organisiert“ wird das Material nicht.
Ein Stück elaborierter erscheint der Ansatz des Sensualisten John Locke89, der sich zwar auch auf die Sinnesdaten stützt (äußerer Sinn - sensation), daneben aber auch von dem zusätz-lichen „inneren Sinn“ (reflection) ausgeht, der die Art der Verarbeitung der Sinnesdaten reflek- tiert und so in seine Überlegungen einbezieht. Diese Fähigkeit bringt ihn aber nicht wirklich weiter, da er auf Sinnesdaten und damit auf den Bereich des Sichtbaren angewiesen bleibt.
Max Planck, der mit seiner Quantentheorie die zu simplen Welt-Erklärungsversuche seiner bloß empirisch ausgerichteten Fachkollegen transzendiert, überrascht die Hardliner unter ihnen mit dem Hinweis auf die Not-Wendigkeit des Glaubens, der zur bloßen Materialanhäufung hinzutreten muss90: „So gewiß das feste Fundament einer jeden Wissenschaft durch das Material gebildet wird, das aus der Erfahrung stammt, ebenso sicher ist, dass nicht dies Material allein, auch nicht seine logische Verarbeitung, die eigentliche Wissenschaft ausmacht. Denn das Mate- rial ist stets lückenhaft, es besteht immer aus einzelnen, wenn auch manchmal sehr zahlreichen Teilstücken. (…) Daher muß es ergänzt und vervollständigt werden durch Ausfüllung der Lücken, und das geschieht stets nur durch Ideenverbindungen, die nicht aus der Verstandes-tätigkeit, sondern aus der Phantasie des Forschers entspringen, mag man sie nun als Glaube oder mit einem vorsichtigeren Ausdruck als Arbeitshypothese bezeichnen. Wesentlich ist, daß ihr Inhalt über das in der Erfahrung Gegebene irgendwie hinausgreift. Wie aus dem Chaos einzelner Massen ohne ordnende Kraft kein Kosmos entsteht, so kann auch aus dem Einzelmaterial der Erfahrung ohne zielbewußtes Eingreifen eines von einem befruchtenden Glauben erfüllten Geistes niemals eine wirkliche Wissenschaft erwachsen.“ Das ist ein beachtliches Eingeständnis eines Naturwissenschaftlers. Dass überhaupt von einem „Kosmos“ gesprochen wird, einem sinngebenden Ganzen also, das der reduktionistische naturwissenschaftliche Ansatz nie erfassen kann (und von seiner Intention her auch gar nicht will), ist auffallend. Mich irritiert auch, dass Planck in seinem Zitat nicht ohne (für einen Vertreter seines Fachs) erstaunlich ungreifbare, etwas blumig klingende Formulierungen auskommt („eines von einem befruchtenden Glauben erfüllten Geistes“). Immerhin ist er so dem sinngebenden Ganzen versuchsweise auf der Spur.
Kann Marion mit seinem Ansatz mehr erreichen ? Er klingt entschiedener in seinen Formulie- rungen, kann aber die in dieser Arbeit immer wieder betonten unüberschreitbaren Grenzen menschlicher Erkenntnis auch nicht übersteigen. Kehren wir also probeweise zum Beispiel des Ruheplatzes unter dem Mispelbaum in der Nähe des Teiches zurück. Ist ein Bewusstsein, das diesen Platz schon lange kennt und keine Anstrengung mehr unternehmen muss, das, was ihm begegnet, als „Garten“ zu identifizieren, vorübergehend einmal ausgeschaltet (durch einen tiefen Schlaf etwa), wird es sich beim Aufwachen zum Zwecke der Orientierung sehr schnell er-innern (Hölderlin). Stellen wir uns aber eine Erstbegegnung mit der Situation vor, so wird der davon Betroffene zunächst im Sichtbaren nach einem Orientierungs-Zugriff suchen.91 92
Den Raum (Kosmos) des Gartens wird er, wie gezeigt, auf empirischem Stück-für-Stück-Weg (mit der Beschränkung auf das Sichtbare) nicht erfassen können. Wir brauchen, laut Jean-Luc Marion, neben dem Sichtbaren die „gleichwertige Kraft“ des Unsichtbaren, die den perspekti-vischen Blick fundiert, so daß sich unserem Blick ein „organisiertes“ Ganzes anbietet. Die Vor- Stellung von Räumlichkeit verdankt der Betrachter in einem solchen Fall den sog. „Zwischen- räumen“, die unserer Suche nach Sinnesdaten unsichtbar sind, die aber den Garten als ganzen im Verhältnis zur Welt außerhalb der Hecke strukturieren helfen.
Hoimar von Ditfurth, unermüdlicher Kommunikator in Sachen Natur und Umwelt zu Beginn der achtziger Jahre, hat in einer Fernsehsendung „Über das Sehen“ zunächst auf die Rolle der über das bloße Abbilden eines Augen-Eindrucks hinausgehende Funktion des Gehirns hingewie- sen und sodann auf die Fähigkeit, über Zwischenräume, über das also, wo unsere bloße Wahr-nehmung nichts festhalten kann, die Räumlichkeit eines Gesamt-Anblicks, das sinn-gebende, fertige Puzzle, allererst zu erzeugen.
Aber auch mit diesem Versuch der Sichtbarmachung von „Unsichtbarem“ sind wir noch nicht am Ziel der Perspicuitas angelangt. Zum Zwecke der Durchsichtigkeit müssen noch die Beein- trächtigungen (positiver wie negativer Art) durch unseren „individuellen perspektivischen Blick“, durch unsere individuellen Höhlenerfahrungen und in Verbindung damit die Anwendung unserer je eigenen Sprache thematisiert werden. Was letztere angeht, so möchte ich, um die Grundsätzlichkeit des Problems aufzuzeigen, einen längeren Auszug einer Zusammenfassung, die Sprachtheorie Johann Gottfried Herders betreffend, anführen : „In letzter Instanz gibt es so viele Sprachen, wie es Erfahrungen gibt, und da in die Erfahrung sowohl etwas von der Sache als auch etwas vom Menschen eingeht, gibt es so viele Sprachen, wie es Ich-Welt-Konstellationen gibt. Präziser : Jeder spezifisch räumlich-zeitliche Weltabschnitt wird von jedem Individuum nach eigener Gefühlsart und Denkart (…) individuell erfahren und kann deshalb nur mit einer individuellen, dieser spezifischen Konstel-lation angemessenen Sprache treffend ausgedrückt werden. Jeder Mensch fühlt in ein und derselben Situation nie genau dasselbe wie ein anderer, sondern jeder bemerkt im Ozean der Eindrücke entsprechend seinem individuellen Standort und seiner Individualität etwas Unter-schiedliches, d.h. jeder erfindet selbst seine Sprache.“93 Herders Lösungsansatz aus diesem Dilemma lautet : Je mehr er nun Erfahrungen samlet, verschiedne Dinge und von verschiednen Seiten kennenlernt, desto reicher wird seine Sprache ! 94 Hier zeigt sich der positive Einfluss der Bewusstseinserweiterung durch das vagabundierende Denken – durchaus im Sinne der Perspi-cuitas.
Was erstere angeht (die individuellen Höhlenerfahrungen des Betrachters), so kann hier an dieser Stelle wieder nur ein dementsprechend individuelles Beispiel gegeben werden : Wäre ich der Betrachter und hätte das Bild „Garten“ vor Augen, so würden sich augenblicklich nur mir eigene Assoziationen einstellen. Ich bin ein Freund des Gartens und sehe in ihm – wie aus der Literatur bekannt95 - eine Art von Kompensation des Verlustes, den die Menschen bei der Vertreibung aus dem Paradies des Gartens Eden erlitten haben. Und ich werde, das weiß ich aus Erfahrung, bei Berührung des Paradies-Bildes an die Zeilen von Edgar Wind denken, die sich mir tief eingeprägt haben : Having eaten from the tree of knowledge / we cannot slip backwards into paradise; / the gate is locked and the angel behind us, / but the garden may be open at the opposite end. (Art and anarchy)
Dieses Bild des Engels prägt mein Bewusstsein, auch wenn ich kein religiöser Mensch bin. Es gehört zu meinem Höhlen-Erbe und bestimmt meine Wahrnehmung mit – unsichtbar. Ob Marion auch diese Unsichtbarkeit gemeint hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Sein Ansatz ist aber ein kunst-geschichtlicher und damit auf die Bildbetrachtung hin ausgerichtet. Da diese auf Interpretation angewiesen ist, übernehme ich diesen Ansatz für das Bild „Garten“, bei dessen Bestimmung das individuelle Bewusstsein eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Bemüht zu sein, dieses über den Austausch des vagabundierenden Denkens in ein Gespräch einzubringen, verspricht – vorausgesetzt, er geschieht wechselseitig – eine polyvalente Chance, das Bild in seiner weiteren Be-Deutung auszuloten. Ein Aspekt ergibt dabei den anderen, und bald werden weitere Bilder als Gesprächspartner hinzukommen.
Ein solcher Gesprächspartner – bezogen auf das Paradies-Gedicht - wäre sogleich zur Stelle : Heinrich von Kleist mit seinen Überlegungen zum „Marionettentheater“ : Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien auf der einen Seite eines Puncts, nach dem Durchgang durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder dicht vor uns tritt : so findet sich auch, wenn die Erkenntniß gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein (…). Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen ? 96
Clemens Heselhaus greift dieses „Kleistsche Paradox“ in seinem gleichnamigen Text auf :
„Die Figur des Kleistschen Paradox ist demnach eine Formel für die schwebende Vereinigung von etwas Widersprüchlichem, und sie enthält ein Moment der Spannung und des unendlichen Progreß, indem die Neugier auf die Lösung des Widerspruchs gerichtet bleibt. Insofern ist das Paradox der Struktur nach die eigentliche und vielleicht einzige offene Form.“97 Ein Paradox enthält einen vermeintlichen „Widerspruch“, der unter anderen Hinsichten aufgelöst werden kann und so zum Staunen und zu differenzierteren Einsichten Anlass gibt. Diese „Spannung“ und der immanente „unendliche Progreß“ veranlassen dazu, den Weg zur ‚Lösung‘ als sinnvoll anzusehen und zu suchen. Das Denken wird angeregt, und Denken ist nach Beuys = Plastik im Sinne des Durchgebildeten und im Sinne der intendierten sozialen Plastik. Hier zeigt sich noch einmal das Potential, das in unseren individuellen Höhlen-Erfahrungen steckt.
Stefan Mezger entdeckt ähnliche Potentiale bei Herders Metapher-Begriff : „Die Metapher bringt verschiedene Kontexte oder Perspektiven in Austausch und korrespondiert darin der Interdiskursivität der Konjektur.“98 Das zeigt an, dass der von uns herausgearbeitete Konjektur-Begriff, durch die Perspicuitas verstärkt, lediglich als ein beispiel-gebendes Modell anzusehen ist, das eine Ergänzung durch andere Techniken gut verträgt. Das entspricht dem Grundgedanken des vagabundierenden Denkens.
Literarurliste
Albes, Claudia, Der Spaziergang als Erzählmodell , Marburg 1999
Bacon, Francis, Novum Organum, London 1920
Baumeister, Willi, Das Unbekannte in der Kunst, Köln 1988
Burgbacher-Krupka, Prophete rechts Prophete links Joseph Beuys, Nürnberg 1977 von Eltz-Hoffmann, Lieselotte, Das Paradies als Garten oder der Garten als Paradies, Kulturgeschichtliche Studie, Nordhausen 2011
Fetscher, Iring, Rousseaus politische Philosophie, Frankfurt 1975
FIU Kassel, Die unsichtbare Skulptur. Zum erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys, Stuttgart 1989
Franck, Doro, „Vaterländische Gesänge. Joseph Beuys und Friedrich Hölderlin, in : FIU Kassel, Die unsichtbare Skulptur, Stuttgart 1989
Grimm, Deutsches Wörterbuch in 33 Bänden, München 1984
Harlan, Volker, Was ist Kunst ? Werkstattgespräche mit Beuys, Stuttgart 1988
Harlan Rappmann Schata, Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys, Achberg 1984
Hegel, G.W.F., Theorie Werkausgabe, Frankfurt 1970
Heidt, Wilfried, Die Umstülpung des demiurgischen Prinzips, in : FIU Kassel, Die unsichtbare Skulptur, Stuttgart 1989
Herzogenrath, Wulf (Hrg.), Selbstdarstellung, Künstler über sich, Düsseldorf 1983
Hölderlin, Friedrich, Werke, Frankfurter Ausgabe, Frankfurt, 1975 ff.
Hölderlin, Friedrich, Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe, Stuttgart 1943 ff.
Hölderlin, Friedrich, Sämtliche Werke und Briefe, München 1970
Kant, Immanuel, Werke, Darmstadt
Kiesel, Arthur, Wir sehen nur Schatten, Leipzig 1933
Kleist, Heinrich von, Brandenburger Ausgabe (Hrg : Roland Reuß, Peter Staengle), hier : Berliner Abendblätter I, Frankfurt / Main 1997
Koepplin, Dieter, The secret block for a secret person in Ireland, in : Joseph Beuys, The secret block (Hrg. Heiner Bastian), München 1988
Locke, John, An essay concerning human understanding, London 1690
Marion, Jean-Luc, Die Öffnung des Sichtbaren, Paderborn 2005
Meffert, Ekkehard, Nikolaus von Kues. Sein Lebensgang, seine Lehre vom Geist, Stuttgart 1982
Meier, Heinrich, Über das Glück des philosophischen Lebens. Reflexionen zu Rousseaus Rêveries, München 2011
Metzger, Stefan, Die Konjektur des Organismus. Wahrscheinlichkeitsdenken und Performanz im späten 18. Jahrhundert, München 2002
Mollowitz, Bernd, Schiller als Philosoph in der Auseinandersetzung mit Kant, München 2008
Mollowitz, Bernd, Das Problem des Übergangs von einer Stufe des Bewusstseins zur anderen innerhalb Hegels, PhdG, Müchen 2008/2
Mollowitz, Bernd, Eigen-Sinn. Mut zu Wahr-Nehmungen, München 2012
Mollowitz, Bernd, Vagabundierendes Denken in einer schraubenförmigen Welt, München 2013
Mollowitz, Bernd, Geburt einer Denkmethode. Beobachtungen zum Verhältnis von Hölderlin und Hegel bis 1800, München 2016
Oltmann, Antje, „Der Weltstoff letztendlich ist … neu zu bilden“, Joseph Beuys für und wider die Moderne, Ostfildern 1994
Moser Schneider Gellhaus, Kopflandschaften-Landschaftsgänge. Kulturgeschichte und Poetik des Spaziergangs, Köln Weimar Wien 2007
Oman, Hiltrud, Die Kunst auf dem Weg zum Leben. Beuys, Weinheim 1988
Planck, Max, Wissenschaft und Glaube, in : Vorträge und Erinnerungen, Stuttgart 1949
Platon, Werke, Hamburg 1957
Ritter, Joachim, Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft, in : Subjektivität, Frankfurt 1974
Rousseau, J.J., 2 Bände, (Hrg. Henning Ritter), München Wien 1978
Schiller, Friedrich, Theoretische Schriften, Sämtliche Werke in 5 Bänden, Band 5, München 1975
Schnocks, Dieter, Mit C.G. Jung sich selbst verstehen, Stuttgart 2013
Semdner, Helmut, (Hrg.), Kleist Aufsatz über das Marionettentheater, Berlin 1967
Stuby, Gerhard, Recht und Solidarität im Denken von Albert Camus, Frankfurt am Main 1965
Wisby, Rainer, Das Bildungsdenken des jungen Herder, Frankfurt/Main Bern New York 1987
[...]
1 Die drei weitergehenden Fragen lauten : Was soll ich tun ? Was darf ich hoffen ? Was ist der Mensch ? Sie betreffen die philosophischen Aufgabenfelder Ethik, Religion und Anthropologie. Log. Ein. III (IV 26 f.)
2 u.a. : Mollowitz, Bernd : Vagabundierendes Denken in einer schraubenförmigen Welt 2013; Eigen-Sinn. Mut zu Wahr-Nehmungen 2012; weitere Texte finden sich auf meiner Internet-Seite unter philosophersonly.de.
3 Kiesel, Arthur (1933); so ist das erste Kapitel bereits mit der grundlegenden These überschrieben : "Weshalb die Welt, die wir wahrnehmen, nicht die wirkliche Welt ist".
4 Das "Höhlengleichnis" bildet neben "Linien-" und "Sonnengleichnis" das Zentrum in Platons Werk "Politeia".
5 Bacon, Francis, Novum Organon : Die allgemein-menschlichen Beschränkungen nennt er "idola tribus", die individuellen "idola specus", die der Sprache "idola fori" und die der weltanschaulichen Überlieferung "idola theatri".
6 Hölderlin, Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe Band 4, 216-17; zur Erläuterung vgl. Mollowitz (2016), Geburt einer Denkmethode. Beobachtungen zum Verhältnis von Hölderlin und Hegel bis 1800
7 Das Phänomen der wechselseitigen Beziehung hat Hegel im Hinblick auf das "Selbstbewusstsein“ in seiner "Phänomenologie des Geistes" herausgearbeitet. Hegel- Werke III, 145 f.
8 Iring Fetscher, 1975, 196 : „Diese ‚vertu‘ beruht auf einer seelischen Kraft und kann nur bei einigen wenigen wirklich vorausgesetzt werden.“ (Notwendigkeit der staatsbürgerlichen Erziehung)
9 Baumeister, Willi (1947), 16
10 ebd. 29
11 ebd. 25
12 Deutsches Wörterbuch Band 11, 2666 – 2684
13 Zu Schillers ästhetischen Schriften vgl. meine Arbeit „Schiller als Philosoph in der Auseinandersetzung mit Kant“ (2008); Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica (1750 / 1758)
14 Kant Werke, Band 8, 280
15 ebd. 322
16 ebd. 319
17 ebd. 298
18 Safranski 2004 (im übrigen ein sehr lesenswertes Buch)
19 Kallias-Briefe; Schiller, Sämtliche Werke V, 422
20 Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, Brief 15 : Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. (ebd. 618)
21 Die Absicht Schillers, seinen Lehrer Kant zu „ergänzen“, wird nirgendwo deutlicher als im abschließenden 27. Brief : Mitten im furchtbaren Reich der Kräfte (gemeint ist die bloß sensible Welt, die im Kampf der individuellen Neigungen besteht) und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze (gemeint ist die intelligible Welt mit dem Sittengesetz, dem kategorischen Imperativ, der als Imperativ aber immer noch einen Herr-schaftsanspruch hat) baut der ästhetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet. (ebd. 667)
22 ebd. 644
23 vgl. hierzu die „Ästhetischen Briefe“ 10 - 15
24 Der Gedankengang ist ausführlich erläutert in meiner Schiller-Arbeit (vgl. Anmerkung 13) auf den Seiten 20 f.
25 Zur Entwicklung dieser Gedanken vgl. Mollowitz, Hölderlin und Hegel – Die Geburt einer Denkmethode. Teil 1 : Der freien Meinung nur zu leben, Frieden mit der Satzung / Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehn. (2016)
26 Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe (1970), Band 1, 662
27 ebd. 557 – 559
28 ebd. 558
29 ebd. 579 (Vorrede zur letzten Fassung)
30 ebd. 559; gemeint ist das Bild einer Asymptote
31 zur näheren Erläuterung dieses Dreischritts vgl. meine Hegel-Arbeit „Das Problem des Übergangs von einer Stufe des Bewusstseins zur anderen innerhalb Hegels ‚Phänomenologie des Geistes‘“ (2008/2)
32 Hölderlin ebd. 559
33 Wenn Hiltrud Oman im Zusammenhang mit Beuys von der „Kunst als Apriori für ein vernünftig gestaltetes, humanitäres“ Leben spricht, wird die Verbindung zum Schillerschen Gedankengebäude offensichtlich. Oman, a.a.O. 71
34 in : „Die unsichtbare Skulptur. Zum erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys“, 1989 herausgegeben von der FIU Kassel, a.a.O., 55 – 64
35 beide Zitate nach Koepplin, 1988, 9
36 Burgbacher-Krupka, Prohete rechts, 177, 63
37 vgl. L. Orzechowski in : Beuys. Multiples, Bücher und Kataloge, Ausstellungs-Katalog 1975, zitiert bei Oman 105
38 Zitat aus einem Beuys-Interview mit Ludwig Rinn, zitiert bei Oltmann, a.a.O., 112
39 Beuys-Interview in : Harlan, Rappmann, Schata, Soziale Plastik, a.a.O. 17; Oltmann spricht in diesem Zu-sammenhang davon, bei Beuys sei immer der eigentlich romantische Gedanke erhalten geblieben, die Idee sei die unabdingbare Grundlage jeder materiellen Ausformung (a.a.O., 37). Diese Ablehnung des einseitigen Materialismus bringt Beuys aber nicht dazu, seine naturwissenschaftlichen Wurzeln zu verleugnen : „Beuys‘ Ziel ist es, Kunst und Wissenschaft in ein kooperatives, wechselseitiges Verhältnis zu stellen, um auf diese Weise der tödlich intellektualisierenden Eindimensionalität begrifflichen Denkens zu entgehen, die durch jene Systemsprache, in welche sich die heutigen Wissenschaften zwängen, zustande kommt.“ (Oman a.a.O., 123). Wie problematisch dieser Versuch ist, wird sich im weiteren Verlauf der Arbeit zeigen.
40 Zitat aus einem Gespräch mit Sieglinde Neuenhausen über Kunsterziehung (nach Oltmann, a.a.O., 12).
41 Beuys in Wulf Herzogenrath (Hrg), Selbstdarstellung. Künstler über sich. Düsseldorf 1983, 44
42 Beuys-Interview in ‚Kunst. Magazin für moderne Malerei – Grafik – Plastik‘, Heft 5 Mainz, Dezember 1964
43 Beuys-Interview bei Oman, 1988, 93
44 Beuys in Herzogenrath (Hrg), Selbstdarstellung, a.a.O., 33
45 in : Die unsichtbare Skulptur, a.a.O., 7 / 8
46 Oman a.a.O., 87
47 vgl. die Einleitung FIU Kassel, Die unsichtbare Skulptur, a.a.O. , 8
48 M. Jochimsen, zitiert bei Oman, a.a.O. , 85
49 vgl. Doro Franck, a.a.O., 61
50 Doro Franck, a.a.O., 61
51 Oltmann, a.a.O., 164
52 Mollowitz, 2012, 5 : „Jung meint nicht nur einen uneingeschränkten, unspezifischen Antrieb, sondern sieht in der Libido auch eine Werde-Lust.“
53 Beuys im Werkstattgespräch mit Harlan, Was ist Kunst ? a.a.O., 17/18
54 Heidt, a.a.O., 44
55 ebd. 45
56 Doro Franck, a.a.O. , 57
57 Volker Harlan, Neue Kunst eröffnet sich auf neuen Wahrnehmungsfeldern, in : Harlan Rappmann Schata, 1984, 139 - 140
58 zit. nach Dieter Schnocks, Stuttgart 2013, 31
59 Hegel, Werke 3,71
60 zit. bei Lukas Beckmann im Nachwort zu Oman, 1988, 186
61 zitiert nach Moser Schneider, 2007, 7; deren Einleitung („Zur Kulturgeschichte und Poetik des Spazier- gangs“) setzt sich mit den verschiedenen Modellen der Fortbewegung unter geschichtlichen, aber auch erkenntnistheoretischen und ästhetischen Aspekten auseinander
62 ebd. 16; vgl. auch Albes, Claudia, Der Spaziergang als Erzählmodell, 1999
63 Joseph Beuys, zitiert nach Doro Franck, a.a.O., 57
64 vgl. hierzu Joachim Ritter, Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft, 1974
65 „Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ Das Zitat des Apostels Paulus (2. Kor. 3.6) wird von Hegel bis Bonhoeffer als Zeichen der Verlebendigung aufgegriffen.
66 zur Reichweite des Begriffs des „Auslotens“ vgl. Mollowitz, 2013, 21
67 vgl. Dieter Schnocks, Mit C.G. Jung sich selbst verstehen, Stuttgart 2013; als Einstieg zu empfehlen
68 Stuby, Gerhard, 1965, 163
69 alle Übersetzungen nach der zweibändigen Ausgabe von Rousseaus Schriften, herausgegeben von Henning Ritter, München 1978
70 Heinrich Meiner, 2011, 32
71 5. Spaziergang, Ritter 1978, 699
72 Interessierte finden eine kenntnisreiche Darstellung bei Iring Fetscher, Rousseaus politische Philosophie, Frankfurt / Main 1975
73 Heinrich Meier, 2011, 60
74 zitiert nach Meier, 2011, 270
75 Übersetzung von Ritter, Band 2, 737 („Eigenliebe“ von mir durch „Selbstsucht“ ersetzt); Meier (283) : „daß es möglich sei, den amour-propre auf sich selbst zurückzubiegen und ihn gleichsam im amour de soi aufzuheben (en se repliant sur mon ame) “.
76 „Im scholastischen Sprachgebrauch unterschied man zwischen der „ratio“ als dem Vermögen diskursiven Denkens und dem „intellectus“ , der eine Wesenseinsicht, eine Art Schau der Prinzipien vermittelt.“ Iring Fetscher, 1975, 81
77 Wie aber ? Wird man die Gesellschaft zerstören, das Mein und Dein aufheben und wieder in die Wälder zurückkehren müssen, um dort mit den Bären zusammenzuleben ? Dies ist eine Folgerung, die vielleicht meine Gegner werden ziehen wollen. Ich will ihr ebenso gern zuvorkommen wie ihnen die Schande lassen, diese gezogen zu haben. (…) jene, welche überzeugt sind, daß die göttliche Stimme das ganze mensch- liche Geschlecht zu den Einsichten und zu der Glückseligkeit der himmlischen Geister gerufen hat, sie alle, sage ich, werden sich durch die Ausübung solcher Tugenden, zu welchen sie sich verpflichten, indem sie sie lehren, um den ewigen Preis bemühen, den sie dafür zu erwarten haben. (Ritter, Erster Band, 281/82)
78 Fetscher 1975, 80
79 Harlan Rappmann Scharta, 1984,11
80 ebd. 35
81 Fetscher 1975, 112
82 Doro Frank, a.a.O., 56 – 58
83 Markantestes Beispiel der Editionsgeschichte dafür ist wohl die Herausgabe der Werke Hölderlins von Beißner (Stuttgarter Ausgabe) einerseits und Sattler (Frankfurter Ausgabe) andererseits.Vgl. hierzu Beißners Vorbemerkungen des Herausgebers in Band 1,2. Hälfte, 317-21 (1943) und den Band „Einleitung Frank-furter Ausgabe“ (1975)
84 Ekkehart Meffert, Nikolaus von Kues. Sein Lebensgang. Seine Lehre vom Geist, 1982, 151
85 Metzger, 2002, 134
86 zu finden unter home.arcor.de/yerrick
87 Paderborn 2005, 27
88 vgl. zum weiteren Zusammenhang mit Marion den Artikel „Perpicuitas“ unter www.philosophersonly.de
89 John Locke, An essay concerning human understanding, 1690
90 Max Planck, Wissenschaft und Glaube, in : Vorträge und Erinnerungen, 1949, 247
91 Max Planck, Wissenschaft und Glaube, in : Vorträge und Erinnerungen, 1949, 247
92 Max Planck, Wissenschaft und Glaube, in : Vorträge und Erinnerungen, 1949, 247
93 Wisbert 1987, 319 – 320
94 zitiert nach Wisbert, ebd.
95 u.a. Lieselotte von Eltz-Hoffmann, Das Paradies als Garten oder der Garten als Paradies : Kulturgeschichtliche Studie, Nordhausen 2
96 Heinrich von Kleist, Brandenburger Ausgabe, Berliner Abendblätter 1, 330/31
97 in : Sembdner u.a., 1967, 115
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ausgangspunkt der Erkenntnistheorie laut diesem Text?
Grundlage allen Philosophierens ist Erkenntnistheorie. Bevor sie nicht ihre Arbeit verrichtet hat, ist alles weitere Reflektieren müßig. Der Philosophierende sieht sich also mit der Frage konfrontiert : "Was kann ich wissen ?"
Was bedeutet "vagabundierendes Denken" im Kontext dieses Textes?
"Unterwegs-Sein" meint ein "vagabundierendes" Vor-Gehen auf dem Weg zur Erkenntnis (der sich als vielgestaltiger herausstellen wird). Gr. "méthodos" meint diesen Weg, und so ist die Methode der vorliegenden Arbeit als "vagabundierendes Denken" zu bezeichnen.
Wie wird Wahrnehmung im Text beschrieben?
Die Basis unseres Erkennens, die Wahrnehmung, ist nur eine Wahr-Nehmung: Jeder nimmt das wahr, was seine individuelle Prägung erlaubt.
Wie wird der "herrchaftsfreie Diskurs" beschrieben?
Um den Prozess der Kommunikation gelingen zu lassen, bedarf es einer Tugend, die zum einen darin besteht, dass ich offen meine Perspektive anbiete, dass ich andererseits aber auch bereit bin, mir etwas sagen zu lassen und mich ebenso offen mit der Perspektive des anderen auseinanderzusetzen.
Was sagt Willi Baumeister über Kunst?
Willi Baumeister behauptet, dass Malerei die Kunst des Sichtbarmachens von etwas ist, das durch den Künstler erst sichtbar wird und vordem nicht vorhanden war, dem Unbekannten angehörte.
Welche lateinischen Begriffe werden im Zusammenhang mit "Kunst" genannt?
Als lateinische Äquivalent-Begriffe werden „scientia“, „ars“, „artificium“ und „machina“ genannt.
Was versteht Schiller unter "Schönheit"?
Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird. Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.
Wie betrachtet Hölderlin die Existenz des Menschen?
Laut "Vorrede zur vorletzten Fassung" des Hyperion wird die Existenz des Menschen als eine exzentrische Bahn gesehen, auf der er im Verlaufe seines Lebens seine Bewusstseinsentwicklung immer weiter ausdifferenziert.
Was ist der "erweiterte Kunstbegriff" von Joseph Beuys?
Im Verständnis des „erhöhten Sinns“ des Kunstbegriffs geht dieser bei Joseph Beuys auf ein volles, nicht partiell abgetötetes, ein aus dem Bezug zum Urwort kreatives Mensch-Sein in permanenter ‚Vorbereitung‘.
Was bedeutet der Satz "Jeder Mensch ist ein Künstler" im Kontext von Beuys?
Jeder ist nach Beuys prinzipiell in der Lage, den Kunstbegriff zu leben. Der Objektcharakter von Kunst wird radikal aufgehoben. Kunst ist Lebensvollzug.
Was ist die "Soziale Plastik"?
Die moderne Kunstdisziplin Soziale Plastik, Soziale Architektur wird erst dann in vollkommener Weise in Erscheinung treten, wenn der letzte lebende Mensch auf dieser Erde zu einem Mitgestalter, einem Plastiker oder Architekten am sozialen Organismus geworden ist.
Wie beschreibt der Text das Verhältnis von "vagabundierendem Denken" und "erweitertem Kunstbegriff"?
Beide Theorien fordern die Offenheit der Imagination des Einzelnen und zugleich seine Bereitschaft, in den Dialog einzutreten, zuzuhören, sich etwas sagen zu lassen und dazu Stellung zu beziehen.
Welche Bedeutung hat der Spaziergang bei Rousseau?
Rousseau braucht den Spaziergang und erhebt ihn sogar zum Erzählmodell seiner Autobiographien. Das Gehen fügt sich nicht dem linearen Denken, es schweift umher, es vagabundiert, es probiert aus.
Was sind "amour de soi" und "amour-propre" bei Rousseau?
"Amour de soi" (Selbstliebe) ist die natürliche Gutheit des Menschen im Naturzustand. "Amour-propre" (Selbstsucht) ist die unnatürliche, egoistische Einstellung, die mit der Entwicklung der Gesellschaft entsteht.
Wie kann die "Konjektur" in der Erkentnistheorie benutzt werden?
Die Konjektur ist eine begründete Vermutung, die als vorläufige gültige Erkenntniss gilt, solange die Mutmaßung erweitert wird. Die Teilnehmer am Gespräch mit der Konjektur müssen sich bewusst sein, dass es eine Einsicht in die grundsätzliche Fehlbarkeit menschlichen Wissens gibt.
Was bedeutet die "Perspicuitas" im Text und wie unterscheidet sie sich von der üblichen Verwendung des Begriffs?
Perspicuitas soll "durch-schauen" bedeuten. Im Verständnis des Textes meint die Perspicuitas das Durchsichtig- und damit Sichtbar-Machen von etwas, was eben gerade nicht so ein-deutig vor Augen liegt. Anders als in der Rhetorik, wo Klarheit angestrebt wird, geht es hier um die individuelle Hin-Sicht im Rahmen viel-fältiger Möglichkeiten.
- Quote paper
- Bernd Mollowitz (Author), Vagabundierendes Denken und der erweiterte Kunstbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/703171