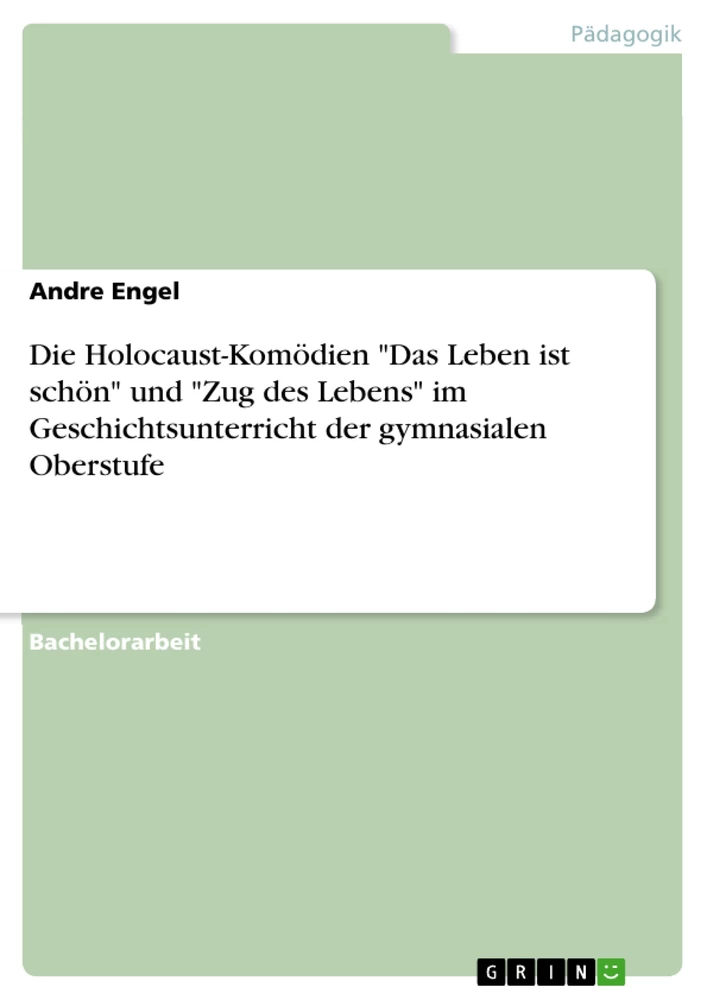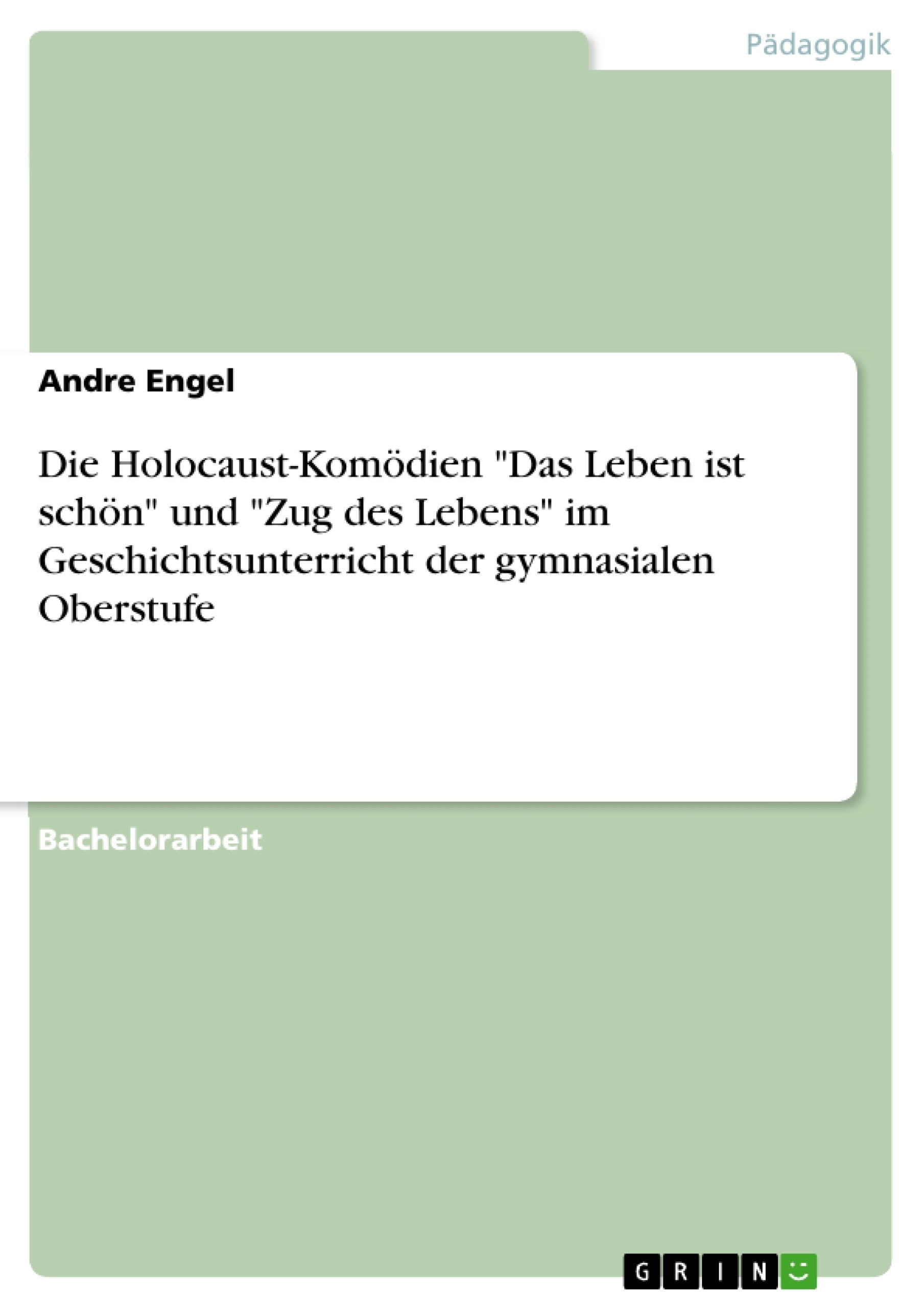Die vorliegende Bachelorarbeit wird einen eher unkonventionellen Zugang zu den Themenkomplexen Nationalsozialismus und Holocaust im Geschichtsunterricht vorstellen. Entgegen der aufgezeigten direkten Konfrontation der Schüler durch den Besuch von Gedenkstätten, der Kommunikation mit Zeitzeugen oder dem Anschauen dramatischer Filme, thematisiert diese Arbeit die Möglichkeit der humorvollen Auseinandersetzung mit dem Holocaust im Geschichtsunterricht. Die Auswahl solcher Spielfilme fällt nicht einfach, und dennoch werden im Verlauf der Arbeit zwei Holocaust-Komödien näher präsentiert und untersucht. Es handelt sich um die Filme "Das Leben ist schön" von Roberto Benigni und "Zug des Lebens" von Radu Mihaileanu, die die Basis der vorliegenden Bachelorarbeit bilden. Dabei geht es in der Arbeit ausdrücklich nicht um die detaillierte Beschreibung, wie die Filme den Holocaust präsentieren, sondern was die Komödie als Zugang zur Thematik Holocaust besonders beachtenswert für den Geschichtsunterricht macht.
Die Themenkomplexe Nationalsozialismus und Holocaust sind feste Bestandteile der Rahmenlehrpläne in den Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. Den Schülerinnen und Schülern wird ein reichhaltiges Angebot nationalsozialistischer Erinnerungskultur geboten. Der Besuch des Holocaust-Mahnmals Berlin, Ausflüge zu KZ-Gedenkstätten, Gespräche mit Zeitzeugen und vieles mehr erinnern an das Kapitel deutscher Geschichte. Die pädagogische Aufbereitung und Organisation scheint dem Aufsatz Erziehung nach Auschwitz von Theodor W. Adorno zu folgen. „Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung“, hält Adorno fest. Darstellungen wie Das Tagebuch der Anne Frank, Schindlers Liste oder Der Pianist sollen den Schülern bildliche Eindrücke von den Gegebenheiten im Dritten Reich liefern und letztlich die Motivation im Klassenverband fördern. Damit knüpft die Schule an die Medienwelt der Schüler an, denn zahlreiche Kino- und Fernsehfilme bedienen sich der Thematik Nationalsozialismus und Holocaust. Studien zeigen, dass Schüler trotz des Einsatzes „moderner“ Medien im Geschichtsunterricht der gegenwärtigen Vermittlungsformen zur Thematik Holocaust überdrüssig sind. Der Ausdruck Was gibt’s hier zu lachen? steht dabei sinnbildlich für die Art und Weise der Kommunikation im Klassenverband. Den Schülern wird vorgeführt, wie „schrecklich“, „unmenschlich“ und „unvorstellbar“ die Ausmaße des Nationalsozialismus waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Holocaust im Film
- Formen der Erinnerung: Holocaust-Film
- Zur Darstellbarkeit und filmischen Umsetzung des Holocaust
- Zur neuen Form der Holocaustdarstellung: die Filmkomödie
- Holocaust-Komödien: Das Leben ist Schön und Zug des Lebens
- Das Leben ist Schön
- Zug des Lebens
- Holocaust-Komödien als Gegenstand des Geschichtsunterrichts
- Die Thematik Holocaust im gegenwärtigen Geschichtsunterricht
- Geschichte im Film: didaktische, methodische und kritische Überlegungen
- Lernen aus der Holocaust-Komödie: Schüler sensibilisieren
- Komödie als neue Form der Erinnerungskultur – auch im Unterricht?
- Ergebnisse und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Möglichkeit der humorvollen Auseinandersetzung mit dem Holocaust im Geschichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe. Dabei werden die beiden Holocaust-Komödien „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni und „Zug des Lebens“ von Radu Mihaileanu als konkrete Beispiele für eine unkonventionelle Vermittlung des Themas herangezogen. Die Arbeit analysiert den Einsatz der Komödie als Genre im Kontext des Holocaust und stellt dessen didaktisches Potenzial im Vergleich zu traditionellen Unterrichtsmethoden in Frage.
- Die Rolle des Humors in der jüdischen Kultur
- Die ethischen und ästhetischen Herausforderungen der Holocaust-Komödie
- Die didaktischen Möglichkeiten des Einsatzes von Komödien im Geschichtsunterricht
- Die Bedeutung von Reflexion und Medienkompetenz im Umgang mit Filmen
- Die Sensibilisierung der Schüler für die narrative Dimension des Holocaust
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des Holocaust im Film, wobei die verschiedenen Formen der Erinnerung und die Debatte um die Darstellbarkeit des Holocaust im Vordergrund stehen. Im zweiten Teil werden die beiden Holocaust-Komödien „Das Leben ist schön“ und „Zug des Lebens“ detailliert vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Analyse der humorvollen Elemente und der filmischen Mittel. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich dem Einsatz von Holocaust-Komödien im Geschichtsunterricht. Hier werden die didaktischen, methodischen und kritischen Aspekte des Einsatzes dieser Filme im Kontext von Holocaust Education beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenkomplexen Holocaust, Komödie, Geschichtsunterricht, Erinnerungskultur, Film, Didaktik, Holocaust Education und Medienkompetenz. Der Fokus liegt auf der Analyse von „Das Leben ist schön“ und „Zug des Lebens“ als Beispiele für Holocaust-Komödien und deren Potential für die Vermittlung des Themas im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Darf man über den Holocaust lachen?
Die Arbeit untersucht, wie Holocaust-Komödien einen humorvollen, aber respektvollen Zugang zur Thematik ermöglichen können, um Schüler für das Thema zu sensibilisieren.
Welche Filme werden im Unterricht analysiert?
Es handelt sich um „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni und „Zug des Lebens“ von Radu Mihaileanu.
Warum sind traditionelle Lehrmethoden zum Holocaust oft problematisch?
Studien zeigen, dass Schüler der ständigen Konfrontation mit rein schrecklichen Bildern oft überdrüssig werden; Komödien können hier ein neues Interesse wecken.
Was ist das didaktische Ziel beim Einsatz dieser Filme?
Ziel ist es, Medienkompetenz zu fördern, die narrative Dimension von Geschichte zu verstehen und die Schüler auf einer emotionalen, weniger distanzierten Ebene anzusprechen.
Was forderte Theodor W. Adorno in Bezug auf Auschwitz?
Adorno hielt fest, dass die allererste Forderung an Erziehung sei, dass Auschwitz nicht noch einmal geschehe – ein Leitmotiv für den modernen Geschichtsunterricht.
- Quote paper
- Andre Engel (Author), 2011, Die Holocaust-Komödien "Das Leben ist schön" und "Zug des Lebens" im Geschichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/703278