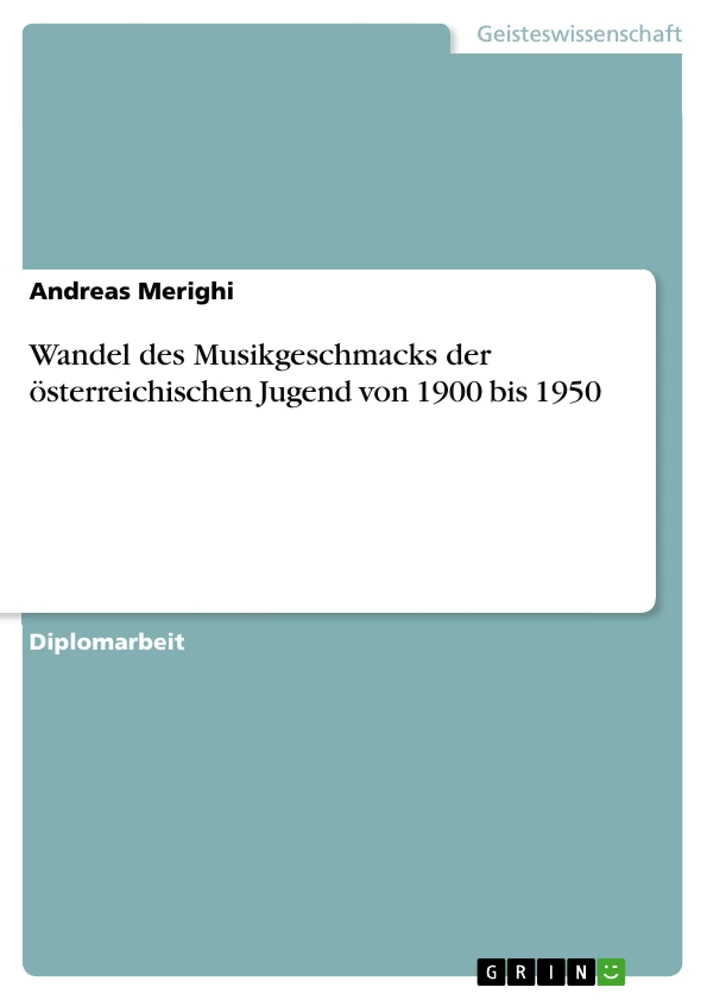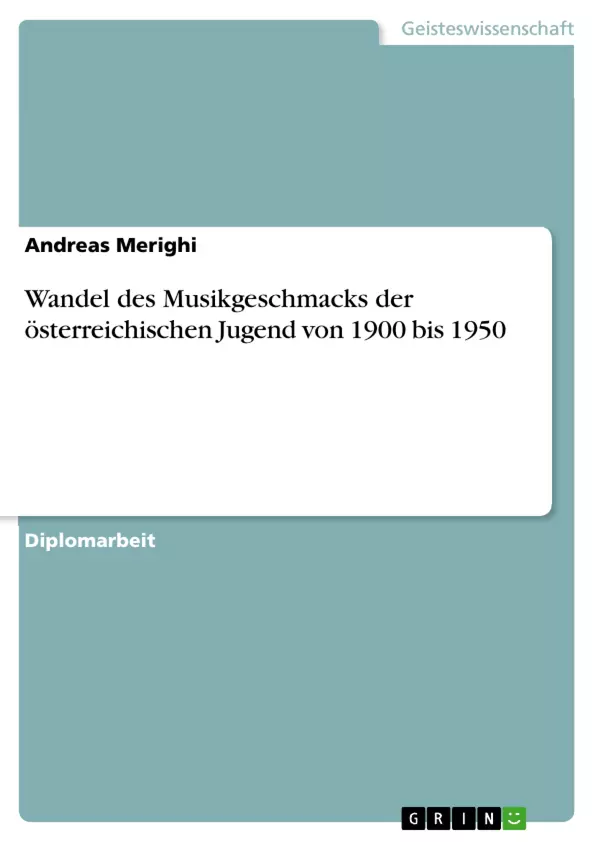Wie gelangten junge Menschen an Musik bzw. an neu aufkommende Musikstile? Als nicht minder wichtig stellte sich die Frage heraus, wie neue Musikrichtungen von der jeweiligen dominanten Elterngeneration aufgenommen wurden und inwiefern diese eine Gefährdung althergebrachter Werte und Normen bedeuteten. Anders formuliert: Wie wirkten sich die wechselnden politischen Verhältnisse auf die Hörgewohnheiten jugendlicher Musikliebhaber aus? Es war weiters von Interesse, ob Musik bereits in jenem frühen Stadium der Kommerzialisierung ihren Einfluss als Distinktionsmittel der Jugend zur Abgrenzung gegen konkurrierende Jugendgruppen, Eltern oder politische Systeme geltend machen konnte.
Ein ausgiebiger Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte von Grammophon, Schallplatte und Radio soll verdeutlichen, wie bahnbrechend sich diese Erfindungen auf die Musikrezeption auswirkten. Plötzlich konnte zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort die bevorzugte Musik gehört werden. Erstmals etablierte sich ein Markt, der Musik zum Massenkonsumgut machte, das im Laufe der Zeit für immer breitere Bevölkerungsschichten zugänglich wurde. Dem Jazz und seiner Entwicklungsgeschichte wurde deshalb viel Platz eingeräumt, da es sich um die erste massenkompatible Unterhaltungsmusik der westlichen Welt handelte. Lange bevor Rock’n’Roll die Nachkriegsjugend „befreite“, sorgten jazzähnliche Klänge und dazugehörige Modetänze aus Amerika für Wertediskussionen.
Da Österreich Anteil an der technischen Entwicklung des Radios hatte, wurde versucht, nach einer kurzen historischen Einführung, anhand einer Darstellung des österreichischen Senderausbaus und der Teilnehmerzahlen die Breitenwirkung des neuen Mediums zu ermitteln. Kulturpolitische Maßnahmen der Nationalsozialisten waren von besonderem Interesse, da sie das Musikleben der Jugend außerordentlich prägten. Wie gezeigt werden wird, ließen sich Jazz und Swing auch unter der nationalsozialistischen Diktatur nicht auslöschen und entwickelten sich zum Kennzeichen des Protests der Swing-Jugend und Schlurfs. Sofort nach der Befreiung Österreichs durch die Alliierten Truppen begann sich eine österreichische Musikszene zu entfalten. Starken Einfluss übte auf Anhieb die amerikanische Besatzungsmacht aus, deren beispielloser Propaganda von den restlichen Besatzungsmächten nichts entgegenzusetzen war. Amerikanische Soldatensender in und um Österreich herum spielten jene Musik, die sieben Jahre lang zurückgedrängt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Rückblick - Entwicklungen am Ende des 19. Jahrhunderts
- Aufzeichnungen
- Zugänglichkeit und Zäsur
- Aufzeichnungen
- Rückblick - Entwicklungen am Ende des 19. Jahrhunderts
- Volksliedpflege
- Sozialdemokratische Jugendbewegung
- Katholische Jugendgruppen
- Deutschnationale Jugend
- Der Wandervogel
- Volksliedpflege in der Zwischenkriegszeit
- Das „populäre“ Lied
- Jazz und Jazztänze – die Entwicklung
- Minstrel Shows und Ragtime
- Der Cakewalk
- Der Weg nach Europa
- Jazz – von New Orleans nach Europa
- Minstrel Shows und Ragtime
- Jazz und Jazztänze – die Entwicklung
- „Pop“ in der Zwischenkriegszeit
- Die Lage in Wien
- Schlager
- Der Schlager im Film
- Der Wiener Film
- Der Schlager im Film
- Wilde Tänze
- Alles Shimmy
- Charleston
- Amerikanisierung, Sittenverfall und „Negermusik“
- Josephine
- „Jonny spielt auf“
- Echter Jazz?
- Swing
- Boom in den 20ern
- Swing
- Die Rolle der RAVAG
- Vorgeschichte des Rundfunks
- Technischer Fortschritt
- Der Weg zur Ravag
- Der Ausbau
- Teilnehmerentwicklung
- Das Programm der Ravag
- Musikprogramm
- Wortprogramm
- Programm im Ständestaat
- Vorgeschichte des Rundfunks
- Musik im Nationalsozialismus
- Reichsmusikkammer und „Säuberung“
- „Säuberung“ am Beispiel der Comedian Harmonists
- Entartete Musik
- Lenkung durch Musik
- „Davon geht die Welt nicht unter“
- Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel und Reichsarbeitsdienst
- Übernahme der RAVAG
- Empfänger fürs Volk
- Programmangebot
- Jazz im Nationalsozialismus
- Jugendsubkulturen im NS-Regime
- Wiener Swings
- Schlurfs
- Jugendsubkulturen im NS-Regime
- Reichsmusikkammer und „Säuberung“
- Entwicklungen nach 1945
- Kulturmission
- Radiosender der Alliierten
- Blue Danube Network
- Rot-Weiß-Rot
- Weitere Sender
- Radiosender der Alliierten
- Kulturmission
- Ausblick in die 50er
- Jazz etabliert sich
- „Wilde“ 50er
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Andreas Merighi befasst sich mit der Veränderung des Musikgeschmacks der österreichischen Jugend im Zeitraum von 1900 bis 1950. Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Hörgewohnheiten der Jugend in diesem Zeitraum zu untersuchen und die Faktoren zu identifizieren, die diese Entwicklung beeinflusst haben.
- Die Einflüsse neuer Musikstile und technologischer Entwicklungen auf den Musikgeschmack der Jugend.
- Die Reaktion der Eltern- und älteren Generationen auf diese neuen Musikstile.
- Die Rolle von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen (Kriege, Ständestaat, Nationalsozialismus) in der Veränderung des Musikgeschmacks.
- Die Nutzung von Musik als Distinktionsmittel für verschiedene Jugendgruppen und deren Abgrenzung von anderen Gruppen, Eltern oder politischen Systemen.
- Die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung von technischen Entwicklungen wie Grammophon, Schallplatte und Radio.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem Vorwort, in dem der Autor die Fragen und Motivationen für seine Untersuchung beschreibt. Anschließend folgt eine Einleitung, die einen Rückblick auf die Entwicklungen am Ende des 19. Jahrhunderts wirft, insbesondere auf die Aufzeichnung und Verbreitung von Musik durch neue Technologien. Kapitel 3 widmet sich der Volksliedpflege, einem wichtigen Gegenpol zur aufkommenden populären Musik, und untersucht deren Rolle in verschiedenen Jugendbewegungen (sozialdemokratisch, katholisch, deutschnational) sowie in der Zwischenkriegszeit. Kapitel 4 beleuchtet den Aufstieg des „populären“ Liedes mit dem Schwerpunkt auf Jazz und Jazztänzen. Die Geschichte des Jazz von seinen Anfängen in den Minstrel Shows und dem Ragtime bis zur Verbreitung in Europa wird erörtert. Kapitel 5 befasst sich mit der Entwicklung von „Pop“ in der Zwischenkriegszeit, mit Schwerpunkt auf der Situation in Wien, der Entstehung des Schlagers, wilden Tänzen wie dem Shimmy und Charleston sowie der Debatte um Amerikanisierung, Sittenverfall und „Negermusik“. Kapitel 6 analysiert die Rolle der RAVAG (Österreichischer Rundfunk) und ihren Einfluss auf den Musikgeschmack der Jugend. Die Entwicklung des Rundfunks und seine technische und programmliche Ausgestaltung werden beleuchtet. Kapitel 7 untersucht die Musik im Nationalsozialismus, die Rolle der Reichsmusikkammer, die Unterdrückung von „entarteter Musik“, die staatliche Lenkung der Musik durch Propaganda und die Verbreitung von Musik in der Hitlerjugend, dem Bund Deutscher Mädel und dem Reichsarbeitsdienst. Schließlich beleuchtet Kapitel 8 die Entwicklungen nach 1945, mit Fokus auf die Rolle der Radiosender der Alliierten in der kulturellen Neuausrichtung Österreichs.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Musikgeschichte, Musikgeschmack, Jugendkultur, Populärmusik, Jazz, Schlager, Radio, Rundfunk, Volksliedpflege, Nationalsozialismus, Ständestaat, Wien, Österreich.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte das Radio den Musikgeschmack der österreichischen Jugend?
Das Radio (RAVAG) machte Musik zum Massenkonsumgut und ermöglichte Jugendlichen den Zugang zu neuen Stilen wie Jazz und Schlagern, unabhängig vom Elternhaus.
Welche Rolle spielte der Jazz im Nationalsozialismus?
Obwohl als „entartete Musik“ diffamiert, ließ sich der Jazz nicht auslöschen. Er wurde zum Kennzeichen des Protests von Subkulturen wie der „Swing-Jugend“ und den „Schlurfs“.
Was war die Bedeutung der Volksliedpflege in der Zwischenkriegszeit?
Die Volksliedpflege diente verschiedenen Jugendgruppen (sozialdemokratisch, katholisch, deutschnational) als Gegenpol zur kommerziellen Popmusik und zur Festigung eigener Werte.
Wie beeinflussten die alliierten Besatzungsmächte die Musik nach 1945?
Besonders die US-Soldatensender (wie Blue Danube Network) brachten zuvor unterdrückte Musikstile zurück und prägten die österreichische Musikszene nachhaltig.
Was sind „Schlurfs“?
Schlurfs waren eine Wiener Jugendsubkultur während der NS-Zeit, die durch ihr Äußeres und ihre Vorliebe für Jazz und Swing passiven Widerstand gegen das Regime leisteten.
- Citation du texte
- Mag. Andreas Merighi (Auteur), 2004, Wandel des Musikgeschmacks der österreichischen Jugend von 1900 bis 1950, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70336