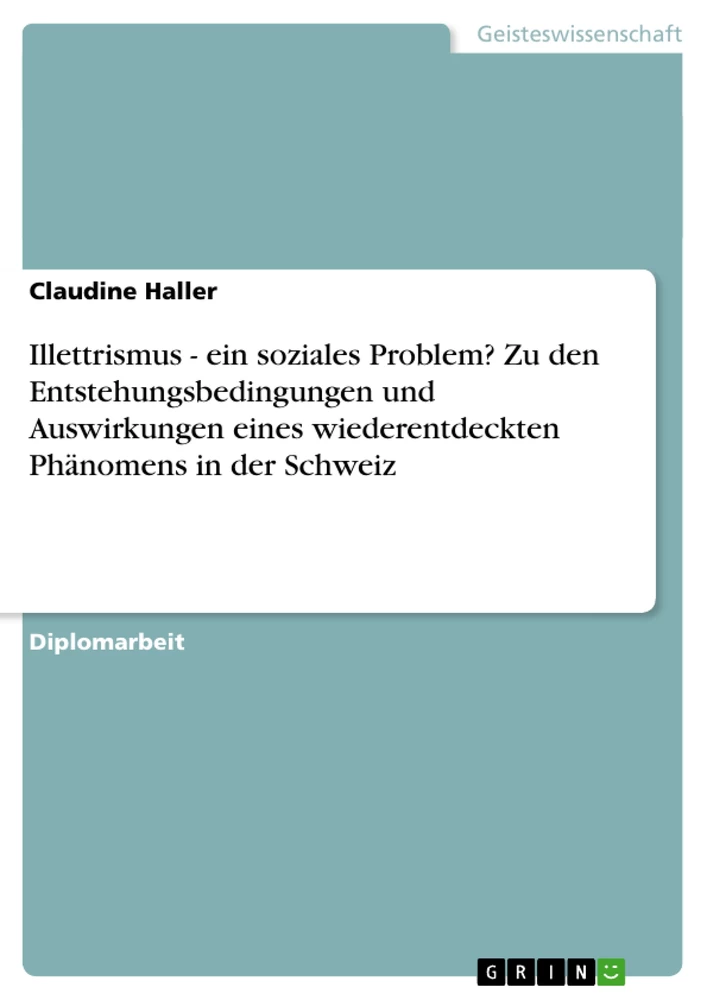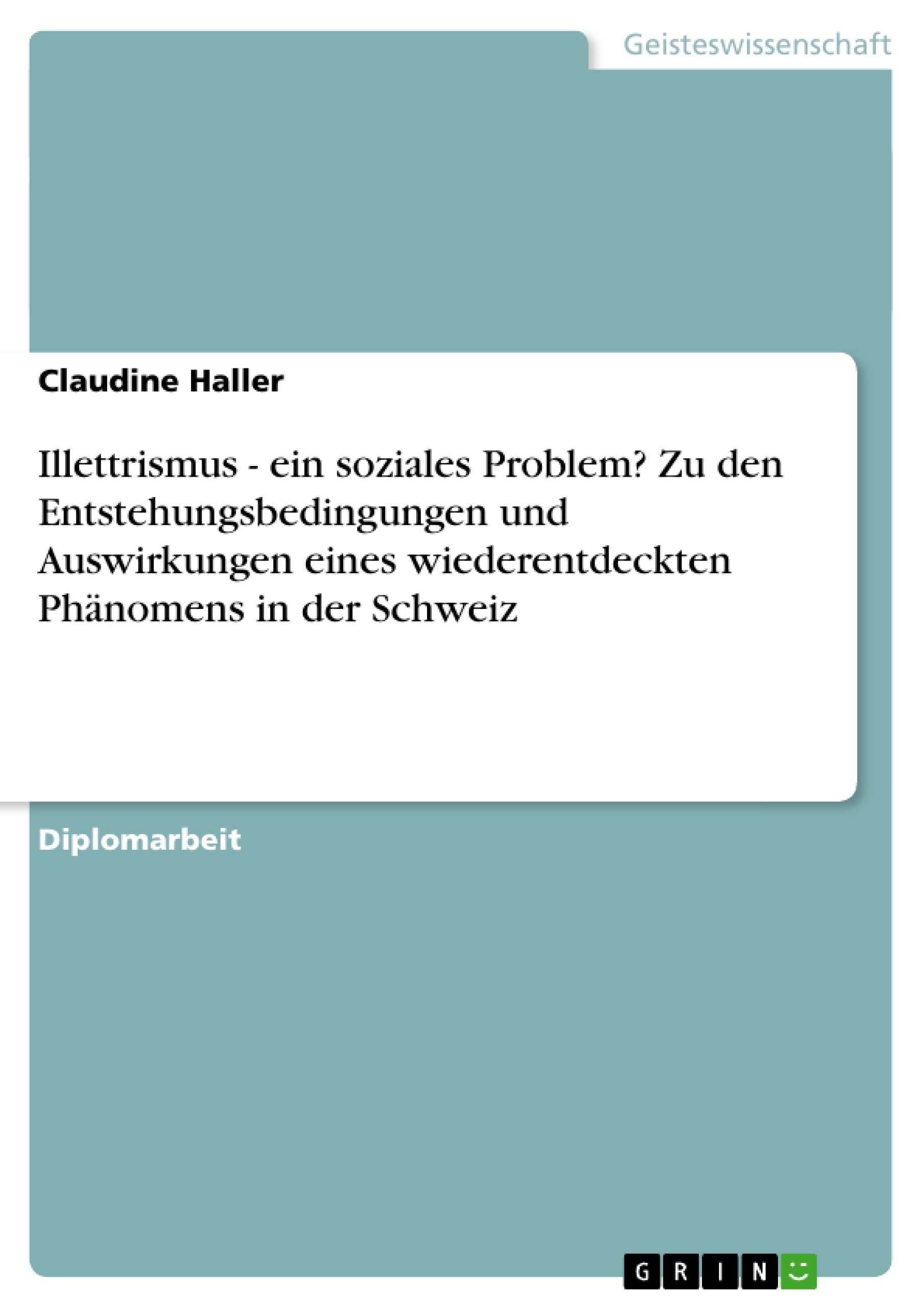Illettrismus ist ein soziales Problem in unserer Informations- und Kom-munikationsgesellschaft. Illettrismus bedingt sich aus einer Kombina-tion von belastenden sozialen Verhältnissen, schulischen Bedingungen, bei denen zu wenig individuelle Förderung stattfindet sowie zu wenig praktizierten Lesegewohnheiten. Dabei spielen die sozialen Beziehun-gen im Umfeld eine wesentliche Rolle. Das Risiko für Illettrismus steigt, wenn Personen aus einem bildungsschwachen Milieu stammen, über eine geringe Ausbildung verfügen, wenn sie zudem fremdspra-chig sind sowie allgemein mit zunehmendem Alter. Handlungsräume und Orientierungsmöglichkeiten der Betroffenen sind eingeschränkt. Aufgrund ihrer Lese- und Schreibschwächen werden sie etikettiert, ab-gewertet und erfahren in vielen Bereichen Ausgrenzung. Oft leidet das Selbstwertgefühl der Betroffenen. In der Schule muss individuellere Förderung zur Prävention von Illettrismus stattfinden. Eltern und Leh-rerschaft müssen sensibilisiert werden, Kindern ein anregendes Lern-Umfeld zu bieten. Für Betroffene braucht es mehr öffentlich bekannte Angebote und Weiterbildungsmöglichkeiten, die professionell geleitet und evaluiert werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Fragestellung
- 1.1 Hinweise zum methodischen Vorgehen
- 1.2 Bedeutung für die Soziale Arbeit
- 2 Begriffsklärungen
- 2.1 Primärer Analphabetismus
- 2.2 Sekundärer oder funktionaler Analphabetismus
- 2.3 Illiteralität
- 2.4 Illettrismus
- 3 Verbreitung von Analphabetismus und Illettrismus
- 3.1 Weltweite Verbreitung von Analphabetismus
- 3.2 Verbreitung von Illettrismus in Industrienationen
- 3.3 Lese- und Schreibkompetenzen in der Schweiz
- 3.3.1 Die International Adult Literacy Survey (IALS)
- 3.3.2 Programme for International Student Assessment (PISA)
- 3.3.3 Die Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL)
- 3.3.4 Die Rolle von Immigrantinnen und Immigranten
- 3.4 Entwicklung Lesen und Schreiben
- 4 Entwicklung Lesen und Schreiben ab dem 17. Jahrhundert
- 4.1 Entwicklung Lesen und Schreiben ab dem 17. Jahrhundert
- 4.1.1 Lesefähigkeit
- 4.1.2 Schreibfähigkeit
- 4.1.3 Orthographie
- 4.1.4 Bibliotheken
- 4.1.5 Geschlechtsspezifische Entwicklung in der Alphabetisierung
- 4.1.6 Der Einfluss der Kirche auf den Alphabetisierungsprozess
- 4.2 Bedeutung von Lesen- und Schreiben-Können heute
- 4.3 Die „Wiederentdeckung“ von Illettrismus in den 1980er Jahren
- 5 Entstehungsbedingungen für Illettrismus in der Schweiz
- 5.1 Entstehungsbedingungen für Lese- und Schreibschwächen
- 5.1.1 Individuelle Faktoren und äußere Umstände
- 5.1.2 Soziale Verhältnisse
- 5.1.3 Schule
- 5.1.4 Leseaktivitäten privat und beruflich
- 5.2 Soziodemographische Merkmale und Lese-kompetenzen
- 5.2.1 Ausbildung
- 5.2.2 Ausbildungsniveau der Eltern
- 5.2.3 Sprache und Ausbildungsort
- 5.2.4 Geschlecht
- 5.2.5 Alter
- 6 Auswirkungen von Illettrismus
- 6.1 Auswirkungen im persönlichen Bereich
- 6.2 Auswirkungen im sozialen Umfeld
- 6.3 Auswirkungen im öffentlichen Leben
- 6.4 Auswirkungen im Ausbildungsbereich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Illettrismus in der Schweiz. Ziel ist es, das Phänomen im Kontext der Schweizer Gesellschaft zu beleuchten und mögliche Handlungsansätze aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung von Analphabetismus, funktionalem Analphabetismus und Illettrismus
- Verbreitung von Illettrismus in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern
- Soziodemographische Faktoren, die die Entstehung von Illettrismus beeinflussen
- Auswirkungen von Illettrismus auf den persönlichen, sozialen und beruflichen Bereich
- Möglichkeiten der Prävention und Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt die hohe Anzahl funktionaler Analphabeten in der Schweiz fest und hebt den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Zugang zu Informationen in der modernen Gesellschaft und dem Verlust an Sprachkompetenzen hervor. Die Hauptfragestellung befasst sich mit den Entstehungsbedingungen von Illettrismus in der Schweiz, ergänzt durch Nebenfragen zu den Rollen der Schule, soziodemographischen Merkmalen und Auswirkungen des Illettrismus.
2 Begriffsklärungen: Dieses Kapitel differenziert zwischen den Begriffen primärer Analphabetismus (vollständige Unfähigkeit zu lesen und schreiben), sekundärer oder funktionaler Analphabetismus (unzureichende Lese- und Schreibfähigkeiten trotz Schulbesuch) und Illiteralität (Mangel an Lesekompetenz und -verständnis). Der Illettrismus wird als ein umfassender Begriff verstanden, der die sozialen und persönlichen Folgen von Lese- und Schreibschwächen beinhaltet.
3 Verbreitung von Analphabetismus und Illettrismus: Dieses Kapitel präsentiert die weltweite und insbesondere die Verbreitung von Analphabetismus und Illettrismus in Industrienationen. Es analysiert Daten aus verschiedenen Studien wie IALS, PISA und ALL, um die Lese- und Schreibkompetenzen in der Schweiz zu beleuchten und die Rolle von Immigranten zu untersuchen.
4 Entwicklung Lesen und Schreiben ab dem 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung des Lesens und Schreibens ab dem 17. Jahrhundert in der Schweiz. Es beleuchtet die Entwicklung der Lesefähigkeit, Schreibfähigkeit, Orthographie, die Rolle von Bibliotheken, geschlechtsspezifische Unterschiede und den Einfluss der Kirche auf den Alphabetisierungsprozess.
5 Entstehungsbedingungen für Illettrismus in der Schweiz: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die zur Entstehung von Illettrismus beitragen. Es differenziert zwischen individuellen Faktoren, sozialen Verhältnissen, schulischen Bedingungen und den Leseaktivitäten im privaten und beruflichen Bereich. Weiterhin werden soziodemographische Merkmale wie Ausbildung, Ausbildungsniveau der Eltern, Sprache, Geschlecht und Alter im Zusammenhang mit Lese- und Schreibkompetenzen untersucht.
6 Auswirkungen von Illettrismus: Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Auswirkungen von Illettrismus auf die Betroffenen. Es differenziert zwischen den Auswirkungen auf den persönlichen Bereich, das soziale Umfeld, das öffentliche Leben und den Ausbildungsbereich. Die Ausführungen beleuchten die Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen Betroffene im Alltag begegnen.
Schlüsselwörter
Illettrismus, Analphabetismus, funktionale Analphabeten, Lese- und Schreibkompetenzen, Schweiz, soziodemographische Faktoren, Schule, soziale Ausgrenzung, Prävention, Intervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Illettrismus in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Illettrismus in der Schweiz. Sie beleuchtet das Phänomen im Kontext der Schweizer Gesellschaft und zeigt mögliche Handlungsansätze auf.
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit differenziert zwischen primärer Analphabetismus (vollständige Unfähigkeit zu lesen und schreiben), sekundärer oder funktionaler Analphabetismus (unzureichende Lese- und Schreibfähigkeiten trotz Schulbesuch) und Illiteralität (Mangel an Lesekompetenz und -verständnis). Illettrismus wird als umfassender Begriff verstanden, der die sozialen und persönlichen Folgen von Lese- und Schreibschwächen beinhaltet.
Wie wird die Verbreitung von Analphabetismus und Illettrismus dargestellt?
Die Arbeit präsentiert die weltweite und die Verbreitung von Analphabetismus und Illettrismus in Industrienationen. Sie analysiert Daten aus Studien wie IALS, PISA und ALL, um die Lese- und Schreibkompetenzen in der Schweiz zu beleuchten und die Rolle von Immigranten zu untersuchen.
Welche historische Entwicklung wird betrachtet?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des Lesens und Schreibens ab dem 17. Jahrhundert in der Schweiz. Sie beleuchtet die Entwicklung der Lesefähigkeit, Schreibfähigkeit, Orthographie, die Rolle von Bibliotheken, geschlechtsspezifische Unterschiede und den Einfluss der Kirche auf den Alphabetisierungsprozess.
Welche Faktoren tragen zur Entstehung von Illettrismus bei?
Die Arbeit untersucht individuelle Faktoren, soziale Verhältnisse, schulische Bedingungen und Leseaktivitäten im privaten und beruflichen Bereich als Faktoren, die zur Entstehung von Illettrismus beitragen. Soziodemographische Merkmale wie Ausbildung, Ausbildungsniveau der Eltern, Sprache, Geschlecht und Alter im Zusammenhang mit Lese- und Schreibkompetenzen werden ebenfalls untersucht.
Welche Auswirkungen hat Illettrismus?
Die Arbeit beschreibt die vielfältigen Auswirkungen von Illettrismus auf die Betroffenen. Sie differenziert zwischen den Auswirkungen auf den persönlichen Bereich, das soziale Umfeld, das öffentliche Leben und den Ausbildungsbereich und beleuchtet die damit verbundenen Schwierigkeiten und Herausforderungen im Alltag.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Illettrismus, Analphabetismus, funktionale Analphabeten, Lese- und Schreibkompetenzen, Schweiz, soziodemographische Faktoren, Schule, soziale Ausgrenzung, Prävention, Intervention.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung und Fragestellung, Begriffsklärungen, Verbreitung von Analphabetismus und Illettrismus, Entwicklung Lesen und Schreiben ab dem 17. Jahrhundert, Entstehungsbedingungen für Illettrismus in der Schweiz und Auswirkungen von Illettrismus. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Illettrismus in der Schweiz zu untersuchen und mögliche Handlungsansätze aufzuzeigen.
- Citation du texte
- Claudine Haller (Auteur), 2006, Illettrismus - ein soziales Problem? Zu den Entstehungsbedingungen und Auswirkungen eines wiederentdeckten Phänomens in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70338