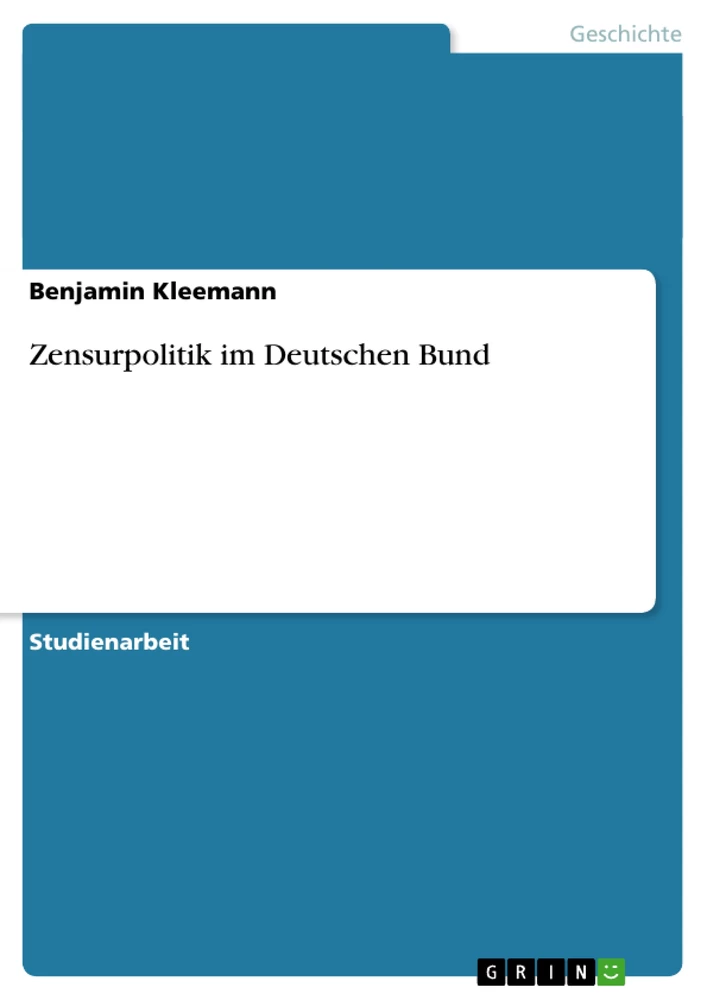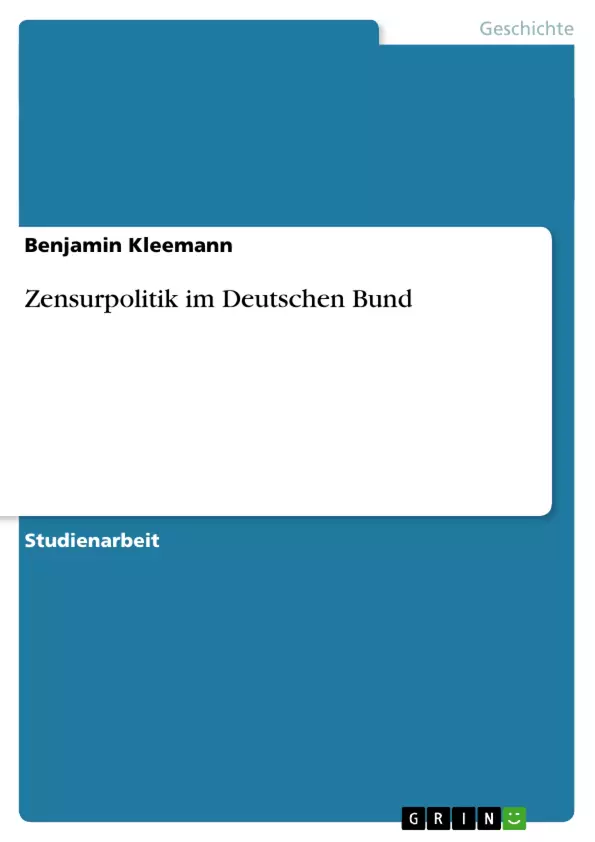Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage nach der Gestaltung der Zensurpolitik im Deutschen Bund des Vormärz. Hierbei soll insbesondere darauf eingegangen werden, wer die maßgeblichen Akteure der deutschen Zensurpolitik waren, wodurch ihr Handeln bestimmt wurde und welche Auswirkungen sie hatte. Hierbei soll die Zensur gedruckter Schriften im Vordergrund stehen. Zusätzliche Themen wie die Theater- oder die Selbstzensur der Autoren können nicht berücksichtigt werden, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Als zeitliche Grenzen wurden die Jahre 1815 und 1848 gewählt – also der Zeitraum zwischen der Verabschiedung der Verfassung des Deutschen Bundes mit der Zusicherung der „Preßfreiheit“ und der Aufhebung der Vorzensur im Rahmen der März-Revolution.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Zensurpolitik auf der Ebene des Deutschen Bundes näher untersucht. Im Vordergrund stehen dabei die einschlägigen Beschlüsse der Bundesversammlung, des obersten Entscheidungsorgans des Deutschen Bundes, unter welchen Umständen sie zustande gekommen sind und welche Folgen sie hatten. Der zweite Abschnitt wird an einzelnen Beispielen einen Überblick über die Verschiedenheit der Zensurgesetzgebung und deren Auslegung in den einzelnen Territorien geben. Wobei sowohl die Ursachen, als auch die Auswirkungen dieser Politik beleuchtet werden sollen. Im letzten Teil der Arbeit soll darauf eingegangen werden, wie diese Zensurpolitik im Einzelnen umgesetzt wurde, welche Konsequenzen sie für die Literatur- und Presselandschaft im Vormärz hatte und wie sich Schriftsteller und Journalisten dagegen zur Wehr setzten.
Insbesondere die Protokolle der Bundesversammlung geben umfassend über die in diesem Rahmen gefassten Beschlüsse Auskunft. Metternichs überlieferte Korrespondenz und Denkschriften geben zudem einen Einblick in die Denkweise und Politik des wichtigsten politischen Akteurs dieser Zeit. Zudem existiert eine umfassende Literatur zu diesem Thema, die die Zensurpolitik im Vormärz aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet. Einige historische Arbeiten befassen sich generell mit dem Thema Zensur und ordnen die Ereignisse zwischen 1819 und 1848 in die lange Geschichte der Zensur ein. Regionale Studien geben einen Einblick in die Politik einzelner Territorien, während es sich andere Historiker zur Aufgabe gemacht haben, exemplarische oder besonders groteske Fälle von Zensur und deren Alltag zu dokumentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltlich-methodische Vorüberlegungen
- I. Entwicklung der Zensurpolitik im Deutschen Bund
- A. Von der Zusicherung der Pressefreiheit zur Durchsetzung der bundesweiten Vorzensur
- 1. Wiener Kongress und Diskussion eines „Preßgesetztes“
- 2. Karlsbader Beschlüsse
- B. Zur Entwicklung der Zensur nach der französischen Julirevolution
- 1. Neue Repressivmaßnahmen
- 2. Zum Mainzer Informationsbüro
- 3. Von den Wiener Beschlüssen bis zur Märzrevolution
- II. Entwicklung der Zensurpolitik in den Bundesstaaten
- A. Auswirkungen der Karlsbader Beschlüsse
- B. Zwischen Liberalisierungsversuchen und Verschärfung der Zensur nach der Juli Revolution
- III. Zensurpraxis und Widerstand der Zensierten
- A. Die Zensoren
- B. Emigrationsliteratur und Buchhandel
- C. Die Zeitungen
- Zusammenfassung
- Literatur
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Zensurpolitik im Deutschen Bund während des Vormärz (1815-1848). Sie untersucht die Akteure, die Motivationen und die Auswirkungen dieser Politik auf die gedruckte Literatur.
- Entwicklung der Zensurpolitik auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesstaaten
- Die Rolle der Karlsbader Beschlüsse und anderer wichtiger Beschlüsse
- Die Auswirkungen der Zensur auf die Literatur- und Presselandschaft
- Der Widerstand von Schriftstellern und Journalisten gegen die Zensur
- Die Umsetzung der Zensurpolitik in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zunehmende Nachfrage nach Druckerzeugnissen im Vormärz dar und beschreibt die Bedeutung der Pressefreiheit in dieser Zeit. Sie beleuchtet die Entwicklung der politischen Öffentlichkeit und den Einfluss der Presse auf die Meinungsbildung.
- Inhaltlich-methodische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel erläutert die Forschungsfrage der Arbeit und die zentralen Themenbereiche. Es legt die zeitlichen Grenzen der Untersuchung fest und definiert die Methodik, die zur Analyse der Zensurpolitik verwendet wird.
- I. Entwicklung der Zensurpolitik im Deutschen Bund: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Zensurpolitik auf Bundesebene, beginnend mit der Zusicherung der „Preßfreiheit“ im Deutschen Bund. Es analysiert die wichtigsten Beschlüsse der Bundesversammlung, die zur Einführung und Durchsetzung der Vorzensur führten.
- II. Entwicklung der Zensurpolitik in den Bundesstaaten: Dieses Kapitel beleuchtet die Umsetzung der Zensurpolitik in den einzelnen Bundesstaaten. Es untersucht die Unterschiede in der Gesetzgebung und deren Auslegung sowie die Ursachen und Folgen dieser Unterschiede.
- III. Zensurpraxis und Widerstand der Zensierten: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Umsetzung der Zensurpolitik in der Praxis. Es betrachtet die Rolle der Zensoren und analysiert die Auswirkungen der Zensur auf die Literatur- und Presselandschaft. Es untersucht den Widerstand von Schriftstellern und Journalisten gegen die Zensur und deren Strategien, um die Einschränkungen zu umgehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Zensurpolitik im Deutschen Bund des Vormärz, der Bedeutung der Pressefreiheit, der Entwicklung der politischen Öffentlichkeit, dem Einfluss der Karlsbader Beschlüsse, dem Widerstand gegen die Zensur und der Auswirkung auf die Literatur- und Presselandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Zeitraum der Zensurpolitik im Deutschen Bund?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Jahre 1815 bis 1848, also die Zeit zwischen der Verabschiedung der Bundesverfassung und der Märzrevolution.
Welche Rolle spielten die Karlsbader Beschlüsse?
Die Karlsbader Beschlüsse waren entscheidend für die Durchsetzung der bundesweiten Vorzensur und markierten einen Wendepunkt weg von der ursprünglich zugesicherten Pressefreiheit.
Wer waren die maßgeblichen Akteure der Zensurpolitik?
Neben der Bundesversammlung war insbesondere Fürst Metternich ein zentraler politischer Akteur, dessen Denkschriften tiefen Einblick in die repressive Politik dieser Zeit geben.
Wie wehrten sich Schriftsteller gegen die Zensur?
Schriftsteller und Journalisten entwickelten verschiedene Strategien, wie etwa die Flucht in die Emigrationsliteratur oder spezifische Anpassungen im Buchhandel, um die Einschränkungen zu umgehen.
Gab es Unterschiede in der Zensur zwischen den Bundesstaaten?
Ja, die Zensurgesetzgebung und deren Auslegung variierten in den einzelnen Territorien erheblich, was in der Arbeit an verschiedenen Beispielen beleuchtet wird.
- Quote paper
- Magister Artium Benjamin Kleemann (Author), 2006, Zensurpolitik im Deutschen Bund , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70358