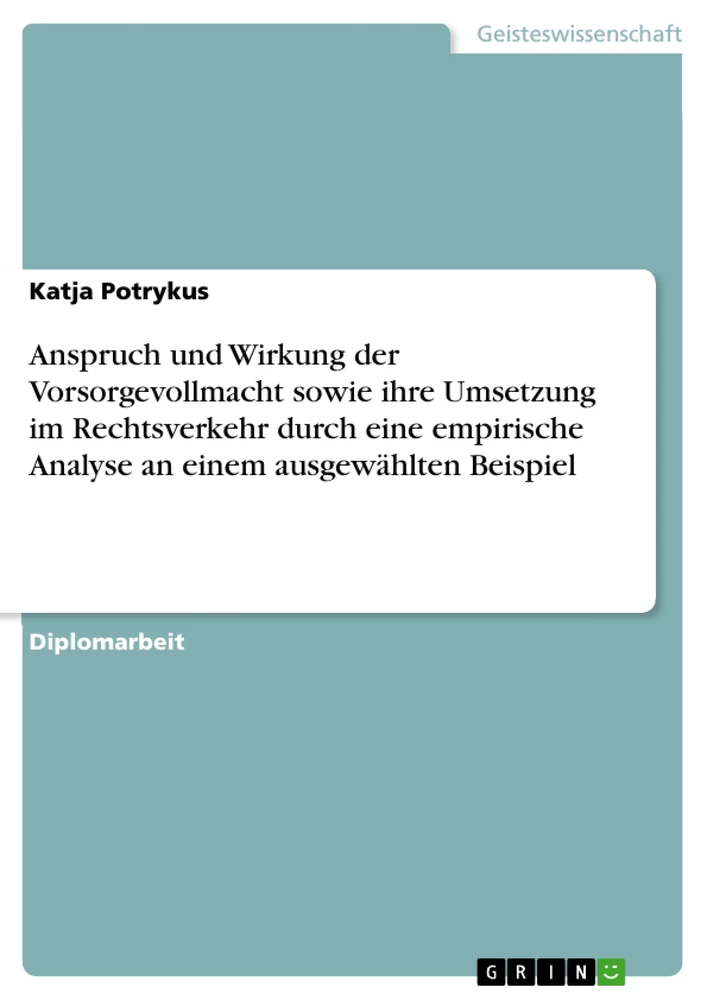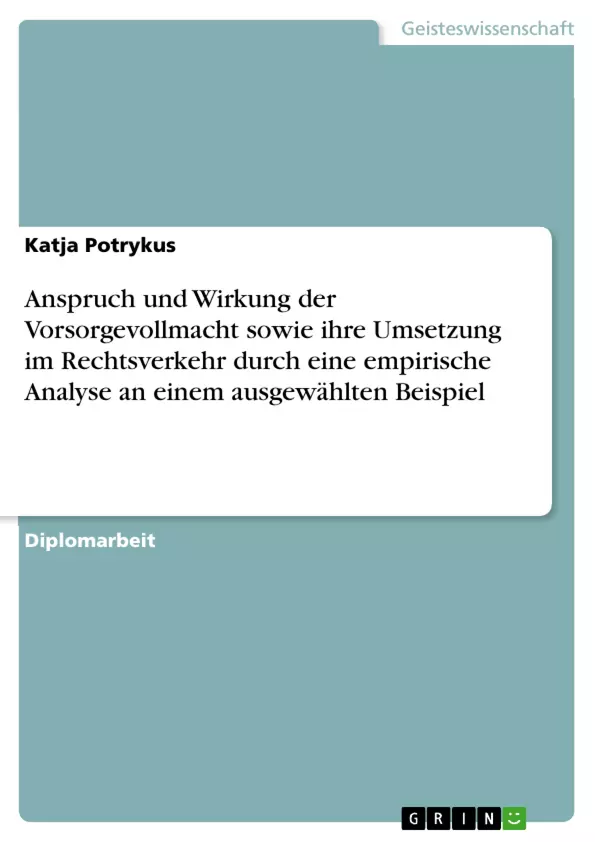Soziale Arbeit zentriert sich auf diejenigen Menschen, die durch persönliche Nachteile oder strukturelle Ungleichheiten an einer gleichberechtigten Partizipation des gesellschaftlichen Lebens gehindert werden. Sie soll das Individuum unterstützen, die eigenen vorhandenen Kompetenzen zu stärken. Zu dem betrachteten Personenkreis zählen Menschen, die ihren persönlichen Lebensweg nicht ohne dauerhafte oder vorübergehende Hilfe bestreiten können. Sie sind darauf angewiesen, dass andere Personen für sie handeln. In der vorliegenden Diplomarbeit geht es um Menschen, die auf Grund einer geistigen, seelischen Behinderung oder psychischen Erkrankung einen Vertreter benötigen, der sie in Rechtsangelegenheiten oder Teilen dieser vertritt.
Das Gesetz nennt in diesem Bereich die zwei Möglichkeiten des stellvertretenden Handelns: die gesetzliche Betreuung und die Vollmachtsvertretung. Kann eine oben charakterisierte Person ihren Willen nicht mehr frei äußern und ist somit nicht mehr in der Lage, eine Vollmacht zu erteilen, tritt die gesetzliche Betreuung in Kraft. Um diese Form des staatlichen Eingriffes in das persönliche Leben des Betroffenen zu verhindern, besteht die Möglichkeit, Vorsorgemaßnahmen für Zeiten einer geistigen oder körperlichen Gebrechlichkeit zu treffen. Körperliche oder geistige Beeinträchtigungen können unerwartet, z.B. durch einen Unfall, oder vorhersehbar, beispielsweise durch die zunehmende Demenz im Alter, eintreten. Menschen, welche davon aktuell oder zukünftig beeinträchtigt sind, können am selbstverantwortlichen Handeln gehindert sein. Um dennoch eigene Entscheidungen und den persönlichen Willen einzubeziehen, welcher in jeder Lebenssituation von Relevanz sein soll, erscheint die Vorsorgevollmacht als die ideale Lösung. Kann sie aber dem Vergleich mit der gesetzlichen Betreuung standhalten und als eine reelle Alternative in Betracht gezogen werden? Dieser Fragestellung wird in der vorliegenden Diplomarbeit unter Einbeziehung aller theoretischen und empirischen Aspekte nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stellvertretung, Selbstbestimmung, Vorsorge - ethische Aspekte
- Formen der Stellvertretung
- Die gesetzliche Stellvertretung (Betreuung)
- Die rechtsgeschäftliche Stellvertretung (Vollmacht)
- Die Vorsorgevollmacht - Anspruch und Wirkung
- Form
- Inhalt
- Wirkung
- Parallelität von Vollmacht und Betreuung
- Ziel und Hintergrund der Gesetzgebung zur Förderung der Vorsorgevollmacht
- Erforderlichkeitsgrundsatz und Subsidiaritätsprinzip
- Entwicklung der gesetzlichen Regelungen zur Vorsorgevollmacht und deren Ergebnisse
- Zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen
- Vorsorgeregister
- Aufklärung und Informationsverbreitung
- Zuständigkeitserweiterung der Betreuungsbehörde
- Die Vorsorgevollmacht in der Praxis
- Risiken und Nachteile für den Vollmachtgeber
- Vollmachtsmissbrauch
- Fehlende Kontrolle
- Risiken und Nachteile für den Bevollmächtigten
- Haftung
- Eignung
- Aufwandsentschädigung/Vergütung
- Die Vorsorgevollmacht im Rechtsverkehr
- Empirische Analyse zur Rechtsakzeptanz der Vorsorgevollmacht
- Intention der Untersuchung
- Methodische Vorüberlegungen
- Wahl der Forschungsmethode
- Erhebungssituation
- Auswertung und Analyse der Beobachtung
- Inhaltsanalyse
- Interpretation
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Vorsorgevollmacht, einem Instrument der Selbstbestimmung im Alter und bei Krankheit. Ziel der Arbeit ist es, den Anspruch und die Wirkung der Vorsorgevollmacht im Rechtsverkehr zu analysieren, indem ein empirisches Beispiel herangezogen wird.
- Die Bedeutung der Vorsorgevollmacht im Kontext von Selbstbestimmung und Stellvertretung
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Vorsorgevollmacht und deren Umsetzung in der Praxis
- Die empirische Untersuchung zur Rechtsakzeptanz der Vorsorgevollmacht
- Die Herausforderungen und Chancen der Vorsorgevollmacht für Vollmachtgeber und Bevollmächtigte
- Die Relevanz der Vorsorgevollmacht für die Gestaltung von Lebensentwürfen im Alter und bei Krankheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die Vorsorgevollmacht als Instrument der Selbstbestimmung im Alter und bei Krankheit. Kapitel 1 beleuchtet die ethischen Aspekte von Stellvertretung, Selbstbestimmung und Vorsorge. Kapitel 2 stellt verschiedene Formen der Stellvertretung vor, darunter die gesetzliche Betreuung und die rechtsgeschäftliche Vollmacht. Kapitel 3 widmet sich der Vorsorgevollmacht, analysiert ihre Form, ihren Inhalt, ihre Wirkung und ihre Parallelität zur Betreuung.
Kapitel 4 befasst sich mit den Zielen und dem Hintergrund der Gesetzgebung zur Förderung der Vorsorgevollmacht, wobei der Erforderlichkeitsgrundsatz und das Subsidiaritätsprinzip im Vordergrund stehen. Kapitel 5 analysiert die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen in der Praxis, einschließlich Vorsorgeregister, Aufklärung und Informationsverbreitung sowie der Zuständigkeitserweiterung der Betreuungsbehörde.
Kapitel 6 beleuchtet die Vorsorgevollmacht in der Praxis und untersucht die Risiken und Nachteile für Vollmachtgeber und Bevollmächtigte. Kapitel 7 präsentiert eine empirische Analyse zur Rechtsakzeptanz der Vorsorgevollmacht, die die Intention der Untersuchung, methodische Vorüberlegungen, die Wahl der Forschungsmethode, die Erhebungssituation sowie die Auswertung und Interpretation der Beobachtung beinhaltet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Vorsorgevollmacht, Selbstbestimmung, Stellvertretung, Rechtsakzeptanz, empirische Analyse, Betreuungsrecht, Altersvorsorge, Krankheit, Rechtsverkehr, Vollmachtsmissbrauch, Bevollmächtigung, Haftung, Eignung, Informationsverbreitung, Vorsorgeregister, Subsidiaritätsprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Vorsorgevollmacht und gesetzlicher Betreuung?
Die Vorsorgevollmacht ist ein Instrument der Selbstbestimmung, mit dem man selbst Vertreter wählt. Die gesetzliche Betreuung ist ein staatlicher Eingriff, der eintritt, wenn keine Vorsorge getroffen wurde.
Welche Vorteile bietet eine Vorsorgevollmacht?
Sie ermöglicht es, den eigenen Willen für Zeiten der Entscheidungsunfähigkeit (z.B. durch Unfall oder Demenz) festzulegen und ein gerichtliches Betreuungsverfahren zu vermeiden.
Gibt es Risiken bei der Erteilung einer Vollmacht?
Ein Hauptrisiko ist der Vollmachtsmissbrauch, da im Gegensatz zur rechtlichen Betreuung keine regelmäßige staatliche Kontrolle des Bevollmächtigten stattfindet.
Was ist das Zentrale Vorsorgeregister?
Dort können Vorsorgevollmachten registriert werden, damit Gerichte im Ernstfall schnell prüfen können, ob ein Bevollmächtigter existiert, bevor eine Betreuung eingerichtet wird.
Wie hoch ist die Rechtsakzeptanz der Vorsorgevollmacht in der Praxis?
Die empirische Analyse der Arbeit untersucht, wie Banken, Behörden und Ärzte mit Vollmachten umgehen und welche Hürden es im Rechtsverkehr gibt.
- Quote paper
- Katja Potrykus (Author), 2006, Anspruch und Wirkung der Vorsorgevollmacht sowie ihre Umsetzung im Rechtsverkehr durch eine empirische Analyse an einem ausgewählten Beispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70383