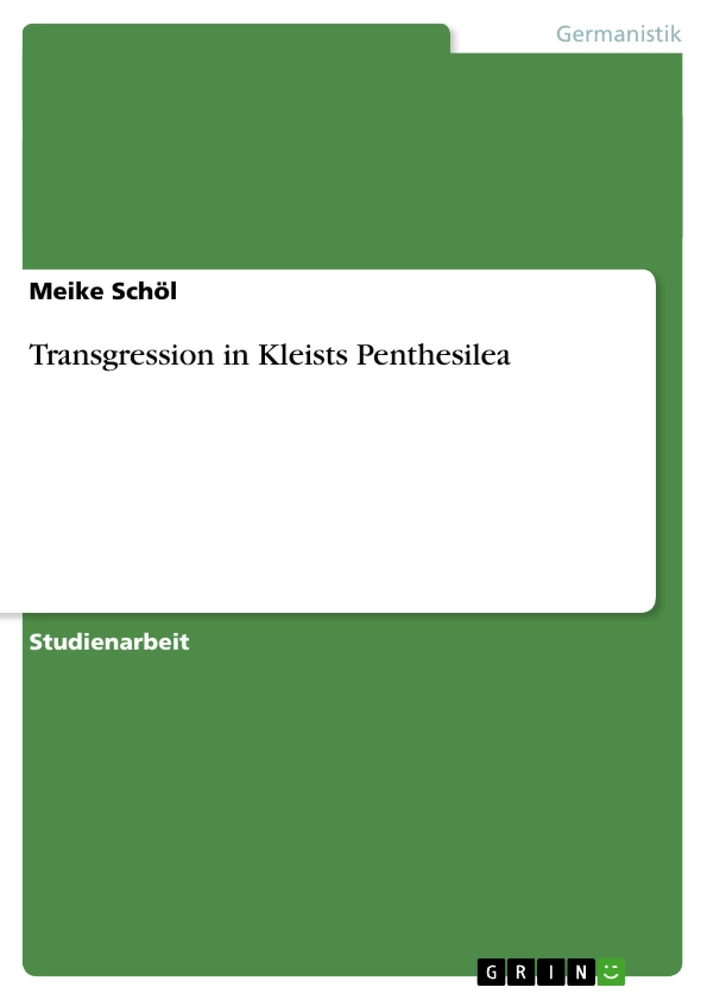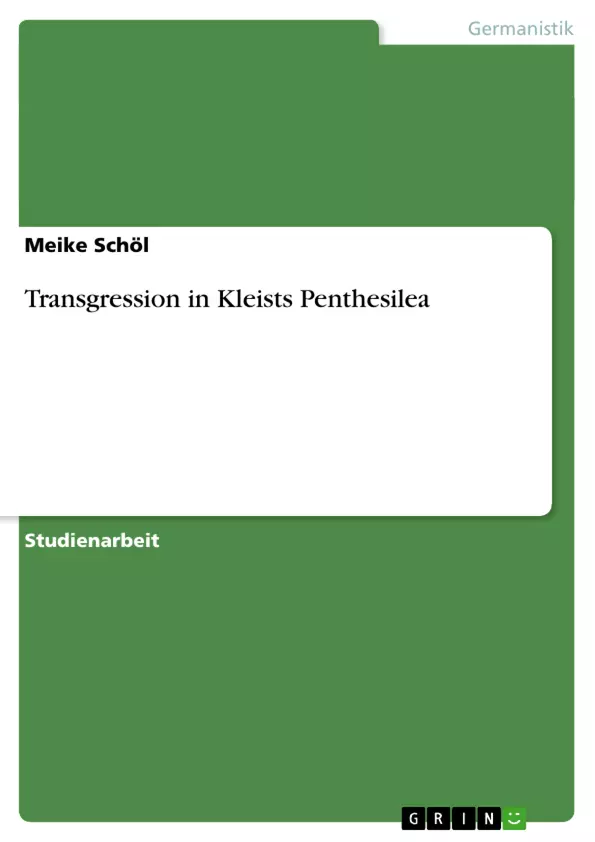Der Begriff der Transgression stammt aus dem Lateinischen und bedeutet zu Deutsch Überschreitung. Dies betrifft vor allem die Überschreitung von Gesetzen. Die Tragödie mit dem Titel „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist wird häufig als eine Tragödie der Transgression bezeichnet. Das betrifft sowohl inhaltliche, als auch formale Aspekte. Die formalen Unterschiede werden vor allem sichtbar, wenn man die „Penthesilea“ mit den Merkmalen des klassischen Dramen vergleicht. Hier kommen Aspekte wie Szeneneinleitung, Personenkonstellation, Zeiteinteilung und Haupt - bzw. Nebentext zum tragen. Dass die „Penthesilea“ zahlreiche inhaltliche Überschreitung aufweist, zeigt sich besonders an der inkonventionellen Verarbeitung des antiken Mythenstoffs. Besonders, wenn man diesbezüglich die Parallelen der „Penthesilea“ mit dem klassizistischen Achill - Fragment von Goethe heranzieht. Diese beiden Werke weisen stofflich, wie zeitlich eine hohe Konvergenz auf, sind von der Verarbeitung aber grundverschieden.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Biographische Daten zum Autor
- Fakten zum Werk
- Inhalt des Werks
- Vergleich des klassischen Dramas mit der Penthesilea von Kleist
- Das klassische Drama
- Inwiefern weicht die Tragödie „Penthesilea“ von den Merkmalen des klassischen Dramas ab
- Die inhaltliche Transgression
- Fazit: Wie Wurde Kleists Penthesilea von der Gesellschaft seiner Zeit aufgenommen?
- Inwiefern hat Kleist mit der Transgression in der Penthesilea die Entwicklung des modernen Dramas vorangetrieben bzw. beeinflusst?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Tragödie „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist im Kontext der Transgression. Sie analysiert sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte, die von den Konventionen des klassischen Dramas abweichen und damit eine Überschreitung von Normen und Gesetzen darstellen.
- Die „Penthesilea“ als Beispiel für ein Transgressionsdrama in Form und Inhalt
- Der Vergleich mit dem klassischen Drama und die Abweichungen von seinen Merkmalen
- Die Bedeutung des antiken Mythenstoffs und seine umstrittene Verarbeitung durch Kleist
- Die Rezeption von Kleists „Penthesilea“ in der Gesellschaft seiner Zeit
- Der Einfluss der Transgression auf die Entwicklung des modernen Dramas
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Transgression ein und beschreibt die biographischen Hintergründe des Autors Heinrich von Kleist. Es setzt den Fokus auf die Überschreitung von Gesetzen und Normen, sowohl in formalen als auch in inhaltlichen Aspekten der „Penthesilea“.
Kapitel zwei beleuchtet die Fakten zum Werk „Penthesilea“, einschließlich der Entstehungsgeschichte und der Rezeption durch Johann Wolfgang Goethe. Es stellt die Parallelen und Unterschiede zur Goetheschen „Achilleis“ heraus.
Kapitel drei vergleicht das klassische Drama mit Kleists „Penthesilea“ und analysiert die Abweichungen von seinen Merkmalen. Es beleuchtet die spezifischen Aspekte wie Szeneneinleitung, Personenkonstellation, Zeiteinteilung und Haupt- bzw. Nebentext.
Kapitel vier untersucht die inhaltliche Transgression in der „Penthesilea“, insbesondere die unkonventionelle Verarbeitung des antiken Mythenstoffs und die Parallelen zum klassizistischen Achill-Fragment von Goethe.
Das fünfte Kapitel betrachtet die Rezeption von Kleists „Penthesilea“ in der Gesellschaft seiner Zeit und untersucht den Einfluss der Transgression auf die Entwicklung des modernen Dramas.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Konzepte der Transgression, der „Penthesilea“, des klassischen Dramas, des Mythenstoffs, der Rezeption, der Entwicklung des modernen Dramas, Heinrich von Kleist, Johann Wolfgang Goethe, und der „Achilleis“. Diese Schlüsselwörter geben einen überblick über die zentralen Themen und Konzepte des Werks.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Transgression“ im Kontext von Kleists Penthesilea?
Transgression bedeutet Überschreitung. In der Tragödie bezieht sich dies auf die Verletzung gesellschaftlicher Gesetze, die Abkehr von klassischen Dramenregeln und die inkonventionelle Mythenverarbeitung.
Wie weicht Penthesilea vom klassischen Drama ab?
Kleist bricht mit der klassischen Form durch eine untypische Szeneneinleitung, komplexe Personenkonstellationen und eine Zeiteinteilung, die den Normen der Weimarer Klassik widerspricht.
Was ist der inhaltliche Kern der Tragödie Penthesilea?
Es geht um die Amazonenkönigin Penthesilea und ihren tödlichen Konflikt mit Achill, bei dem die Grenzen zwischen Liebe, Krieg und Wahnsinn überschritten werden.
Wie reagierte die Gesellschaft zur Zeit Kleists auf das Werk?
Das Werk stieß auf Unverständnis und Ablehnung, selbst bei Goethe, da es die ästhetischen und moralischen Grenzen der Zeit massiv verletzte.
Welchen Einfluss hatte Kleist auf das moderne Drama?
Durch seine radikale Transgression und die Darstellung psychischer Grenzzustände gilt Kleist heute als Wegbereiter des modernen, psychologischen Dramas.
- Citar trabajo
- Meike Schöl (Autor), 2003, Transgression in Kleists Penthesilea, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70394