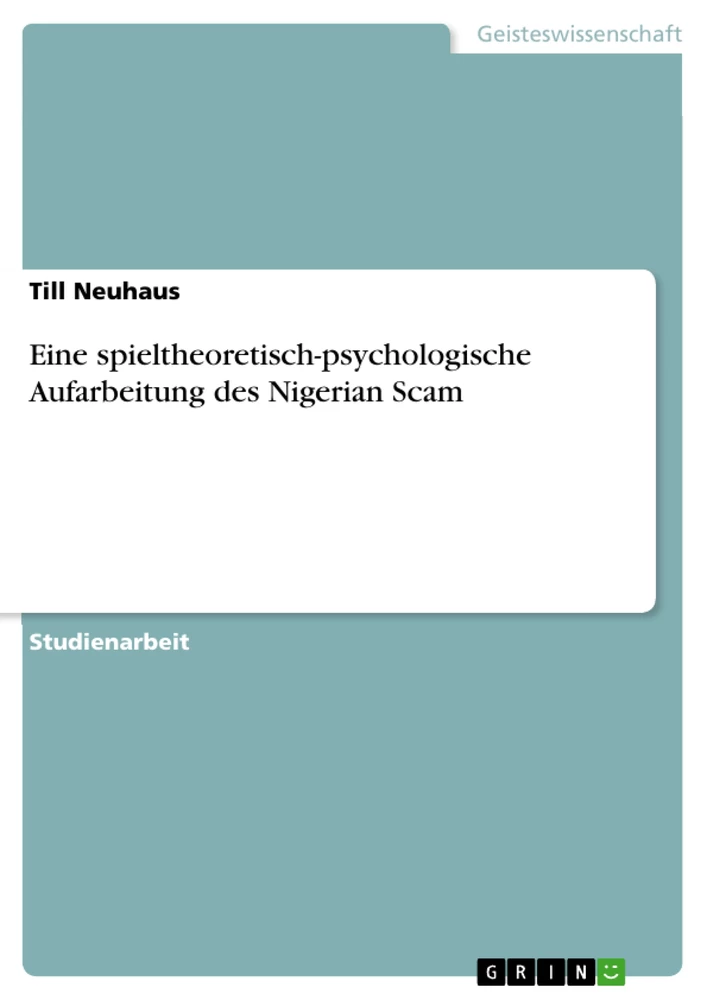Der Fokus im Rahmen dieser Arbeit soll auf der Betrüger-Opfer-Kommunikation liegen und diese mithilfe von spieltheoretischen Kommunikationsmodellen besser erklären und aufzeigen, mithilfe welcher Informationen die Täter ihren Betrug perfektionieren und Vorteile gegenüber ihrem Opfer generieren.
Um dies zu bewerkstelligen werden einige Konzepte vorgestellt und miteinander verknüpft. Eingangs wird der "Nigerian Scam" vorgestellt, historisch eingeordnet, erklärt und aufgezeigt unter welchen Bedingungen er lukrativ ist. Hierzu wird ebenfalls kurz der Mechanismus der Selbstselektion durch Änderung der Anreizstruktur diskutiert. Nachdem der Betrug angemessen dargestellt wurde, wird darauffolgenden die spieltheoretische Frage diskutiert, unter welchen Bedingungen ehrliche Kommunikation eine evolutionäre stabile Strategie (ESS) ist und unter welchen Umständen unehrliche oder betrügerische Signale Erfolg versprechen. Hierfür werden die Konzepte des "costly signalling" und "honest signalling" beziehungsweise des "handicap signalling" im Detail besprochen. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammengeführt, mit dem Ziel erklären zu können an welchen Stellen die Internetbetrüger vermeintlich stabile Strategien für ihre Zwecke ausnutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Nigerian-Scam
- Kommunikation in der Spieltheorie
- Synthese
- Die Modifizierung des Opfer-Täter-Verhältnisses und der Signalstärke
- Zwei unterschiedliche Spiele auf dem gleichen Spielfeld
- Zusammenfassung und weitere Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Nigerian Scam, auch bekannt als Vorkassebetrug oder 419-Scam, aus spieltheoretischer Perspektive. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Betrügern und Opfern zu untersuchen und aufzuzeigen, wie die Betrüger mit Hilfe von spieltheoretischen Kommunikationsmodellen ihre Strategien perfektionieren und Vorteile gegenüber ihren Opfern generieren. Dabei wird der Fokus auf die Mechanismen gelegt, die den Erfolg dieses Betrugs trotz seiner Einfachheit erklären.
- Kommunikation in der Spieltheorie
- Der Nigerian Scam als ein Beispiel für unredliche Signalisierung
- Die Rolle der Selbstselektion in der Betrugsstrategie
- Der Einfluss von Faktoren wie Need and Greed und Regret Aversion
- Die Ausnutzung von Stabilitätsstrategien für die Zwecke der Betrüger
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Nigerian Scam vor, skizziert die Relevanz des Themas und erläutert die Forschungsfrage. Dabei werden verschiedene Erklärungen für den Erfolg dieses Betrugsmodells erwähnt, von komplexen psychologischen Mechanismen bis hin zu einfacheren Erklärungen wie Gier.
- Der Nigerian-Scam: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Nigerian Scams, beleuchtet die Mechanismen, die hinter dem Betrug stecken, und zeigt auf, wie sich der Betrug im Laufe der Zeit an die technologischen Entwicklungen angepasst hat. Dabei wird die Bedeutung der Selbstselektion, der niedrigen Kommunikationskosten und der Nutzung von "Need and Greed" Prinzipien erläutert.
- Kommunikation in der Spieltheorie: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle der Kommunikation in der Spieltheorie. Dabei werden die Konzepte des costly signalling, honest signalling und handicap signalling im Detail beleuchtet. Es werden die Bedingungen für ehrliche Kommunikation und die Bedingungen für unehrliche oder betrügerische Signale diskutiert.
- Synthese: In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus den vorherigen Abschnitten zusammengefasst. Der Fokus liegt darauf, zu erklären, wie die Internetbetrüger vermeintlich stabile Strategien für ihre Zwecke ausnutzen. Die Rolle von veränderten Anreizstrukturen und die Manipulation des Opfer-Täter-Verhältnisses werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Nigerian Scam, Vorkassebetrug, 419-Scam, Spieltheorie, Kommunikation, Signalisierung, Selbstselektion, Need and Greed Principle, Regret Aversion, costly signalling, honest signalling, handicap signalling, evolutionär stabile Strategie (ESS)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Nigerian Scam“?
Es handelt sich um eine Form des Vorkassebetrugs (419-Scam), bei dem Opfern große Geldsummen versprochen werden, für deren Erhalt sie vorab Gebühren zahlen sollen.
Wie nutzt der Scam die Spieltheorie aus?
Betrüger nutzen Kommunikationsmodelle wie „costly signalling“, um durch bewusst unprofessionelle E-Mails eine Selbstselektion durchzuführen und nur die leichtgläubigsten Opfer herauszufiltern.
Warum fallen Menschen trotz Warnungen auf diesen Betrug herein?
Psychologische Faktoren wie das „Need and Greed“-Prinzip (Not und Gier) sowie die „Regret Aversion“ (Angst, eine Chance zu verpassen) spielen den Tätern in die Hände.
Was bedeutet „Selbstselektion“ in diesem Kontext?
Indem die Betrüger ihre Nachrichten offensichtlich als Spam erkennbar machen, antworten nur Personen, die besonders empfänglich für den Betrug sind, was die Effizienz für die Täter steigert.
Was ist eine evolutionär stabile Strategie (ESS)?
In der Spieltheorie ist dies eine Strategie, die sich in einer Population durchsetzt. Der Scam nutzt aus, dass betrügerische Signale unter bestimmten Bedingungen erfolgreich sein können.
- Citation du texte
- Till Neuhaus (Auteur), 2018, Eine spieltheoretisch-psychologische Aufarbeitung des Nigerian Scam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704196