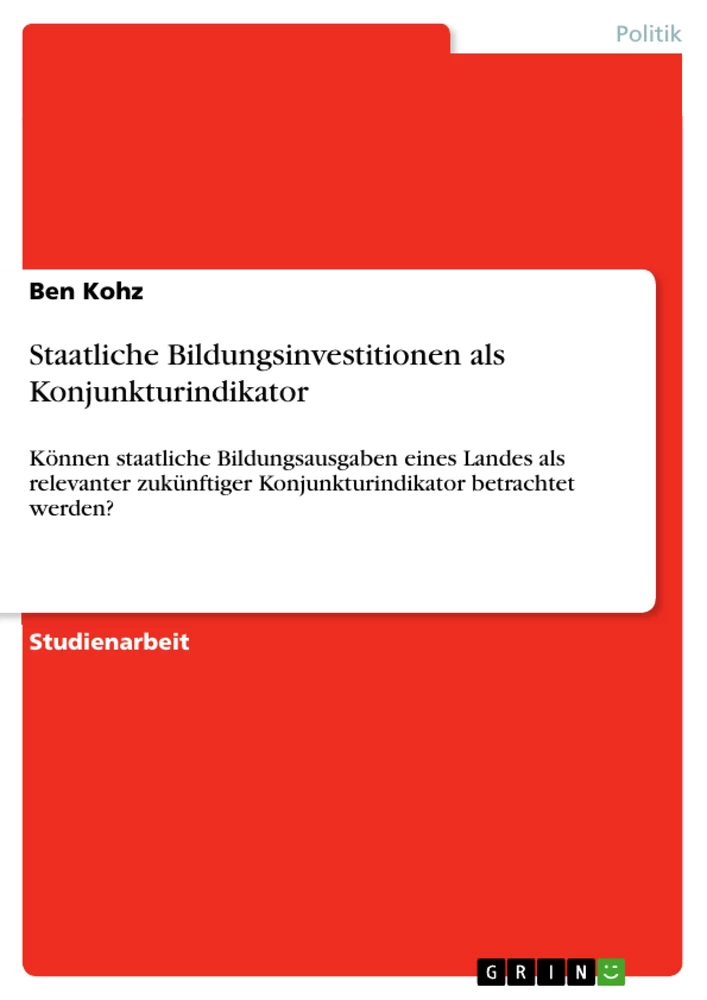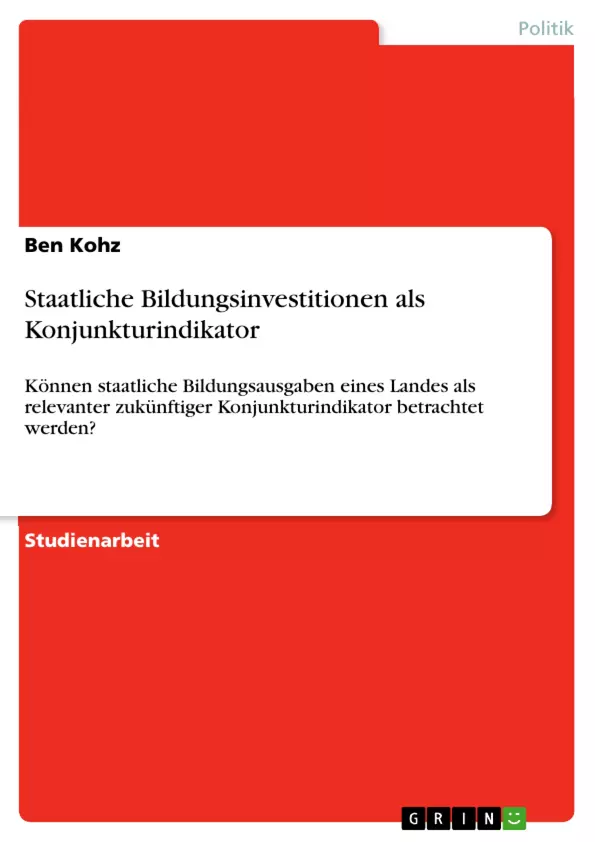Was ist die thematische Begründung der Forschung?
Nelson Mandela, der erste südafrikanische Präsident, legte mit folgendem Zitat sein Verständnis über die Rolle der Bildung in einer Gesellschaft deutlich dar: „Das größte Problem in der Welt ist Armut in Verbindung mit fehlender Bildung. Wir müssen dafür sorgen, dass Bildung alle erreicht“ (Mandela 1993).
Mandela bezeichnete die Bildung als mächtigste Waffe um die Welt zu verändern (Mandela 1993). Doch welche Auswirkung hat Bildung auf die Armut einer Gesellschaft oder die Wirtschaft einer Nation? Kann Bildung dem Anspruch einer Waffe gegen Armut überhaupt gerecht werden?
Während häufig argumentiert wird, dass sich pädagogische und ökonomische Argumente und Zusammenhänge gegenseitig ausschließen, weil ihre Begrifflichkeiten, Denkansätze und Erfolgsmaßstäbe aus gänzlich unterschiedlichen Referenzsystemen stammen (Hogrebe 2014), kann in etlichen empirischen Beispielen aus dem vergangenem Jahrhundert ein signifikanter Einfluss vom Bildungsstand auf die Wirtschaftsleistung festgestellt werden. So belegen zahlreiche Analysen, dass es einen kausalen Einfluss der Bildung auf die Industrialisierung in den Anfängen des 20. Jahrhunderts gab.
Im Anbetracht voranschreitender Globalisierung und Digitalisierung muss nun das Verhältnis zwischen Bildung und Wirtschaft neu betrachtet und bewertet werden. Dabei stellen sich die zentralen Fragen: Ist Bildung die neue zukunftsweisende und marktdominierende Ressource im internationalen Wettbewerb? Und ist die staatliche Investition in Bildung aus wirtschaftlicher Sicht begründbar?
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel dieser Arbeit ist einen Überblick zum Verhältnis von Bildung und Wirtschaft zu geben und daraus Schlüsse über die Prognosekraft von Bildungsinvestitionen und -leistungen zu ziehen. Das entwickelte theoretische Konzept und die Prognose wird durch einen exemplarischen empirischen Beleg getestet. Die Arbeit stellt dabei durchgehend den wirtschaftlichen Nutzen und Effekt von Bildung in den Vordergrund. Weitere Aufgaben von Bildungseinrichtungen, wie die Betreuung von Kindern oder den gesellschaftlichen Erziehungsauftrag, werden nur am Rande thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Bildung als wirtschaftliche Investition in Humankapital
- Wirtschaftsleistung und -prognose
- Bildungsökonomie als Konjunkturindikator
- Hypothesen
- Empirie
- Hypothesen-Tests
- Erste Hypothese
- Zweite Hypothese
- Dritte Hypothese
- Vierte Hypothese
- Exemplarische Analyse der Situation in Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen staatlichen Bildungsausgaben und zukünftigem Wirtschaftswachstum. Sie zielt darauf ab, zu klären, ob staatliche Bildungsausgaben als relevanter Konjunkturindikator dienen können. Dies geschieht anhand eines theoretischen Modells, welches durch empirische Daten überprüft wird.
- Bildung als Investition in Humankapital
- Der Einfluss von Bildung auf Wirtschaftswachstum
- Staatliche Bildungsausgaben als Konjunkturindikator
- Analyse der PISA-Ergebnisse und des BIP
- Theoretische und empirische Überprüfung von Hypothesen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Eignung staatlicher Bildungsausgaben als zukünftiger Konjunkturindikator vor und begründet die Relevanz der Thematik anhand des Zusammenhangs von Bildung, Armut und wirtschaftlicher Entwicklung. Sie skizziert das Ziel der Arbeit – einen Überblick zum Verhältnis von Bildung und Wirtschaft zu geben und Prognosen zu deren Zusammenhängen zu ziehen – und beschreibt die Methodik, die auf der Humankapitaltheorie aufbaut und durch empirische Daten gestützt wird. Der Fokus liegt dabei auf dem wirtschaftlichen Nutzen von Bildung.
Theorie: Dieses Kapitel erläutert den Zusammenhang zwischen Bildung und Wirtschaft. Es argumentiert gegen die These einer gegenseitigen Ausschließlichkeit pädagogischer und ökonomischer Perspektiven und betont deren langfristige Verflechtung. Es werden grundlegende Begriffe definiert, das Verhältnis beider Bereiche diskutiert und die Humankapitaltheorie als theoretische Grundlage eingeführt. Der Bildungsbegriff wird nicht nur als kausal mit wirtschaftlichem Wachstum verknüpft, sondern als dessen Grundstein betrachtet, was den Umkehrschluss im Rahmen einer Prognose ermöglicht. Es werden die vier zentralen Hypothesen der Arbeit hergeleitet.
Empirie: Der empirische Teil überprüft die im Theorieteil aufgestellten Hypothesen. Er verwendet PISA-Untersuchungen als Indikatoren für den Bildungsoutput und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maß für das Wirtschaftswachstum. Die Kapitel beschreibt die Datenbasis und Methodik des empirischen Tests der vier Hypothesen. Eine exemplarische Analyse der Situation in Deutschland wird ebenfalls durchgeführt. Es werden die Ergebnisse der Hypothesentests zusammengefasst und interpretiert.
Schlüsselwörter
Staatliche Bildungsausgaben, Konjunkturindikator, Humankapital, Wirtschaftswachstum, PISA-Studie, Bildungsökonomie, BIP, Prognose, Empirische Analyse, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zusammenhang Staatliche Bildungsausgaben und Wirtschaftswachstum
Was ist der zentrale Forschungsgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen staatlichen Bildungsausgaben und zukünftigem Wirtschaftswachstum. Der Fokus liegt auf der Frage, ob staatliche Bildungsausgaben als relevanter Konjunkturindikator dienen können.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Modellierung mit empirischer Datenanalyse. Als theoretische Grundlage dient die Humankapitaltheorie. Empirisch werden PISA-Untersuchungen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verwendet, um die aufgestellten Hypothesen zu überprüfen.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit formuliert vier zentrale Hypothesen, die den Zusammenhang zwischen Bildungsausgaben und Wirtschaftswachstum untersuchen. Die genauen Hypothesen werden im Kapitel "Hypothesen" detailliert dargelegt. Der empirische Teil der Arbeit testet diese Hypothesen anhand der gesammelten Daten.
Welche Daten werden verwendet?
Die empirische Analyse basiert auf Daten aus PISA-Studien (als Indikator für den Bildungsoutput) und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maß für das Wirtschaftswachstum. Eine exemplarische Analyse konzentriert sich auf die Situation in Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Theoriekapitel, ein Empirie-Kapitel und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor. Das Theoriekapitel erläutert den Zusammenhang zwischen Bildung und Wirtschaft und leitet die Hypothesen ab. Das Empirie-Kapitel präsentiert die Datenanalyse und die Ergebnisse der Hypothesentests. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Begriff "Bildung" in der Arbeit definiert?
Der Bildungsbegriff wird nicht nur als kausal mit wirtschaftlichem Wachstum verknüpft, sondern als dessen Grundstein betrachtet. Dies ermöglicht den Umkehrschluss im Rahmen einer Prognose.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der empirischen Überprüfung der Hypothesen zusammen und bewertet die Eignung staatlicher Bildungsausgaben als Konjunkturindikator. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit-Kapitel der Arbeit zu finden.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Staatliche Bildungsausgaben, Konjunkturindikator, Humankapital, Wirtschaftswachstum, PISA-Studie, Bildungsökonomie, BIP, Prognose, Empirische Analyse, Deutschland.
- Quote paper
- Ben Kohz (Author), 2018, Staatliche Bildungsinvestitionen als Konjunkturindikator, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704231