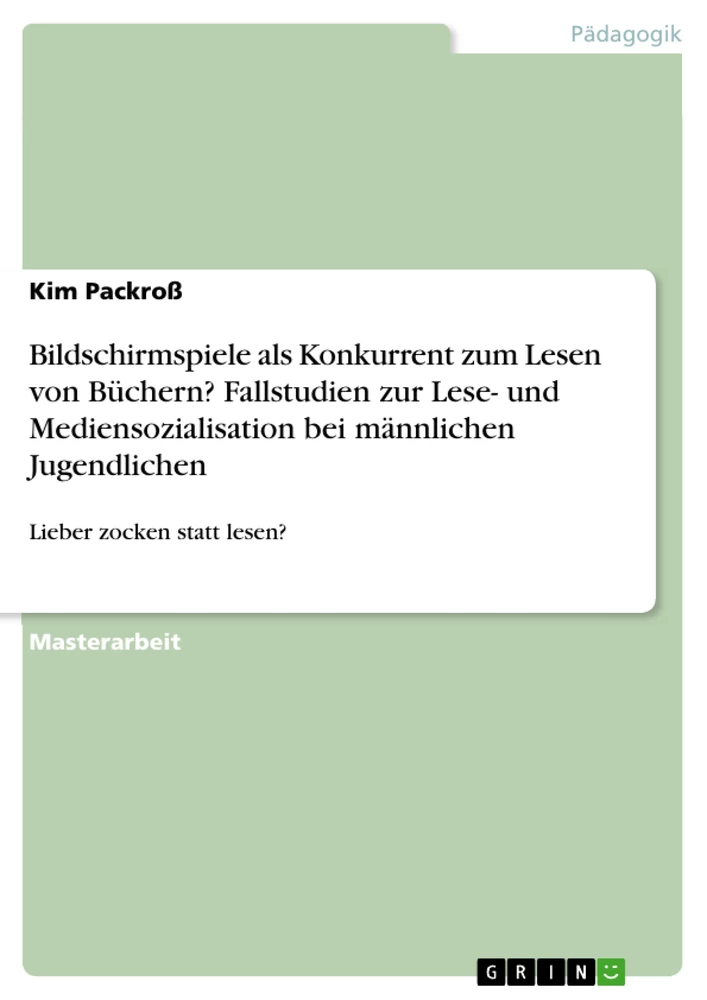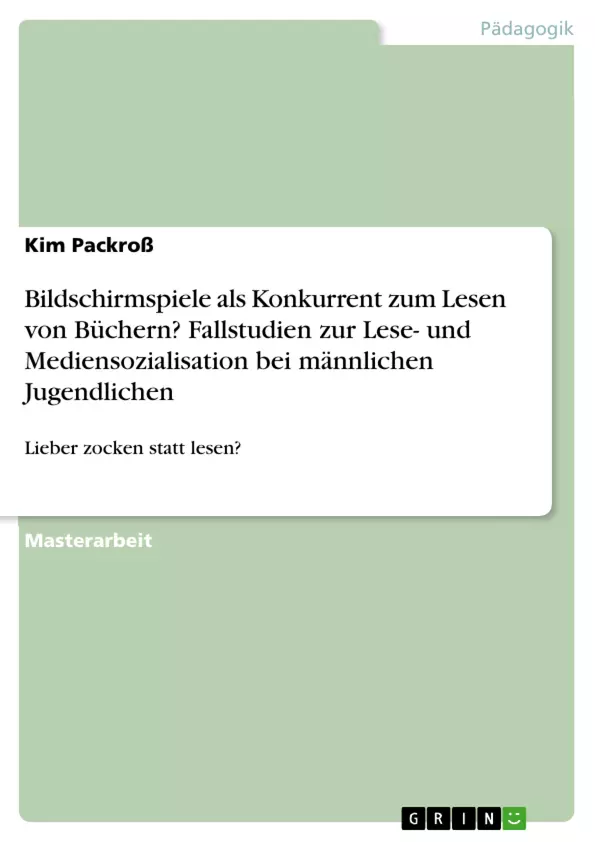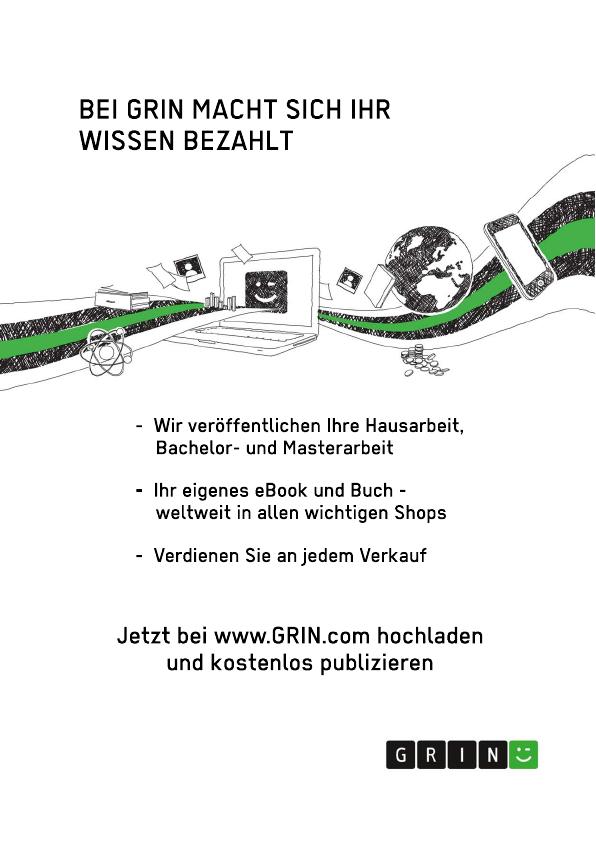Die Abschlussarbeit untersucht, inwiefern Bildschirmspiele ein Konkurrent zum Bücherlesen bei Jungen sind. Basierend auf dem bisherigen Forschungsstand soll weiterhin folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie hängt die Nutzung von Bildschirmspielen bei Jungen mit ihren Lesegewohnheiten sowie ihrer Leselust zusammen? Welchen Stellenwert hat das Spielen von Bildschirmspielen verglichen mit dem Bücherlesen für Jungen? Was fasziniert sie an Bildschirmspielen gegenüber dem Lesen von Büchern? Um diese Fragen beantworten zu können, wird einerseits das Thema Jungen und Lesen/Bildschirmspiele fachwissenschaftlich beleuchtet. Andererseits wurden Interviews mit Jungen durchgeführt und ausgewertet.
Die Studienergebnisse der Schulleistungsstudie PISA aus dem Jahre 2000 sorgten im gesellschaftlichen Diskurs für Aufruhr und führten zum PISA-Schock, da laut der Ergebnisse circa ein Viertel der getesteten 15-jährigen Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit nur mit minimalen Lesefähigkeiten ausgestattet waren. Das Thema Geschlecht und Lesen erhält seit jeher vermehrte Aufmerksamkeit, da der Leseleistungstest unzureichende Lesekompetenzen und eine fehlende Lesemotivation seitens der Jungen offenlegte. Ähnlich wie in PISA zeigt sich auch in JIM 2017, dass der Stellenwert des Lesens in der Freizeit bei Jungen deutlich geringer ausfällt als bei Mädchen: Lediglich 32% aller getesteten Jungen lesen täglich beziehungsweise mehrmals pro Woche Bücher.
Demgegenüber ist der Anteil an männlichen Nichtlesern mit 24% mehr als doppelt so hoch wie bei Mädchen. Ganz anders sieht das Mediennutzungsverhalten von Jungen im Bereich der Bildschirmspiele aus: Insgesamt 83% der Jungen gaben an, täglich beziehungsweise mehrmalig pro Woche über den Computer oder über tragbare oder stationäre Konsolen wie etwa dem Smartphone oder Tablet zu spielen. Anders gesagt, spielen vier von fünf Jungen, aber nur zwei von fünf Mädchen täglich oder mindestens mehrmals pro Woche Bildschirmspiele.
Diese Befunde legen nahe, dass Bildschirmspiele zunehmend in den Alltag der Jungen integriert sind und im Gegensatz zum Bücherlesen eine große Rolle in ihrer Freizeit spielen. Somit verweisen die Ergebnisse in PISA in Verbindung mit den Befunden der JIM-Studie auf die Problematik hin, dass Jungen in der Regel nicht nur weniger lesekompetent sind, sondern sich in ihrer Freizeit auch lieber Bildschirmspielen statt Printmedien zuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Jungen und Lesen
- 2.1 Geschlechterdifferenzen beim Lesen
- 2.2 Lesekrise in der Pubertät im Zusammenhang mit dem Einfluss der peers
- 2.3 Erklärungsansätze für das Leseverhalten von Jungen
- 2.3.1 Feminisierung der Lesesozialisation
- 2.3.2 Mediensozialisation – Veränderungen im Medienangebot
- 3 Jungen und Bildschirmspiele
- 3.1 Was sind Bildschirmspiele? – Definition und Klassifizierung
- 3.2 Nutzungsverhalten in der Freizeit und Spielvorlieben
- 3.3 Faszination an Bildschirmspielen
- 4 Forschungsdesign
- 4.1 Erhebungsmethode: Leitfadeninterview mit Audioaufzeichnung
- 4.2 Pretest und Fallauswahl
- 4.3 Untersuchungsverlauf: Interviewumstände und -bedingungen
- 4.4 Auswertungsmethode: Rekonstruktiver Fallanalyse
- 5 Auswertung der Interviewstudie
- 5.1 Bens Medienportrait: „Lesen ist ein wichtiger Teil meines Lebens”
- 5.2 Marcels Medienportrait: „Wenn ich lese, prahle ich schon damit herum”
- 5.3 Nicks Kurzportrait „Ich bin nicht so der Lesetyp”
- 5.4 Toms Kurzportrait, „So normal lese ich nicht so viel”
- 5.5 Queranalyse aller vier Fälle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht das Leseverhalten männlicher Jugendlicher im Kontext der digitalen Medienlandschaft. Sie analysiert, inwieweit Bildschirmspiele als Konkurrent zum Bücherlesen betrachtet werden können und welche Faktoren die Lese- und Mediensozialisation von Jungen beeinflussen.
- Geschlechterdifferenzen im Leseverhalten
- Die Rolle von Bildschirmspielen in der Freizeit von Jungen
- Einflussfaktoren auf die Lese- und Mediensozialisation
- Analyse des Mediennutzungsverhaltens anhand von Fallstudien
- Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Mediennutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Jungen und Lesen" ein und beleuchtet den „PISA-Schock“, der aufgrund der Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie entstand. Sie zeigt, dass die Lesekompetenz von Jungen im Vergleich zu Mädchen deutlich geringer ist. Kapitel 2 geht näher auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Leseverhalten ein und analysiert die Lesekrise in der Pubertät sowie verschiedene Erklärungsansätze. Kapitel 3 befasst sich mit Bildschirmspielen und deren Bedeutung in der Freizeit von Jungen. Es analysiert Nutzungsverhalten, Spielvorlieben und die Faszination, die von Bildschirmspielen ausgeht. In Kapitel 4 wird das Forschungsdesign der Arbeit vorgestellt, welches auf einer Interviewstudie basiert. Kapitel 5 analysiert die Ergebnisse der Interviewstudie anhand von vier Fallstudien und zeigt die Medienportraits der befragten Jungen. Die Arbeit berücksichtigt dabei, dass Jungen als Individuen mit unterschiedlichen Biografien, Eigenschaften und Vorlieben betrachtet werden sollten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Lesen, Bildschirmspiele, Mediensozialisation, Geschlechterdifferenzen, Lesekompetenz, Jugend, Fallstudien, qualitative Forschung, PISA-Studie, JIM-Studie. Sie analysiert die Entwicklung von Lesekompetenz und -motivation im Kontext der digitalen Medienwelt und beleuchtet die Rolle von Bildschirmspielen als potenzielle Konkurrenten zum Bücherlesen.
- Citation du texte
- Kim Packroß (Auteur), 2018, Bildschirmspiele als Konkurrent zum Lesen von Büchern? Fallstudien zur Lese- und Mediensozialisation bei männlichen Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704369