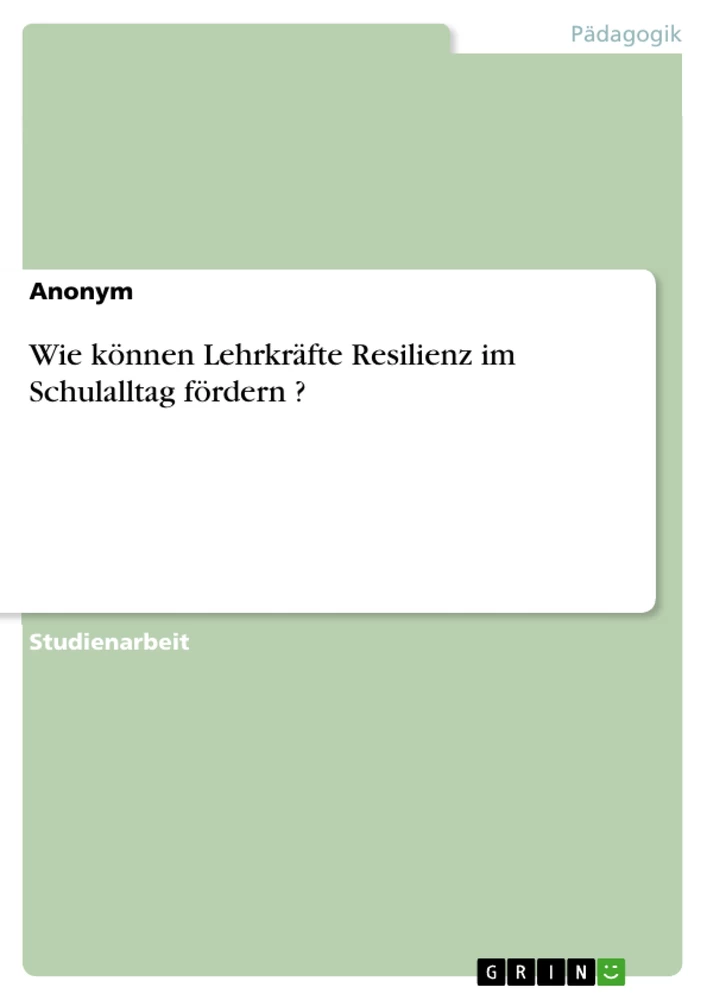Diese Hausarbeit setzt sich damit auseinander, was Resilienz ist, welche Faktoren für die Resilienz bestimmend sind und wie Resilienzförderung in Theorie und Praxis aussehen kann.
Der Eintritt in das deutsche Schulsystem beginnt mit dem Eintritt in die Grundschule. Schüler und Schülerinnen sollen hier eine grundlegende Bildung erhalten, die sie für einen Besuch einer weiterführenden Schule qualifiziert. Dabei knüpfen Lehrer und Lehrerinnen bei der Vermittlung von Wissen an bereits bestehende Grundkenntnisse an. Die Entwicklung dieser Grundkenntnisse, die die Grundschullehrerin und Autorin Helga Fell treffender als „Alltags und Lebenskompetenzen“ (Fell 2012) bezeichnet, beginnt direkt nach der Geburt. In der Nullklasse der Grundschule XY sitzen 16 Schüler und Schülerinnen, überwiegend Jungen, im Alter von 5-7 Jahren. Die Klasse besteht aus Grundschulkindern, Kindergartenkindern und schulfähigen Kindergartenkindern, die ins letzte Kindergartenjahr zurückgestellt wurden. Sie unterscheiden sich wie alle weiteren Grundschulklassen in Bezug auf Alter, Geschlecht, familiäre Situation, Muttersprache, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Begabung, Interesse und Leistungsbereitschaft. Jedes dieser Kinder benötigt in irgendeiner Form Förderung. Einige müssen emotional-sozial gefördert werden, andere motorisch und wieder andere haben einen Sprachförderbedarf. Lehrer und Lehrerinnen sind also dazu angehalten „Kinder mit unterschiedlichen individuellen Lernvorraussetzungen und Lernfähigkeiten so zu fördern, daß sich Grundlagen für selbstständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln“. (KMK, 1994).
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RAHMENBEDINGUNGEN
- 3. RESILIENZFAKTOREN
- 4. RESILIENZFÖRDERUNG IN DER THEORIE
- 5. METHODISCHES VORGEHEN
- 5.1 WAHL DER METHODE: TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG
- 5.2 DURCHFÜHRUNG DER METHODE
- 5.3 ERGEBNISSE
- 6. FAZIT
- 7. QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung untersucht die Bedeutung von Resilienz im Schulalltag und analysiert, wie Lehrkräfte diese fördern können. Der Fokus liegt dabei auf der Praxis und der konkreten Umsetzung von Resilienzförderung in einer Nullklasse. Die Ausarbeitung zeigt zudem die Relevanz der Thematik im Kontext von Entwicklungsstörungen und den Herausforderungen, denen Kinder in den ersten Jahren des Schulbesuchs begegnen können.
- Resilienz als Schutzfaktor für Kinder in herausfordernden Lebensumständen
- Die Rolle von Lehrkräften bei der Förderung von Resilienz
- Entwicklung von Resilienz im Kontext der Nullklasse
- Methodische Vorgehensweisen zur Beobachtung und Analyse von Resilienz
- Praktische Implikationen für die pädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Resilienzförderung im Schulalltag ein und beleuchtet die Bedeutung von Grundkenntnissen und „Alltags- und Lebenskompetenzen“ (Fell 2012, S. 4) für die Entwicklung von Kindern. Das Kapitel erläutert das Konzept der Nullklasse als ein Modell zur Unterstützung von Vorschulkindern, Erstklässlern und Erstklässlerinnen bei ihrem Übergang in die Schule. Der Begriff der Resilienz wird im Kontext von Entwicklungsstörungen und schwierigen Lebensumständen eingeführt.
Das Kapitel „Rahmenbedingungen“ beschreibt die Besonderheiten der Nullklasse und die Herausforderungen, denen Kinder in diesem Kontext begegnen. Es erläutert das Konzept der „ganzheitlichen Förderung“ (Fell 2012, S. 10) und hebt die Bedeutung von spiel- und lernbasierten Angeboten für die Entwicklung der Kinder hervor.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit den Themen Resilienz, Schulalltag, Nullklasse, Entwicklungsstörungen, emotionale und soziale Entwicklung, Förderung, Lehrkräfte, pädagogische Praxis, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, Kindheitstraumata, Familienverhältnisse und methodische Vorgehensweisen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Wie können Lehrkräfte Resilienz im Schulalltag fördern ?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704492