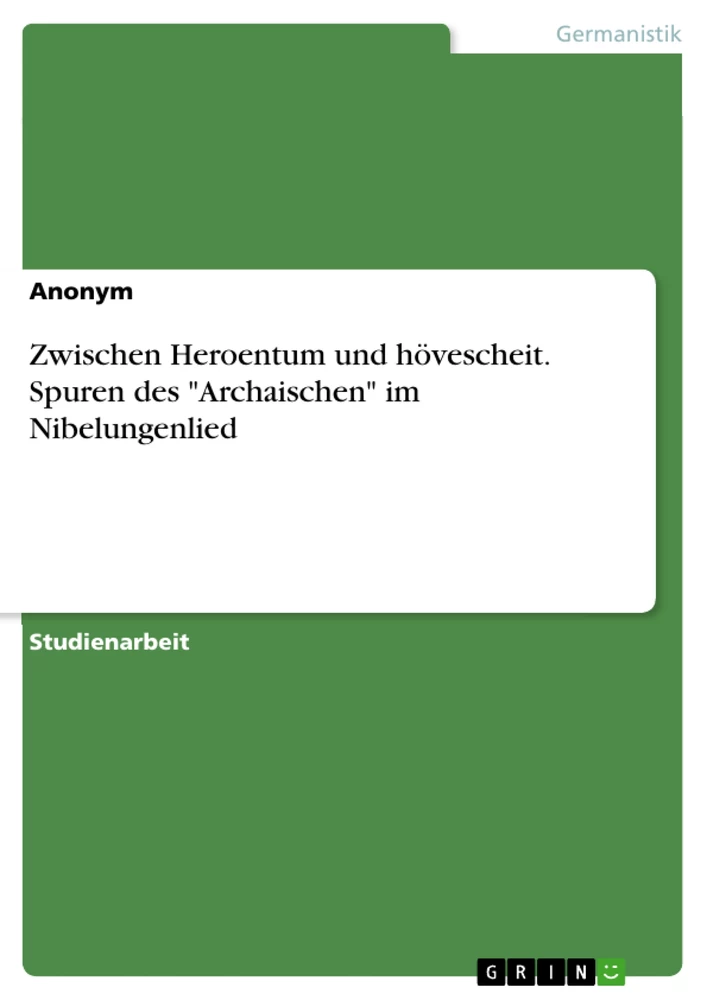Diese Arbeit wird sich allgemein dem Ambivalenzverhältnis von Heroentum und hövescheit im Nibelungenlied widmen, das sich aus der narrativen Anlage des Textes ergibt. Sie fragt dabei im Speziellen nach den Spuren ‚archaischer‘ oder ‚heroischer‘ Reflexe und möchte an konkreten Beispielen festmachen, wo diese zum Ausdruck kommen. Dabei wird aber keine Wertung oder gar Abqualifizierung des Werkes angestrebt. Die Dissonanzen sollen vielmehr als charakteristisch für die Poetik des Textes herausgestellt werden. Zu diesem Zweck wird das Spannungsverhältnis zunächst allgemein in den Blick genommen und in aller Kürze vor dem Horizont der Gattungszugehörigkeit diskutiert. Im Weiteren werden die zwei divergierenden Weltbilder inhaltlich überblicksartig beleuchtet, bevor anschließend auf einige exemplarische Textstellen eingegangen wird. Zuletzt werden die gewonnenen Erkenntnisse in einer Zusammenfassung reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen zum Nibelungenlied
- Dilemmata der Gattungszuordnung
- Divergierende Weltbilder: heroisches und höfisches Ideal
- Zur Analyse einiger exemplarischer Beispiele: ambivalentes Personal
- Die Einführung Siegfrieds und Kriemhilds
- Siegfrieds Ankunft am Wormser Hof
- Hagen als Heros
- Zu einigen heroischen Qualitäten: zorn und übermuot
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Spannungsverhältnis von Heroentum und hövescheit im Nibelungenlied, das sich aus der narrativen Anlage des Textes ergibt. Sie untersucht die Spuren von „archaischen“ oder „heroischen“ Reflexen und analysiert, wie diese zum Ausdruck kommen. Der Fokus liegt dabei nicht auf einer Wertung des Werkes, sondern auf der Hervorhebung der Dissonanzen als charakteristisches Merkmal der Poetik des Textes.
- Ambivalenz zwischen Heroentum und höfischem Ideal im Nibelungenlied
- Spuren von „archaischen“ oder „heroischen“ Reflexen
- Analyse exemplarischer Textstellen
- Gattungstheoretische Einordnung des Nibelungenliedes
- Divergierende Weltbilder: heroisches und höfisches Ideal
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitende Bemerkungen zum Nibelungenlied: Das Nibelungenlied ist ein bekanntes Werk mittelhochdeutscher Literatur, dessen Entstehung auf mehrere Überlieferungsschichten zurückzuführen ist. Es vereint Elemente der Völkerwanderungszeit mit einer narrativen Überformung, wodurch zwei divergierende Weltbilder aufeinandertreffen: das heroische und das höfische Ideal. Die Dissonanzen zwischen diesen Welten werden in der Seminararbeit als charakteristisches Merkmal der Poetik des Textes analysiert.
- Dilemmata der Gattungszuordnung: Die gattungstheoretische Einordnung des Nibelungenliedes ist problematisch, da es Elemente der Heldenepik und des höfischen Romans aufweist. Traditionell wird es als Heldenepos kategorisiert, jedoch zeigt es gleichzeitig Merkmale des höfischen Romans, wie beispielsweise politische Intrigen.
- Divergierende Weltbilder: heroisches und höfisches Ideal: Das Nibelungenlied zeigt ein Spannungsverhältnis zwischen zwei divergierenden Weltbildern: dem heroischen Ideal mit seinen archaischen Reflexen und dem höfischen Ideal, das durch christliche Werte geprägt ist. Diese Divergenz zeigt sich in den Charakteren, den Handlungssträngen und der erzählerischen Struktur des Werkes.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Nibelungenliedes sind Heroentum, höfisches Ideal, „archaische“ Reflexe, mittelalterliche Literatur, Gattungszuordnung, Heldenepik, höfischer Roman, Divergenz von Weltbildern, Spannungsverhältnis, Poetik des Textes.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit zum Nibelungenlied?
Die Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem archaischen Heroentum (Heldenideal) und der höfischen Kultur (hövescheit) im Nibelungenlied.
Warum ist die Gattungszuordnung des Nibelungenliedes schwierig?
Es vereint Elemente des traditionellen Heldenepos mit Merkmalen des höfischen Romans, was zu literarischen Dissonanzen in der Erzählstruktur führt.
Wie zeigt sich das "Archaische" in der Figur des Siegfried?
Siegfrieds Ankunft am Wormser Hof und sein Verhalten spiegeln heroische Qualitäten wie übermuot (Übermut) und körperliche Überlegenheit wider, die mit dem höfischen Protokoll kollidieren.
Welche Rolle spielt Hagen von Tronje in diesem Kontext?
Hagen wird in der Arbeit als der klassische "Heros" analysiert, dessen Handeln oft von archaischen Reflexen und einer unbedingten Treuepflicht geprägt ist.
Was bedeuten die Begriffe "zorn" und "übermuot" im Epos?
Diese Begriffe bezeichnen heroische Affekte und Verhaltensweisen, die den Untergang der burgundischen Welt im Spannungsfeld zwischen Ehre und Gewalt vorantreiben.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Zwischen Heroentum und hövescheit. Spuren des "Archaischen" im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704674