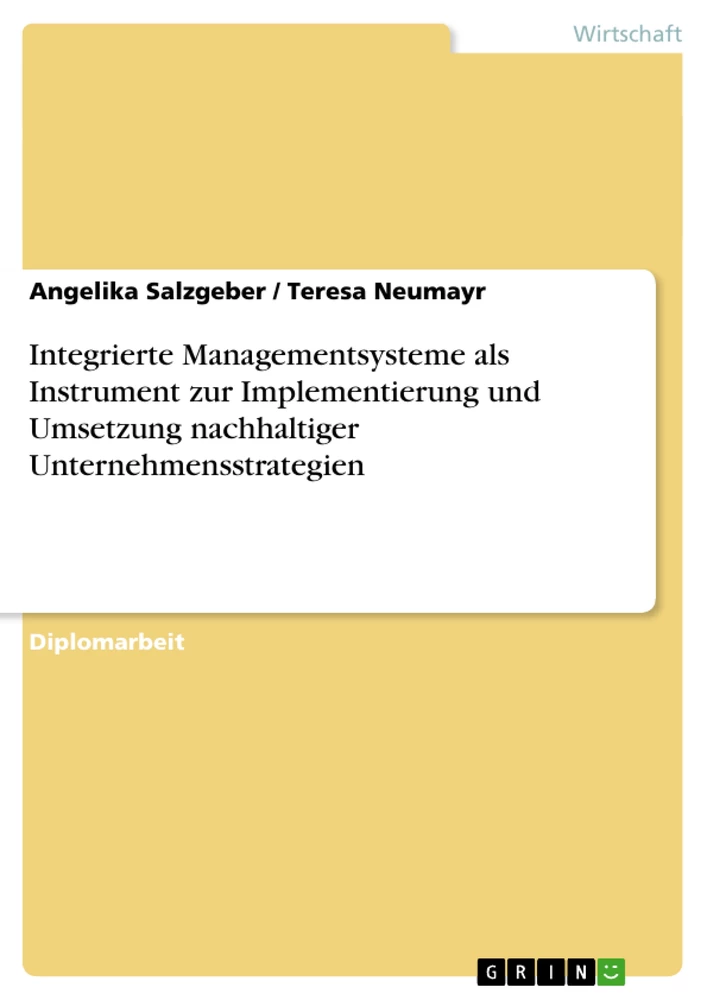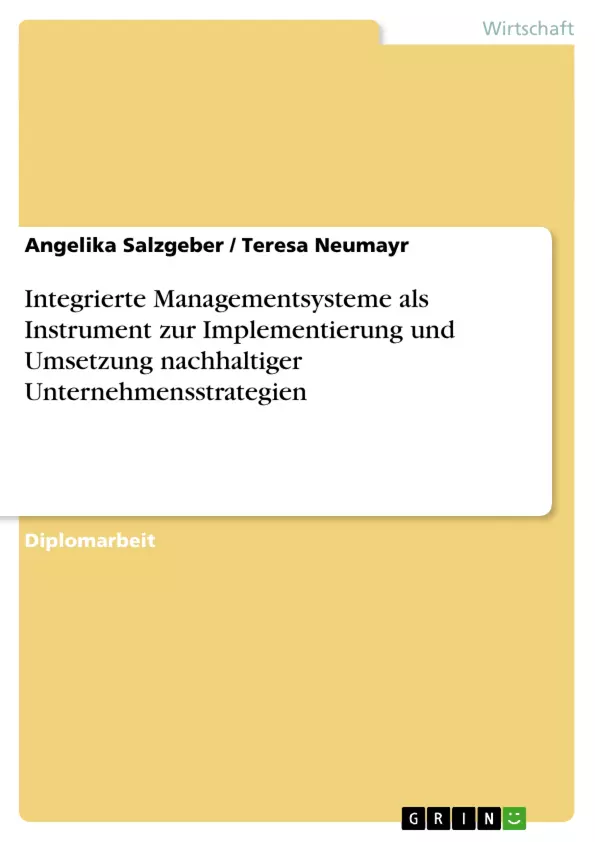Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht einerseits darin, alle derzeit bestehenden nachhaltigen integrierten Systeme und Systemversuche in einem Werk zusammengefasst vorzustellen und aufzuarbeiten und andererseits, am Ende der Arbeit alle behandelten Managementsysteme anhand bestimmter, von uns festgelegter Kriterien zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Differenzen feststellen zu können.
In Bezug auf isolierte und integrierte Managementsysteme existiert eine große Bandbreite an Systemen und entsprechender Literatur. Jedoch wurde in letzter Zeit, wie bereits zuvor erwähnt, das große Wertschöpfungspotenzial von integrierten Managementsystemen zur Umsetzung unternehmerischer Nachhaltigkeit erkannt. Allerdings ist in diesem Bereich der Forschungsstand und dementsprechend die Literatur noch nicht sehr ausgereift.
Während im Zusammenhang mit Managementsystemen zur Integration von Nachhaltigkeit versucht wurde, alle derzeit existierenden und sich im Aufbau befindlichen Ansätze zu erfassen, wurde im Bereich der integrierten Managementsysteme einerseits eine Auswahl der bekanntesten und wichtigsten Systeme vorgenommen und andererseits jene Systeme vorgestellt, auf denen nachhaltige integrierte Systeme aufbauen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- HINTERGRUND & PROBLEMSTELLUNG
- ZIELSETZUNG DER ARBEIT UND THEMATISCHE ABGRENZUNG
- GEDANKLICHER AUFBAU DER ARBEIT
- NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
- GESCHICHTE DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG
- CLUB OF ROME
- BRUNDTLAND-BERICHT
- WEG VON RIO 1992 BIS JOHANNESBURG 2002 (THE JOURNEY OF HOPE)
- DEFINITORISCHE BEGRIFFSGRUNDLAGE
- GRÜNDE FÜR NACHHALTIGKEIT
- SÄULEN DER NACHHALTIGKEIT
- ÖKONOMISCHE SÄULE
- ÖKOLOGISCHE SÄULE
- SOZIALE SÄULE
- UMSETZUNG VON UNTERNEHMERISCHER NACHHALTIGKEIT
- VERHALTENSASPEKTE BEI DER UMSETZUNG
- Menschenbild der Nachhaltigkeit – der „homo sustinens”
- Der Homo sustinens in der betriebswirtschaftlichen Umsetzung
- Unternehmenskultur
- ORGANISATIONALES LERNEN ZUR UMSETZUNG
- Organisationales Lernen nach Brühl (2004)
- Organisationales Lernen nach Argyris (1994)
- Organisationales Lernen nach Schön (1983)
- STRATEGIEN ZUR UMSETZUNG
- Effizienzstrategie
- Konsistenzstrategie
- Suffizienzstrategie
- NACHHALTIGKEITSORIENTIERTE WETTBEWERBSSTRATEGIEN
- Strategietyp „sicher“: Verminderung beziehungsweise Beherrschung von Risiken
- Strategietyp „glaubwürdig“: Verbesserung von Image und Reputation
- Strategietyp „effizient\": Verbesserung von Produktivität und Effizienz
- Strategietyp „innovativ\": Differenzierung im Markt
- Strategietyp „transformativ\": Nachhaltige Marktentwicklung
- SYSTEME ZUR UMSETZUNG
- EINFÜHRUNG IN DIE MANAGEMENTSYSTEME
- DEFINITORISCHE ABGRENZUNG MANAGEMENTSYSTEM
- UMWELTMANAGEMENTSYSTEME
- EMAS - BETRIEBLICHES UMWELTMANAGEMENTSYSTEM
- ISO 14001
- UNTERSCHIEDE EMAS UND ISO 14001
- MANAGEMENTSYSTEME FÜR DIE SOZIALE DIMENSION DER NACHHALTIGKEIT
- ARBEITSSICHERHEITSMANAGEMENT, GESUNDHEITSSCHUTZ
- SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000
- ACCOUNT ABILITY 1000
- QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEME
- EINFÜHRUNG IN DAS QUALITÄTSMANAGEMENT
- MOTIVE FÜR DIE EINFÜHRUNG VON QUALITÄTSMANAGEMENT
- BEGRIFFSERKLÄRUNG „QUALITÄT”
- INTEGRIERTE MANAGEMENTSYSTEME
- ENTWICKLUNG
- DEFINITORISCHE ABGRENZUNG UND VORTEILE EINER INTEGRATION
- FORMEN DER INTEGRATION
- PARTIELLE INTEGRATION
- PROZESSORIENTIERTE INTEGRATION
- SYSTEMÜBERGREIFENDE INTEGRATION
- VORREITERMODELLE FÜR INTEGRIERTES MANAGEMENT
- ST. GALLER MANAGEMENT-MODELL
- MODELL DER STRATEGISCHEN UNTERNEHMENSFÜHRUNG NACH HINTERHUBER
- KRITIK AN INTEGRIERTEN MANAGEMENTSYSTEMEN
- NEUE GENERATION VON INTEGRIERTEN MANAGEMENTSYSTEMEN
- GENERIC MANAGEMENT SYSTEMS
- NACHHALTIGKEITSMANAGEMENTSYSTEME
- Faktoren für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg
- NACHHALTIGKEITSMANAGEMENTSYSTEME UND IHRE ZU GRUNDE LIEGENDEN MODELLE
- TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)
- ANFORDERUNGEN AN QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEME
- TRAGENDE ELEMENTE EINES QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEMS
- TRAGENDe Elemente bei DER UMSETZUNG EINES TQM-MODELLS
- Kundenorientierung
- Führungsqualität
- Risk-Management
- Zielsetzungen und Maßnahmen in den verschiedenen Stadien der Herstellung
- IMPLEMENTIERUNG VON TQM
- UMSETZUNGSMODELLE VON TOTAL QUALITY MANAGEMENT
- Kulturtypus
- Lean-Management
- Kaizen
- European Quality Award als Umsetzung des TQM-Konzepts
- Normen für die Qualitätssicherung, Zertifizierung
- TQM ALS INTEGRATIVES MANAGEMENTKONZEPT
- ÜBERBLICK
- TOTAL QUALITY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
- Basiselemente von TQEM
- Implementierung eines TQEM-Programms
- Nachhaltige Entwicklung als Konzept und ihre Umsetzung in Unternehmen
- Die Bedeutung von Managementsystemen für die Implementierung nachhaltiger Strategien
- Die verschiedenen Formen der Integration von Managementsystemen
- Die Rolle von Total Quality Management (TQM) als integratives Managementkonzept für nachhaltiges Handeln
- Die Anwendung von integrierten Managementsystemen in der Praxis
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt den Hintergrund und die Problemstellung der Diplomarbeit vor. Die Arbeit fokussiert auf die Bedeutung von integrierten Managementsystemen als Instrument zur Implementierung und Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien. Die Zielsetzung der Arbeit und die thematische Abgrenzung werden klar definiert. Der gedankliche Aufbau der Arbeit wird erläutert.
- Kapitel 2: Das Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Es beleuchtet die Geschichte der nachhaltigen Entwicklung, definiert den Begriff und erläutert die Gründe für nachhaltiges Handeln. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit (ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit) werden detailliert dargestellt. Des Weiteren werden verschiedene Verhaltensaspekte, organisatorische Lernprozesse und Strategien zur Umsetzung von unternehmerischer Nachhaltigkeit diskutiert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die verschiedenen Managementsysteme, die für die Implementierung und Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien relevant sind. Es werden die verschiedenen Formen von Managementsystemen wie Umweltmanagementsysteme (EMAS, ISO 14001), Managementsysteme für die soziale Dimension der Nachhaltigkeit (Arbeitssicherheitsmanagement, Social Accountability 8000, Account Ability 1000) sowie Qualitätsmanagementsysteme (ISO 9001, TQM) vorgestellt.
- Kapitel 4: Das Kapitel behandelt die Entwicklung, Definition und Vorteile von integrierten Managementsystemen. Es werden verschiedene Formen der Integration (partielle, prozessorientierte, systemübergreifende Integration) sowie verschiedene Vorreitermodelle für integriertes Management (St. Galler Management-Modell, Modell der strategischen Unternehmensführung nach Hinterhuber) vorgestellt. Zudem wird die Kritik an integrierten Managementsystemen beleuchtet und die neue Generation von integrierten Managementsystemen (Generic Management Systems, Nachhaltigkeitsmanagementsysteme) vorgestellt.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept von Total Quality Management (TQM) als integratives Managementkonzept für nachhaltiges Handeln. Es wird die Entwicklung und die Anforderungen an TQM-Systeme erläutert. Die tragenden Elemente eines TQM-Systems werden vorgestellt und die Implementierung sowie verschiedene Umsetzungmodelle von TQM werden dargestellt. Das Kapitel stellt TQM als integratives Managementkonzept vor und gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte von TQM. Es schließt mit einer Diskussion von Total Quality Environmental Management (TQEM) als Erweiterung des TQM-Konzepts.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie integrierte Managementsysteme als Instrument zur Implementierung und Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien eingesetzt werden können. Die Arbeit analysiert die Entwicklung und die verschiedenen Formen der Integration von Managementsystemen und untersucht die Bedeutung von Total Quality Management (TQM) als integratives Managementkonzept für nachhaltiges unternehmerisches Handeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Diplomarbeit sind integrierte Managementsysteme, nachhaltige Unternehmensstrategien, Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, Qualitätsmanagement, Total Quality Management (TQM), Social Accountability, Integration, Managementmodelle, Nachhaltigkeitsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was sind integrierte Managementsysteme (IMS)?
Ein IMS fasst verschiedene Managementsysteme (z.B. für Qualität, Umwelt und Soziales) in einer einheitlichen Struktur zusammen, um Synergien zu nutzen und Nachhaltigkeit besser umzusetzen.
Welche Rolle spielt Total Quality Management (TQM) für die Nachhaltigkeit?
TQM dient als integratives Konzept, das durch Kundenorientierung, Führungsqualität und Risikomanagement die Basis für langfristigen unternehmerischen Erfolg und nachhaltiges Handeln bildet.
Was ist der Unterschied zwischen EMAS und ISO 14001?
Beide sind Umweltmanagementsysteme, wobei EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) oft über die Anforderungen der ISO 14001 hinausgeht, insbesondere durch die Pflicht zur Veröffentlichung einer Umwelterklärung.
Was versteht man unter den drei Säulen der Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit basiert auf der ökonomischen, ökologischen und sozialen Säule, die in einem IMS gleichberechtigt berücksichtigt werden sollten.
Welche Vorteile bietet die Integration von Managementsystemen?
Vorteile sind die Reduzierung von Doppelarbeit, klarere Verantwortlichkeiten, geringere Kosten für Audits und eine ganzheitliche Steuerung der Unternehmensstrategie.
- Citar trabajo
- Angelika Salzgeber (Autor), Teresa Neumayr (Autor), 2007, Integrierte Managementsysteme als Instrument zur Implementierung und Umsetzung nachhaltiger Unternehmensstrategien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70490