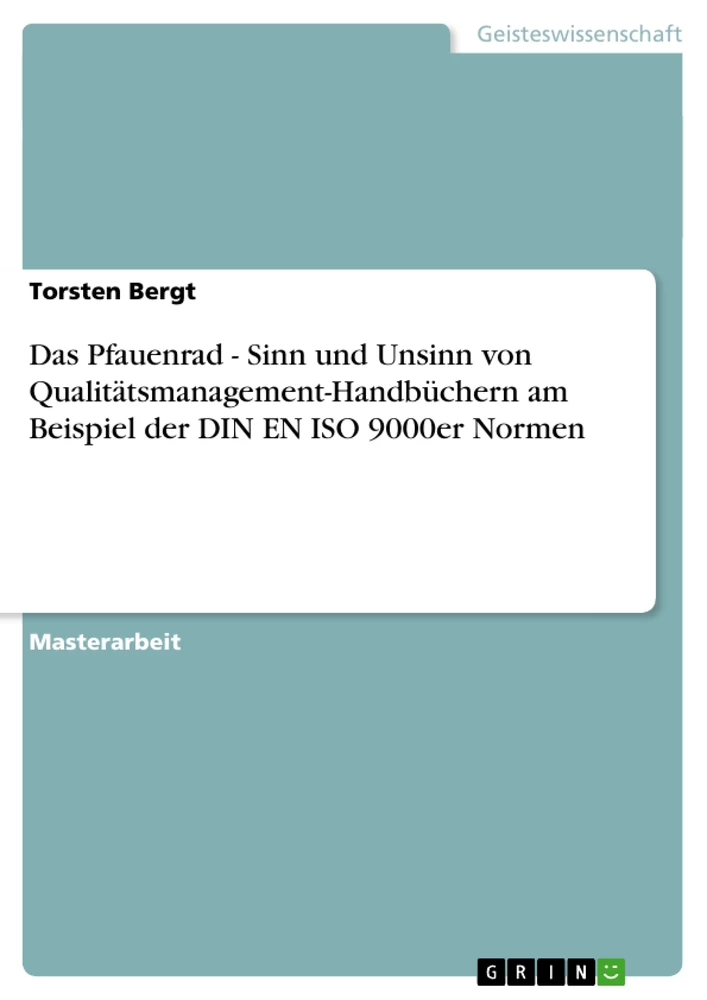Qualitätsmanagement-Handbücher gehören zu jenen Artefakten in Organisationen, welche eine unweigerliche Faszination ausstrahlen. Viel wird über sie geredet, viel wird an ihnen herumgebastelt, sie werden gelobt und sie werden verflucht. Diejenigen, die sie nicht haben, sind hin und her gerissen. Sie wollen sie zum einen in ihre Organisation einführen, um sich durch klare Standards und festgehaltenes Wissen Vorteile zu verschaffen. Andererseits wollen sie sie von ihrer Organisation fernhalten, da sie um bürokratische Zwänge wissen und diese fürchten.
Doch welche Organisation heute das Siegel der Zertifizierung tragen möchte, kommt, ob gewollt oder nicht, nicht mehr an Qualitätsmanagement-Handbüchern vorbei. Sie sind der Preis, so könnte man zynisch sagen, der für ein Zertifikat gezahlt werden muss. Sie sind die Federpracht, mit der sich eine Organisation schmücken kann.
Es stellt sich demnach durchaus die Frage, ob die Qualitätsmanagement-Handbücher nur für die (Re-)Zertifizierung erstellt und entstaubt werden, oder ob es außerhalb der Zertifizierungstretmühle noch weitere Perspektiven für diese Handbücher gibt.
Diese Arbeit stellt sich die Frage, ob Qualitätsmanagement-Handbücher tatsächlich als Werbebroschüre und Symbol für gute Qualität stehen, und ob es darüber hinaus noch andere Faktoren gibt, die in Organisationen einen Sinn für Qualitätsmanagement-Handbücher ergeben.
Was ist nun der Sinn dieser Qualitätsmanagement-Handbücher und was der Unsinn. Was bleibt darüber hinaus noch zu sagen? Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, auf diese und ähnliche Fragen Antworten zu geben und lädt Sie, geehrter Leser ein, sich mit auf eine sehr dokumentationslastige Entdeckungsreise zu begeben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Der Stand der Dinge
- 2.1 Qualitätsmanagement
- 2.2 Geschichte des Qualitätsmanagements
- 2.3 Qualitätsmanagementsysteme
- 2.4 DIN EN ISO 9000er Normen
- 3 Neo-Institutionalismus und Qualitätsmanagement
- 3.1 Definition des Neo-Institutionalismus
- 3.2 Anwendungsbereiche des Neo-Institutionalismus
- 3.3 Der Neo-Institutionalismus im Qualitätsmanagement
- 4 Die Qualitätsmanagement-Handbücher: Sinn und Unsinn
- 4.1 Die Entstehung von Qualitätsmanagement-Handbüchern
- 4.2 Die Funktion von Qualitätsmanagement-Handbüchern
- 4.3 Die Kritik an Qualitätsmanagement-Handbüchern
- 5 Empirische Untersuchung: Fallstudien
- 5.1 Das Unternehmen A
- 5.2 Das Unternehmen B
- 5.3 Das Unternehmen C
- 6 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Analyse von Qualitätsmanagement-Handbüchern im Kontext der DIN EN ISO 9000er Normen. Ziel ist es, den Sinn und Unsinn dieser Handbücher aus der Perspektive des Neo-Institutionalismus zu beleuchten. Dabei werden sowohl die Entstehung, Funktion und Kritik dieser Handbücher betrachtet als auch die Auswirkungen auf Unternehmen und Organisationen analysiert.
- Der Neo-Institutionalismus als theoretischer Rahmen
- Die Geschichte und Entwicklung des Qualitätsmanagements
- Die Rolle der DIN EN ISO 9000er Normen
- Die Funktion und Bedeutung von Qualitätsmanagement-Handbüchern
- Kritik und Probleme im Zusammenhang mit Qualitätsmanagement-Handbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Problemstellung dar. Kapitel 2 bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge im Qualitätsmanagement, wobei die Geschichte, die verschiedenen Managementsysteme und insbesondere die DIN EN ISO 9000er Normen erläutert werden. In Kapitel 3 wird der Neo-Institutionalismus als theoretischer Rahmen für die Analyse von Qualitätsmanagement-Handbüchern vorgestellt. Kapitel 4 befasst sich mit der Entstehung, Funktion und Kritik dieser Handbücher. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die in Form von Fallstudien durchgeführt wurde.
Schlüsselwörter
Qualitätsmanagement, DIN EN ISO 9000er Normen, Neo-Institutionalismus, Qualitätsmanagement-Handbücher, Zertifizierung, Unternehmenskultur, Bürokratie, Effizienz, Effektivität.
Häufig gestellte Fragen
Wozu dienen Qualitätsmanagement-Handbücher (QMH)?
QMH sollen Standards festlegen, Wissen sichern und sind oft eine notwendige Voraussetzung für eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.
Was ist die Kritik am "Pfauenrad"-Effekt von Handbüchern?
Der Begriff "Pfauenrad" deutet darauf hin, dass Handbücher oft nur als Symbol für Qualität nach außen dienen (Repräsentation), im Alltag aber kaum gelebt werden.
Was besagt der Neo-Institutionalismus im Kontext von QM?
Er erklärt, dass Organisationen QM-Systeme oft einführen, um gesellschaftliche Erwartungen an Legitimität zu erfüllen, auch wenn dies die interne Effizienz nicht zwingend steigert.
Sind QM-Handbücher heute noch zeitgemäß?
Die Arbeit untersucht, ob sie über die "Zertifizierungstretmühle" hinaus einen praktischen Nutzen bieten oder lediglich bürokratische Zwänge erzeugen.
Welche Rolle spielen die DIN EN ISO 9000er Normen?
Diese Normen bilden den weltweiten Standard für Qualitätsmanagementsysteme und definieren die Anforderungen an die Dokumentation.
- Quote paper
- Torsten Bergt (Author), 2007, Das Pfauenrad - Sinn und Unsinn von Qualitätsmanagement-Handbüchern am Beispiel der DIN EN ISO 9000er Normen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70504