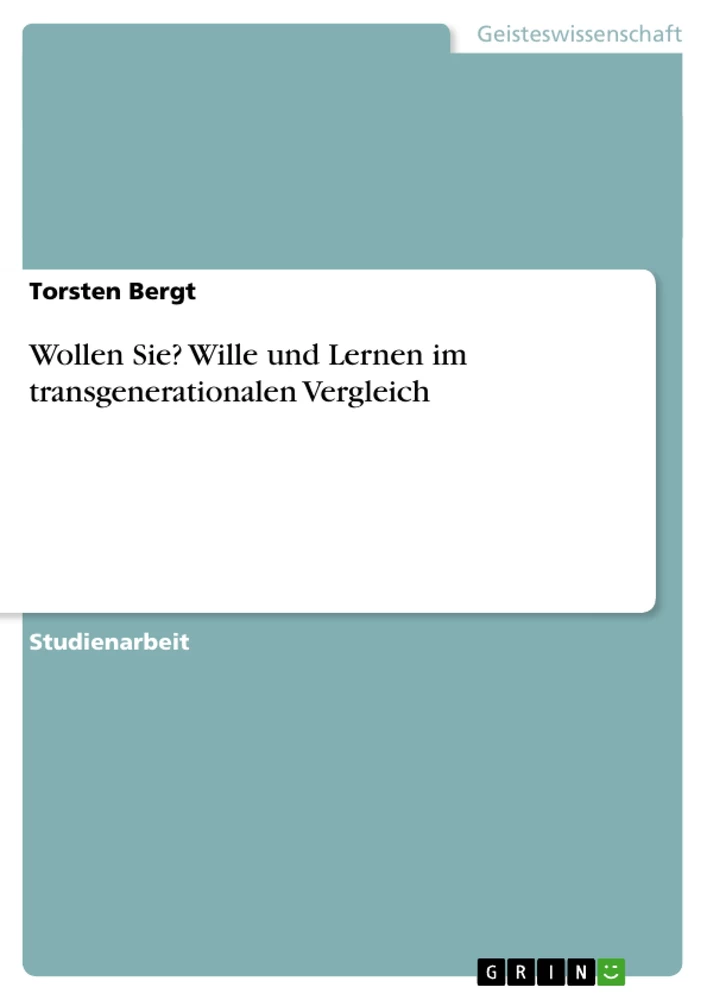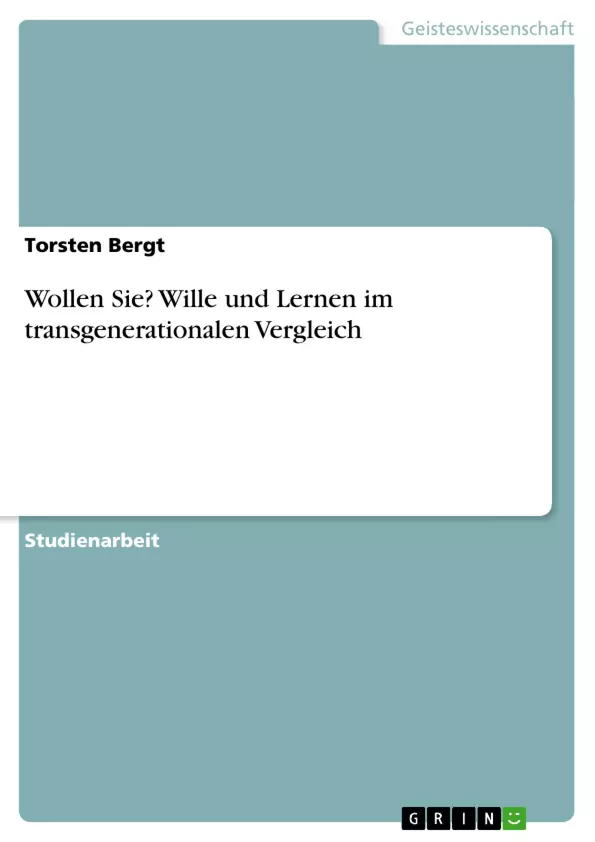„Ein altes japanisches Sprichwort lautet: Selbst auf einem Stein - drei Jahre. Das bedeutet, dass man selbst für etwas so Einfaches wie für das Sitzen auf einem Stein drei Jahre braucht, um es zu lernen.“ Nimmt man dieses Zitat ernst und denkt es weiter, so wird ersichtlich, warum Virtuosen, Olympiagewinner und Wissenschaftsexperten viele Jahre des Lernens und Übens darauf verwenden mussten, um an den Zenit ihres Könnens anzugelangen, der ihnen eben jenen Ruf des Einzigartigen verleiht.
Aber auch wenn es „nur“ darum geht, eine Fremdsprache zu erlernen oder ein schwerverständliches Fachbuch durchzuarbeiten, müssen gewisse Anforderungen vom Lerner erfüllt werden, um ausdauernd voranzuschreiten und nicht wie es Rousseau sagt: „Von der Natur und von den Menschen auf entgegengesetzte Bahnen gezogen, gezwungen, bald diesen, bald jenen Antrieben nachzugeben, lassen wir uns von einer Verquickung beider leiten und kommen so weder zu dem einen noch zu dem anderen Ziele. Solcherart geschlagen und schwankend das ganze Leben hindurch, beendigen wir es, ohne mit uns selbst einig geworden zu sein, ohne weder uns selbst noch anderen genutzt zu haben.“
Inhalt dieser Abhandlung soll es sein, in einem ersten Schritt darzulegen, wie der Begriff des Willens hier verstanden werden soll (II). Daran anschließend werden die notwendigen Voraussetzungen aufgezeigt, um Lernbemühungen über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten (III). Diese Voraussetzungen werden mit Erkenntnissen aus der Altersforschung gekoppelt, um zu zeigen, wie sich Willensanstrengungen im Alter verhalten können (IV). Abschließend soll der Versuch gewagt werden, die eruierten Bestandteile für ein kontinuierliches Lernen über verschiedene Lebensphasen hinweg, also transgenerational zu vergleichen (VI).
Die Fragen, die durch diese Abhandlung zur Lösung gebracht werden sollen sind, welche Differenzen bestehen zwischen jüngeren und älteren Personen bei der Ausdauer des Lernens und welche Gründe sind hierfür zu finden? Diese Fragestellungen erlangten insbesondere durch den Aspekt des „Lebenslangen Lernens“ und die Diskussion um die Einbeziehung älterer Arbeitnehmer an beruflichen Weiterbildungen an Interesse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wille und Volition
- Formen und Strategien zur Verhaltenssteuerung
- Wille und Alter
- Willenssteigerung im Alter
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen Wille, Lernen und Alter. Ziel ist es, zu verstehen, wie der Wille zum Lernen über verschiedene Lebensphasen hinweg funktioniert, insbesondere im Vergleich zwischen jüngeren und älteren Personen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Wille"
- Formen und Strategien der Verhaltenssteuerung, insbesondere Selbstkontrolle und Selbstregulation
- Einfluss von Alter auf Willensstärke und Lernmotivation
- Möglichkeiten zur Steigerung der Willenskraft im Alter
- Transgenerationale Aspekte des Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Wille und Lernen im transgenerationalen Vergleich" heraus und erläutert die Fragestellung, die im Verlauf der Arbeit untersucht wird.
- Wille und Volition: Dieses Kapitel definiert und erläutert den Begriff "Wille" und differenziert zwischen verschiedenen Konzepten der Volition, insbesondere dem imperativen und dem sequentiellen Modell.
- Formen und Strategien zur Verhaltenssteuerung: Hier werden fünf Formen der Verhaltenssteuerung, darunter Selbstkontrolle, Selbstregulation und Selbstorganisation, detailliert beschrieben und in Bezug auf ihre Relevanz für Lernprozesse gesetzt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Wille, Volition, Verhaltenssteuerung, Selbstkontrolle, Selbstregulation, Selbstorganisation, Lernen, Alter, Transgenerationalität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Wille und Volition?
Während "Wille" oft umgangssprachlich genutzt wird, bezeichnet Volition in der Psychologie die bewusste Umsetzung von Zielen in Handlungen, insbesondere die Überwindung von Hindernissen.
Wie unterscheidet sich die Willensstärke zwischen Jung und Alt?
Die Arbeit untersucht, ob ältere Personen über andere Strategien der Verhaltenssteuerung verfügen und wie sich ihre Ausdauer beim Lernen im Vergleich zu jüngeren Generationen verhält.
Was versteht man unter Selbstregulation beim Lernen?
Selbstregulation ist die Fähigkeit, eigene Lernprozesse zu planen, zu überwachen und bei Bedarf anzupassen, um langfristige Lernziele trotz Ablenkungen zu erreichen.
Können ältere Menschen ihre Willenskraft steigern?
Ja, die Altersforschung zeigt Möglichkeiten auf, wie durch gezielte Strategien und Motivationsanreize die Willensanstrengung im Alter aufrechterhalten oder sogar gesteigert werden kann.
Warum ist das Thema für die berufliche Weiterbildung relevant?
Angesichts des "Lebenslangen Lernens" ist es für Unternehmen wichtig zu wissen, wie sie ältere Arbeitnehmer motivieren und deren Lernprozesse durch passende Rahmenbedingungen unterstützen können.
- Citation du texte
- Torsten Bergt (Auteur), 2006, Wollen Sie? Wille und Lernen im transgenerationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70505