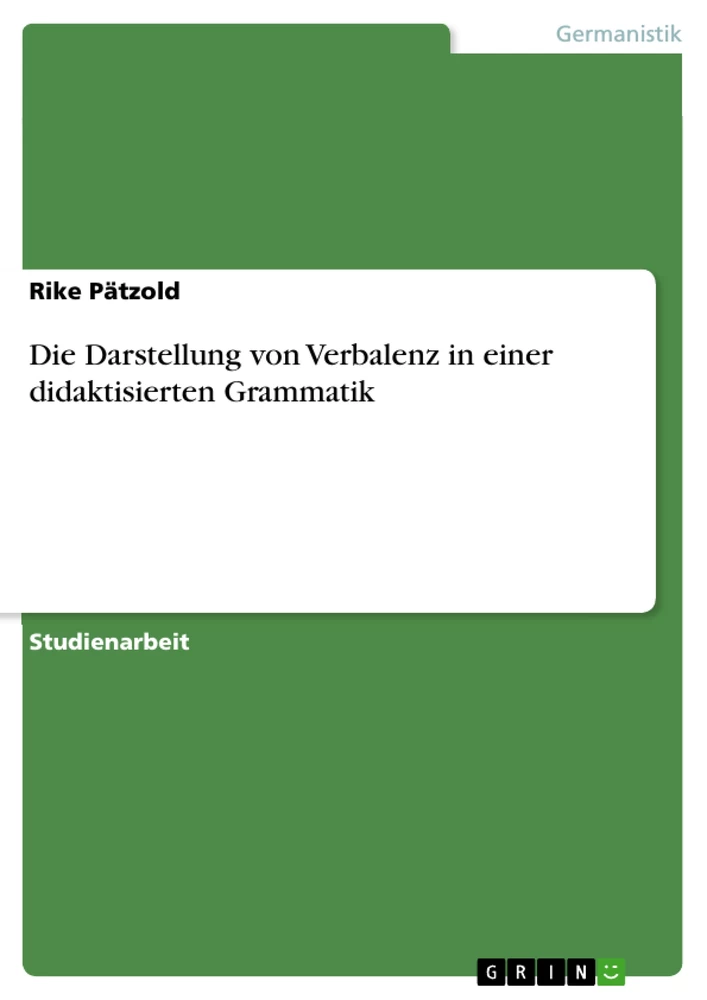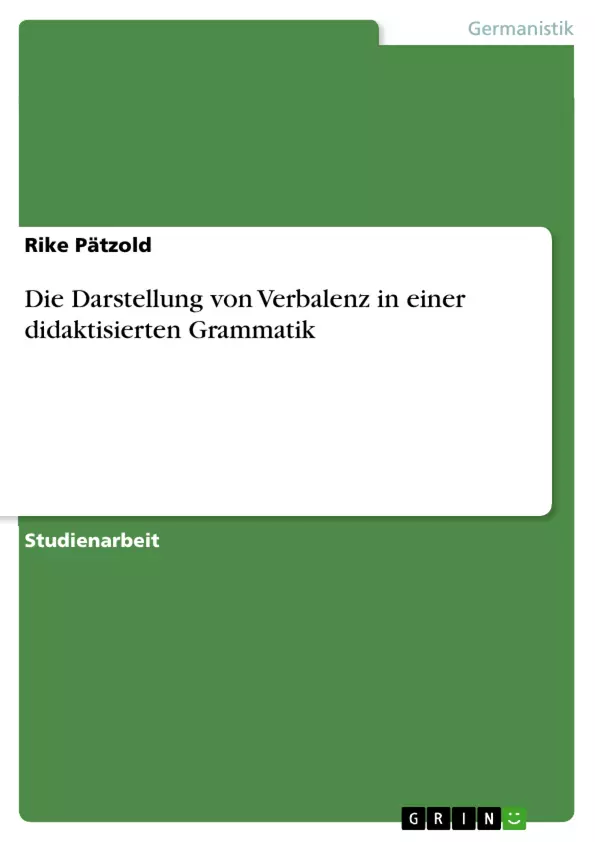Als strukturbildendes Phänomen hat die Wortvalenz und hier insbesondere die Verbvalenz die Forschung im Anschluß an den Valenzbegriff von Tesnière bis zum heutigen Tag beschäftigt. In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nach gegangen werden, inwiefern sich Ergebnisse der linguisitischen Forschung und Diskussion bezüglich der Verbvalenz für den DaF-Unterricht nutzen lassen, um daraus wiederum Überlegungen für die Erstellung einer didaktisierten Grammatik zu ziehen. Die Problematik der Auswahl des richtigen Objektkasus - Dativ oder Akkusativ - , der passenden Präposition (die durch die Modifizierung der Verbbedeutung maßgeblich seine Valenzeigenschaften mitbestimmt) und der Stellung der Verbmitspieler im Satz - all das sind Schwierigkeiten, mit denen der Deutschlerner zu kämpfen hat und die unmittelbar mit der Verbvalenz zusammenhängen. Bevor aber didaktische Vorschläge diskutiert werden, ist es sinnvoll, sich die Funktion der Wortart Verb erneut vor Augen zu führen, schon um einige Mißverständnisse aus dem Weg zu räumen. (s. Kapitel 1.1.). Ein für die Sprachdidaktik interessanter und wichtiger Punkt ist die Frage nach Universalität: gibt es Aussagen, die man über die Wortart Verbund seine Valenz machen kann, die auf alle Sprachen zutreffen und, wenn ja: welche? Ohne näher auf Details eingehen zu können, soll das im Kapitel 1.2. kurz angerissen werden. In Kapitel 2.wird verglichen, wie man sich in zwei verschiedenenen Grammatiken konkret mit dem Thema Verbvalenz auseinandersetzt, um einige Punkte aufzuzeigen, in denen Linguisten sich noch alles andere als einig sind. Das ist deshalb von Bedeutung für eine didaktisierte Grammatik, da gerade hier linguistische Ansätze für den DaF-Unterricht nutzbar gemacht werden sollen. Welcher Ansatz ist also hierfür brauchbar, welcher für den Lerner bedeutungslos bzw. zu abstrakt? Im dritten Kapitel werden die vorgestellten Aspekte von Verbvalenz und Verbvalenzforschung zu einem vierstufigen Didaktikmodell zusammengesetzt, das sich gleichzeitig an den im Hauptseminar erarbeiteten Erwerbstufen orientiert. Auf der ersten Stufe (3.1.) geht es um die Vermittlung des semantischen Aspekts - also die Qualität von Verben und die Semantik der Kasus: weder das Sprachsystem per se noch das Grammatikbuch oder Vokabelheft des Lerners geben vor, welche Leerstellen sich um ein Verb auftun und gesättigt werden wollen; das tut das Verb in seiner Konstitution ganz allein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verb und seine Funktion
- Mißverständnisse durch ungenügende Begrifflichkeiten
- Der Begriff Tunwort
- Der Begriff Zeitwort
- Kontrastiver Überblick...
- Darstellung von Verbvalenz in der Textgrammatik von Weinrich und im Grundriß deutscher Grammatik von Eisenberg
- Unterschiede in Semantik und Begrifflichkeit ........
- Probleme beider Grammatiken bei der Anwendung auf einen konkreten Text.
- Vorschläge zur Darstellung von Verbvalenz in einer didaktisierten Grammatik............
- Verbvalenz auf semantischer Ebene
- Verbvalenz auf pragmatischer Ebene...
- Verbvalenz auf lexikalischer Ebene.......
- Verbvalenz auf grammatikalischer Ebene.....
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verbvalenz aus linguistischer Sicht und setzt diese Erkenntnisse in den Kontext des DaF-Unterrichts, um daraus Vorschläge für die Erstellung einer didaktisierten Grammatik zu entwickeln. Sie betrachtet die Problematik der Verbvalenz im Deutschen und ihre Bedeutung für Deutschlerner, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl von Kasus, Präpositionen und Satzgliedstellungen.
- Die Funktion der Wortart Verb und ihre Bedeutung für die Valenztheorie
- Die Darstellung von Verbvalenz in verschiedenen Grammatiken und ihre Relevanz für den DaF-Unterricht
- Die Entwicklung eines vierstufigen Didaktikmodells zur Vermittlung von Verbvalenz in didaktisierten Grammatiken
- Der Einfluss des sprachlichen Hintergrundes der Lernenden auf den Erwerb der Verbvalenz
- Die Bedeutung von Orientierungstypen für die Internalisierung von Verbvokabeln und deren syntaktisches Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Verbvalenz und ihre Relevanz für den DaF-Unterricht dar. Kapitel 1 beleuchtet die Funktion der Wortart Verb und räumt mit einigen Mißverständnissen bezüglich der Begrifflichkeiten „Tunwort“ und „Zeitwort“ auf. Kapitel 2 vergleicht die Darstellung der Verbvalenz in zwei verschiedenen Grammatiken, um die Unterschiede in Semantik und Begrifflichkeit aufzuzeigen und die Probleme der Anwendung auf konkrete Texte zu analysieren. Kapitel 3 präsentiert schließlich ein vierstufiges Didaktikmodell, das die Aspekte der Verbvalenz auf verschiedenen Ebenen (semantisch, pragmatisch, lexikalisch und grammatikalisch) in den Kontext des DaF-Unterrichts stellt.
Schlüsselwörter
Verbvalenz, DaF-Unterricht, didaktisierte Grammatik, Kasus, Präposition, Satzgliedstellung, Semantik, Pragmatik, Lexik, Grammatik, Orientierungstypen, Sprachsystem, Sprachverständnis, Muttersprache
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Verbvalenz“?
Verbvalenz (oder Wertigkeit) bezeichnet die Eigenschaft eines Verbs, eine bestimmte Anzahl und Art von Ergänzungen (Leerstellen) im Satz zu fordern.
Warum ist die Verbvalenz für DaF-Lerner so schwierig?
Lerner müssen entscheiden, welcher Kasus (Dativ/Akkusativ) und welche Präposition zu einem Verb passen, was oft nicht aus der Muttersprache ableitbar ist.
Was ist das Problem mit Begriffen wie „Tunwort“ oder „Zeitwort“?
Diese Begriffe sind oft ungenau, da Verben nicht immer eine Tätigkeit ausdrücken (z. B. "bleiben") und auch andere Wortarten Zeitbezüge haben können.
Wie sollte eine didaktisierte Grammatik die Valenz darstellen?
Die Arbeit schlägt ein vierstufiges Modell vor, das semantische, pragmatische, lexikalische und grammatikalische Ebenen kombiniert.
Welchen Unterschied gibt es zwischen der Grammatik von Weinrich und Eisenberg?
Die Arbeit vergleicht, wie beide Werke Valenz definieren, und stellt fest, dass linguistische Ansätze oft zu abstrakt für den praktischen Sprachunterricht sind.
Was sind „Orientierungstypen“ beim Vokabellernen?
Es sind Hilfsmittel oder Muster, die dem Lerner helfen, das syntaktische Verhalten eines Verbs (welche Mitspieler es braucht) zusammen mit der Bedeutung abzuspeichern.
- Quote paper
- Rike Pätzold (Author), 2006, Die Darstellung von Verbalenz in einer didaktisierten Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70590